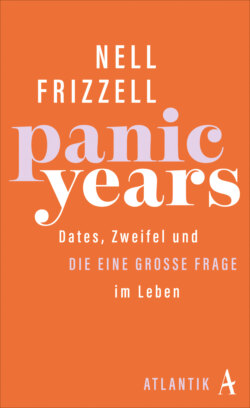Читать книгу Panic Years - Nell Frizzell - Страница 8
4 Glasbaby
ОглавлениеJetzt kommt etwas, was ich noch nicht oft zugegeben habe: In meinen verletzlicheren Augenblicken stelle ich mir manchmal gern meine eigene Beerdigung vor. Ich bin kein Grufti, und nachdem ich zwei Menschen vor meinen Augen habe sterben sehen, habe ich auch keine falsche glamouröse Vorstellung vom Tod mehr. Zu der Beerdigungsphantasie kehre ich dennoch immer wieder zurück. Darin ist irgendwie als Teil meines Testaments vorgeschrieben, dass jeder einzelne Mensch, der mich je verlassen, abgewiesen, nach dem Sex fallenlassen, unfreundlich beschrieben, geghostet, meine Verführungsversuche beschämt oder mich in der Öffentlichkeit herabgesetzt hat, gezwungen ist, bei meiner Trauerfeier in den vordersten Reihen zu sitzen. In diesem Szenario bin ich selbstverständlich eine unglaublich erfolgreiche und hochgeschätzte Schriftstellerin, Fernsehpersönlichkeit, Autorin und, wieso nicht, Wohltäterin. Meine Beerdigung wird im ganzen Land ausgestrahlt, und jedes Mal, wenn eine weitere Berühmtheit aufsteht, um eine rührselige Trauerrede über meinen Witz, meine Schönheit und meinen phänomenalen Erfolg zu halten, wird die Kamera die Gesichter all jener armseligen kleinen, schlaffen Leute ranzoomen, die versucht hatten, mir wehzutun. Sie werden vor allen anderen beschämt dafür, wie sie mich behandelt haben, und sie werden mich um postume Vergebung bitten.
Wie gesagt, ich spreche nicht oft darüber, und mir ist durchaus bewusst, dass diese Phantasie mich als Narzisstin und womöglich auch als Psychopathin dastehen lässt. Aber ich zweifle auch nicht einen einzigen Augenblick daran, dass die Mehrzahl von euch eine ganz eigene Version einer solchen Phantasie hat. Die Version einer Zukunft, in der eure beruflichen Leistungen euer persönliches Scheitern lindern. Eine Rachephantasie, die nicht auf Gewalt oder Grausamkeit, sondern einfach nur auf eurer Überlegenheit basiert. Wie der unerklärlich beliebte Desert-Island-Discs-Favorit Frank Sinatra einst sagte: Die beste Rache ist massiver Erfolg. Und ich will beides.
Für mich – und wahrscheinlich für viele andere Frauen meiner Generation – sind Arbeit, Sex, Identität, Selbstbewusstsein, Geld und Status auf eine Weise vermischt, die viel komplexer ist, als ich mir eingestehen möchte. Wie viele Menschen haben einen bedeutenden romantischen Partner durch die Arbeit kennengelernt? Wie viele von uns haben sich in die Arbeit gestürzt, um Trauer zu verarbeiten? Wie viele Freundschaften hat man auf der Arbeit geknüpft? Wie oft ist man nach der Arbeit noch etwas trinken gegangen, statt in eine leere Wohnung zurückzukehren? Wie viele von uns würden depressiv werden, wenn wir nicht die Arbeit hätten, die uns an den meisten Tagen morgens aus dem Bett wirft? Die Grenze zwischen Arbeit und »Leben« ist, wie ungesund oder unvermeidbar es auch sein mag, so verschwommen wie die Sicht durch ein Busfenster an einem frostigen Januarmorgen. Weshalb die Arbeit für viele von uns in den Panikjahren eine enorme Rolle spielt, uns vorantreibt, unsere Identität formt und unser Handeln ermöglicht, während wir versuchen, eine Zukunft herauszudreschen, in der wir glänzen können.
Ein paar Monate, nachdem Alice ihre Bombe platzen ließ, sitze ich am langen hölzernen Esstisch meiner Freundin Raphi, und meine Zähne verfärben sich vom Rotwein, während ich ihre Mitbewohner mit einem Bericht über die Ausstellung amüsiere, die ich an diesem Tag für einen Guardian-Artikel besucht habe. Es geschieht nicht oft, dass ein greller freudianischer Albtraum ins eigene Arbeitsleben spaziert und einem direkt in den Uterus boxt. Aber an diesem Tag schien es so weit zu sein. Als ich den ersten Raum betreten hatte, kam ein junger Galerieassistent auf mich zu, ein hohles mundgeblasenes Glasbaby von der Größe eines sechs Monate alten Kindes im Arm. Dieses Baby legte er mir wortlos in die Arme. Aufgrund meines bevorstehenden dreißigsten Geburtstags war das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel.
Als ich die Glasskulptur fest im Griff hatte, ließ ich ein lautloses Seufzen entweichen, bevor ich schließlich vorsichtig hinunterblickte auf das winzige, nach oben gerichtete Gesicht des Babys. Ich sah den Fußboden. Nichts als den harten schwarzen Fußboden unter mir. Da war kein Baby, nur transparentes Glas und ein sehr sauberer Fußboden. Dennoch wurde ich irgendwie von all der Angst, dem Verlangen, der Freude und der Sehnsucht überflutet, die ein echtes Baby auslösen kann. Ich fragte mich, ob ich es küssen sollte, ich stellte mir vor, es fallenzulassen. Während mein Herz wild pochte und mein Nacken steif wurde, dachte ich daran zuzusehen, wie diese kostbare und wahrscheinlich extrem wertvolle Kreation vor meinen Füßen in tausend Sandkörner zersprang.
»Meine Hände wurden so schwitzig, dass ich Angst hatte, man würde mich gleich mit Trockeneis bewerfen oder in eine Löschdecke wickeln«, erzähle ich einem von Raphis Mitbewohnern, schlucke die Erinnerung hinunter und schenke mir nach.
Als ich das Glasbaby endlich losgelassen und mit einer Mischung aus Bedauern und Erleichterung an eine andere junge Journalistin weitergegeben hatte, ging ich in den nächsten Raum, wo ich ein langes Regal voller Eierbecher mit hart gekochten Eiern darin vorfand. Eine endliche Anzahl von Eiern. Natürlich. Als Besucherinnen waren wir aufgefordert, eins der hart gekochten Eier aufzuschlagen und direkt an Ort und Stelle zu verspeisen, ein Akt des kreativen Ausdrucks, der sich jedoch wie Kannibalismus anfühlte. Die Künstlerin hatte sogar kleine Salz- und Pfefferstreuer zur Verfügung gestellt – die ewige Partnerschaft ergänzender Gewürze hielt Wache über diese begrenzte Menge von Eiern. An dem Tag starrte diese Galerie noch mehr vor Symbolismus als eine katholische Kirche, und ich war Wachs in den Händen der Künstlerin.
Ich spazierte durch die Ausstellung, kritzelte dabei in mein kleines rotes Notizbuch, ein Lächeln ins Gesicht getackert, das man normalerweise in Aufklärungsfilmen über Gebärmutterhalsuntersuchungen sieht, und versuchte, nicht an dem heißen Klumpen aus Panik in meinem Hals zu ersticken. Das hier ist mein Job, sagte ich mir. Ich bin ein geistiger Mensch, eine professionelle Intellektuelle, geleitet von Vernunft und Sprache und Theorie. Ich bin keine heißblütige Bestie, die auf einer Flut aus Schweiß und dem Eiklar so vieler unbefruchteter Eizellen durch London kriecht. Es ist bloß Arbeit – nichts Persönliches.
In der Sicherheit von Raphis Wohnung essen wir salzige Pasta und rauchen Selbstgedrehte unter einer riesigen Weltkarte. Wir reden, erzählen Witze, tratschen, schauen auf unsere Telefone und illustrieren jede Anekdote mit einem iPhone-Foto, das am Tisch herumgereicht wird wie ein Joint. Ich erzähle von einem Mann, mit dem ich vor kurzem geschlafen habe, der meine Beine als »Bleistifte« beschrieb, ein Freund rechnet aus, wie viel Shortbread er essen muss, um die 27 Meilen auf dem Fahrrad auszugleichen, die er zu und von seinem Filmjob in einem Vorort zurücklegen muss, wir vergleichen Kriegsverletzungen an unseren Arbeitsplätzen und spekulieren über unsere Überlebenschancen, wenn die Apokalypse eintrifft. Das ganz gewöhnliche Zeug eben. Irgendwann höre ich inmitten des Geplauders Raphi zu der Frau neben ihr sagen, sollte sie jemals für eine Weile aufhören zu arbeiten – wahrscheinlich, um ein Baby zu bekommen –, dann müsste sie es irgendwie schaffen, jetzt sofort befördert zu werden, »denn wer will schon eine dreißigjährige Assistentin einstellen«. Sie äußert es mit einem Zweifel in der Stimme, als wünschte sie, wir würden ihr widersprechen.
Ihre Worte treffen mich wie ein Eisblock. Niemand will eine dreißigjährige Assistentin einstellen. Ich bin eine neunundzwanzigjährige Redaktionsassistentin, die für eine kleine Kunstzeitschrift, Wohltätigkeits- und Networking-Seite im Internet arbeitet. Ich habe absolut alles geschrieben, was ich aus meinen wenigen Universitätskontakten herausquetschen konnte, innerhalb wie außerhalb einer Vollzeitstelle, die gerade genug einbringt, um mir ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu leisten. Ich habe Pitches in die große schweigende Leere der Auftragsvergabe bei Zeitungen und Magazinen gemailt und selten auch nur eine höfliche Absage bekommen. Ich liebe das Schreiben, liebe den Journalismus, sehne mich danach, entdeckt zu werden, und tue daher für 100 Pfund so ziemlich alles. Ich habe keine Rentenversicherung, kann die Zinsen meines Studienkredits nicht abbezahlen, von der vollen Summe ganz zu schweigen, und habe keine Ahnung, ob mein Vertrag überhaupt einen Mutterschutz beinhaltet. Ich mag mich der dreißig nähern, aber irgendwie habe ich noch genauso wenig das Gefühl, mich auf meinem Feld zu etablieren wie mit fünfundzwanzig oder auch mit zweiundzwanzig. Niemand will eine dreißigjährige Assistentin einstellen. Natürlich nicht. Und es geht weit über die eigene Reputation oder das wahrgenommene Potenzial hinaus. Wird man schwanger, während man noch Assistentin ist, verdient man womöglich nicht genug, um nach dem Mutterschaftsurlaub die Kosten der Kinderbetreuung zu decken. Wenn man überhaupt das Glück hat, Mutterschaftsurlaub zu bekommen. Was bedeutet, dass man fortan womöglich nur noch in Teilzeit arbeiten kann. Viele Arbeitgeber wollen jedoch keine Teilzeitassistentinnen. Das muss man zu der Tatsache hinzurechnen, dass man nun als ein Elternteil über dreißig in seine Branche zurückkehrt und mit einer Menge gieriger junger Leute in ihren Zwanzigern konkurriert, die einem alle den Job streitig machen wollen und in der Lage sind, ihn für weniger Geld zu erledigen, weil sie so gut wie keine Verpflichtungen, aber die gleiche Arbeitserfahrung haben wie man selbst. Wird man schwanger, während man noch Assistentin ist, kann man sich den Verdiensteinbruch womöglich nicht leisten, verdient aber auch nicht genug, um es sich leisten zu können, in den Job zurückzukehren. Es ist die klassische Zwickmühle.
Vielleicht liegt es an meiner Begegnung mit dem Glasbaby ein paar Stunden zuvor, aber plötzlich kommt der Konflikt im Kern meiner Existenz brüllend an die Oberfläche. Wenn ich mir die Art von Karriere wünsche, die männliche und kinderlose Gleichaltrige genießen, und dazu die Art von Unabhängigkeit, die ich mir immer für mich ausgemalt habe, dann muss ich augenblicklich die Spitze der Leiter erklimmen, bevor ich auch nur über eine Familie nachdenke. Aber, wie mir die Krise der im Regal zurückgelassenen gekochten Eier gerade erst in Erinnerung rief, wenn ich mir ein Baby wünsche, dann werde ich bald versuchen müssen, schwanger zu werden, vielleicht gar sofort, sonst rennen mir die Zeit und, nun ja, meine Eizellen davon.
Aufgrund der Art und Weise, wie wir Arbeit organisieren und Menschen in Elternzeit bezahlen, aufgrund der körperlichen Herausforderungen von Schwangerschaft, Geburt und Stillen, den unerschwinglichen Kosten der Kinderbetreuung und der kompetitiven Natur moderner Erwerbstätigkeit, erscheint es vielen von uns unmöglich, sich ein Jahr Auszeit zu nehmen, um eine Familie zu gründen. Denn es bliebe ja nicht bei einem Jahr, oder? Wenn man nicht genügend verdient – und zwar nach Steuern, zuzüglich aller existierenden Rechnungen, Hypotheken und Lebensunterhaltskosten –, um jene tausend oder mehr Pfund zu zahlen, die es kosten kann, ein Kind in einen Ganztagskindergarten zu stecken, während man wieder zur Arbeit geht, dann sitzt man auf einmal fünf Jahre zu Hause, bis das Kind (sofern man nur ein einziges bekommt) in die Schule geht und umsonst betreut werden kann.
In jenen fünf Jahren können all jene, die nicht gebären, ein Kleinkind großziehen, Kinder betreuen oder ihrem Baby körperlich nah sein müssen, um es zu ernähren und am Leben zu erhalten, auf einmal im Job an einem vorbeiziehen. Beförderungen, Erfahrung, Weiterbildungen, Kontakte: Das alles versäumt man. Entscheidet man sich jedoch, diese fünf Jahre mit Arbeiten zu verbringen – seine Karriere aufzubauen, seinen Wert unter Beweis zu stellen, Geld zu verdienen, die Leiter zu erklimmen –, dann können plötzlich die eigenen Chancen, schwanger zu werden, und die Wahrscheinlichkeit, ein gesundes Baby zu bekommen, verloren gegangen sein, auf unermessliche, dauerhafte Weise.
Mit einem Mal ist der Widerspruch, der sich um mich geschlossen hat wie ein Käfig, unausweichlich, unbestreitbar, überdeutlich. Ich muss jetzt arbeiten, sonst verpasse ich meine Karrierechancen. Ich muss jetzt einen Freund finden, sonst verpasse ich komplett meine Chance auf eine Familie. Keine Ahnung, wie sich die Präsenz dieser Situation mir bislang hatte entziehen können, aber unter dem Gewicht von Raphis Worten ist mein unschuldiger Zustand mit einem Mal in sich zusammengefallen wie ein Scone von der Tankstelle. Ich bin dreißig. Bei meiner Mum haben die Wechseljahre mit vierzig eingesetzt. Mir bleiben womöglich nur noch zehn fruchtbare Jahre. Ich arbeite immer noch bloß als Assistentin. Ich bin am Arsch.
Im Jahr 1970 wurde am Ruskin College in Oxford die Gründungskonferenz des Women’s Liberation Movement abgehalten, bekannt unter dem einprägsamen Namen National Women’s Liberation Conference. Ich erinnere mich noch, dass ich das erste Mal von der Konferenz erfuhr, als ich in der Women’s Library arbeitete: Damals stand ich im Kellerarchiv des ehemaligen viktorianischen Waschhauses und starrte auf Fotografien von bärtigen Männern in dicken Rollkragenpullovern, die die Krippe der Konferenz betrieben, während ihre Partnerinnen im Nebenraum diskutierten, debattierten und agitierten. Ich hörte mir die Audioaufnahme einer walisischen Frau an, die beschrieb, wie sie als Frischverheiratete in ihren Zwanzigern in einen Bus gestiegen und zum ersten Mal in ihrem Leben nach Oxford gefahren war, um an der Konferenz teilzunehmen, nachdem sie das Abendessen und den Tee für ihren Mann zubereitet und eine Notiz am Kühlschrank hinterlassen hatte. Ich las die Liste der Forderungen, die während jener ersten Konferenz ausgearbeitet wurde:
Gleiche Bezahlung
Gleiche Bildungs- und Karrierechancen
Frei zugängliche Verhütung und Abtreibung bei Bedarf
Kostenfreie 24-Stunden-Kindergärten
Als ich jene Fotos betrachtete und mir die Berichte von der Ruskin-Konferenz durchlas, spürte ich etwas durch mich pulsieren. Nicht nur Stolz, nicht nur Erstaunen, sondern Triumph. So müssen sich Fußballfans fühlen, wenn sie zusehen, wie Bobby Moore den Weltmeisterpokal von 1966 in die Luft hebt. So müssen sich Soldaten fühlen, wenn sie auf dem Weg in die Schlacht die Nationalhymne hören. Dies waren meine Leute, dies waren meine Frauen, und sie kamen zusammen und taten etwas Unglaubliches, damit ich auf eine Weise leben konnte, die ihnen nicht vergönnt war. Bei späteren Konferenzen – die quer durchs Vereinigte Königreich abgehalten wurden –, fügten sie der Liste drei weitere Forderungen hinzu:
Rechtliche und finanzielle Unabhängigkeit für alle Frauen
Das Recht auf eine selbst definierte Sexualität. Das Ende der Diskriminierung von Lesben
Freiheit von der Einschüchterung durch Androhung oder Anwendung von Gewalt oder sexueller Nötigung für alle Frauen, unabhängig von ihrem Familienstand; und ein Ende der Gesetze, Bedingungen und Institutionen, die männliche Dominanz und Aggression gegenüber Frauen aufrechterhalten
Diese Forderungen sprechen für ihre Zeit, aber auch für die Jahrhunderte davor und die Jahrzehnte, die seitdem vergangen sind. Sie sprechen heute für mich, wie sie vor beinahe einem halben Jahrhundert für meine Mutter sprachen. Ich frage mich, ob irgendjemand eine solche Liste lesen kann, ohne im Innersten zu spüren, dass diese Forderungen richtig sind. Sex, Geld, Kinder, Macht: die vier Eckpfeiler, innerhalb derer Frauen festgehalten werden und leben. Auf einmal bestand die Möglichkeit, diese Ecken auszuweiten, die Seiten zu dehnen und neu zu definieren, was wir als normal akzeptieren. Dennoch stand ich fünfundvierzig Jahre später da und schlug mit der Faust gegen die blutverschmierten Glaswände, die mich noch immer von meinen männlichen Altersgenossen trennten. Ohne eine allgemeine Kinderbetreuung, gleiche Bezahlung und gleiche Chancen war es für mich unmöglich, meine Karriere, meine Fruchtbarkeit und meine Zukunft anzugehen wie ein Mann. Ich hatte vielleicht freien Zugang zu Verhütung, aber Abtreibungen bei Bedarf? Kindergärten, die rund um die Uhr geöffnet haben? Ein Ende der Gesetze, Bedingungen und Institutionen, die männliche Dominanz aufrechterhalten? Wollt ihr mich verarschen?
Wenn ich arbeitete, würde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weniger verdienen als ein Mann in einer vergleichbaren Position. Wenn ich ein Kind haben wollte, müsste ich irgendwie ein vollständiges zweites Einkommen heraufbeschwören, nur um die Kinderbetreuung zu bezahlen, oder für fünf Jahre ganz mit dem Arbeiten aufhören, bis das Kind in die Schule ginge. Der Kindergarten in meinem Bezirk kostet mindestens 43 Pfund pro Tag für ein Kind von 0–2 Jahren. Bei einem Haushaltseinkommen über 35000 Pfund (was bei uns definitiv nicht der Fall war) steigt der Betrag auf 50 Pfund pro Tag. Das bedeutet, um mein Baby in einen Kindergarten um die Ecke schicken und wieder Vollzeit arbeiten zu können, bräuchte ich ein sicheres und regelmäßiges Einkommen von mindestens 215 Pfund pro Woche oder 860 Pfund pro Monat allein für die Kinderbetreuung während meiner Arbeitszeit, ganz zu schweigen davon, genug für Essen, Fahrtkosten, Miete, Heizung und all die anderen Luxusgüter zu verdienen, für die Eltern so gern ihr Geld aus dem Fenster werfen. Im Vereinigten Königreich kostet ein Kindergartenplatz für ein Kind unter zwei Jahren durchschnittlich 127 Pfund pro Woche, wenn man Teilzeit arbeitet (25 Stunden), und 242 Pfund pro Woche in Vollzeit (50 Stunden). Das Durchschnittsgehalt im Vereinigten Königreich beträgt für jemanden, der Vollzeit arbeitet, 569 Pfund pro Woche (oder ungefähr 29500 Pfund pro Jahr, sogar noch weniger nach Steuern). Das heißt, sobald man die Kosten für die Kindererziehung (für nur ein Kind unter zwei Jahren) abgezogen hat, bleiben einem im Durchschnitt noch 327 Pfund pro Woche zum Leben, für jede andere Rechnung, alles, was man isst, jedes Busticket und jede Studienkreditrückzahlung. Damit gehen 43 Prozent des Einkommens direkt in die Kinderbetreuung. Das ist selbst mit finanzieller Unterstützung eines Partners schon übel, für Alleinerziehende erscheint die Situation im Grunde unmöglich.
Wenn man nicht deutlich mehr als das landesweite Durchschnittseinkommen verdient, ist es ein harter Kampf, genügend zusammenzubekommen, um die Rechnungen zu bezahlen, sich selbst und ein Baby zu ernähren, einzukleiden und zu versorgen, ganz zu schweigen von der Kinderbetreuung, die es einem ermöglichen würde, dieses Gehalt auch tatsächlich zu verdienen. Wir mögen ein gewisses Ausmaß an reproduktiver und beruflicher Freiheit haben, aber es ist keine echte Freiheit, wenn die Kosten für die Kinderbetreuung und die Inflexibilität am Arbeitsplatz es für so viele Frauen unmöglich machen, sich sowohl eine Familie als auch eine Karriere zu leisten. Auf ähnliche Weise haben wir nun zwar vielleicht die Freiheit, Karrieren in Berufen mit höherem Status und höherer Sichtbarkeit anzustreben, etwa in den Medien oder den Künsten, aber auch das ist keine echte Freiheit, wenn von einem zugleich erwartet wird, eine völlig überteuerte Miete an einen in der Ferne lebenden wohlhabenden Vermieter zu zahlen, während man gerade mal den Mindestlohn verdient und sich noch dazu häufig aufgefordert sieht, unbezahlt zu arbeiten, um damit »das eigene Profil zu schärfen«. Für Frauen in den Panikjahren garantieren reproduktive Freiheit und Zugang zu Beschäftigung keineswegs Sicherheit, Chancen und Unabhängigkeit. Und wir sollten nicht vergessen, dass ich das als eine der ungeheuer Glücklichen sage: als weiße Frau aus der Mittelschicht, die in einem wirtschaftlich entwickelten Land lebt und einen Job mit hohem Status hat.
Für People of Colour, Menschen in Niedriglohnjobs, Menschen ohne Qualifikationen oder Zugang zu Hochschulbildung, Menschen mit Behinderungen und Menschen in den Entwicklungsländern liegt die Aussicht darauf, dass diese Forderungen im alltäglichen Leben erfüllt werden, in noch weiterer Ferne. Wenn ich, wie so viele Mädchen aus meiner eigenen Schule, mit sechzehn abgegangen wäre, eine Teilzeitstelle als Putzkraft angenommen und einen Mann kennengelernt hätte, der nicht gern Kondome benutzt, den ich aber nicht hätte vergraulen wollen, weil ich »frigide« oder »schwierig« war, den ich so toll gefunden hätte, dass ich das Risiko einging, wenn ich dann schwanger geworden und nicht bei einer Gewerkschaft gewesen wäre, keine verständnisvollen Eltern und kein Erspartes gehabt hätte, ebenso wenig ein Recht auf Mutterschutz, mir keine Kindergartengebühren hätte leisten können, was hätte ich dann eigentlich getan? In welcher Hinsicht hätte ich dann gleiche Chancen, finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit von männlicher Dominanz gehabt?
Fünf Jahrzehnte nach der National Women’s Liberation Conference in Oxford haben wir komplett versagt, eine Gesellschaft zu erschaffen, in der eine Karriere und ein Kind nicht irgendwie im Widerspruch zueinander stehen. Ich war noch immer gefangen zwischen der Eieruhr meines Körpers und der schwankenden Leiter meiner Karriere. Ich liebte das Arbeiten, liebte meinen Job, liebte die Unabhängigkeit und das Selbstbewusstsein, das ich daraus zog. Wenn ich ehrlich bin, liebte ich das grausame Gefühl von Überlegenheit, das meine Arbeit mir verlieh, wenn ich an all jene glücklichen, zufriedenen Menschen dachte, die in der Lage schienen, eine langfristige Beziehung mit einem Partner zu führen, der sie anbetete. Ich liebte die Vorstellung, dass jede Person, die mich je verschmäht oder abgewiesen hatte, eines Tages die Zeitung aufschlagen oder das Radio einschalten und sich mit meinem Erfolg konfrontiert sehen würde. Und doch, um ein Kind zu bekommen, musste ich diese Karriere womöglich einschränken oder gar aufgeben, zumindest vorübergehend. Damals im Jahr 1970 verlangten die Frauen gleiche Chancen, gleiche Bezahlung und Befreiung von der Kinderbetreuung nicht einfach, um Geld zu verdienen (auch wenn Jahrhunderte der Sklaverei, der Armenhäuser und der Leibeigenschaft bezeugen können, dass finanzielle Unabhängigkeit an sich schon ein ziemlich überzeugendes Motiv darstellt), sondern auch wegen all der anderen Dinge, die Arbeit einem bieten kann: Sicherheit, ein Gefühl für sich selbst, öffentliche Wahrnehmung, einen Sinn, eine Beschäftigung fernab der geistlosen Plackerei einer bestimmten Art von häuslichem Leben, Kolleginnen und Kollegen, physischen Raum, ein Gesprächsthema unter Freundinnen, Gleichberechtigung, eine Gelegenheit, seine Fähigkeiten in einer Sache unter Beweis zu stellen, Ablenkung, Kameradschaft und schlicht die Möglichkeit, von der Mehrheit der Arbeitswelt als »normal« angesehen zu werden.
Viele Menschen beantworten die Frage, wie der Widerspruch zwischen Karriere und Elternschaft zu lösen sei, einfach damit, keine Kinder zu bekommen. Die Redakteurin, Autorin und Rundfunkberühmtheit Terri White drückte es so aus: »Der größte Mythos, der unserer Generation weisgemacht wurde, lautete, wir könnten alles haben. Ich hatte definitiv das Gefühl, nicht die Karriere haben zu können, die ich wollte, wenn ich ein Kind bekäme.« Und so entschied Terri sich jahrzehntelang für ihre Arbeit. Sie widmete ihre Aufmerksamkeit dem Schreiben, Netzwerken, Reisen und Leiten von riesigen Teams, um die Art von Karriere und Leben zu haben, von der sie geträumt hatte. Sie sprach ehrlich und brillant darüber, kinderfrei zu leben, sie verteidigte das Recht von Frauen, selbst zu entscheiden, sie kämpfte gegen den biologischen Determinismus an. Dann, sechs Monate nach unserem Interview, ein paar Wochen nach ihrem vierzigsten Geburtstag und kurz nachdem ich glaubte, dieses Buch fertig geschrieben zu haben, verkündete Terri auf Instagram, sie sei schwanger.
Womit nur bewiesen wäre, dass die Panikjahre und der Fluss sich oftmals weit über unsere Dreißiger hinausziehen, und jeder Mensch seine Meinung ändern oder sich in veränderten Umständen wiederfinden kann. Wie dem auch sei, zwar habe ich einen etwas anderen Weg gewählt, aber ich stimme Terri zu. Ich werde nie wissen, was ich hätte erreichen können, hätte ich mir nicht die Auszeit genommen, um ein Kind zu bekommen, hätte Elternschaft nicht mein Gefühl von Ehrgeiz und Prioritäten dauerhaft neu sortiert, hätte ich nicht einen Menschen erschaffen, an den ich nun mein Leben lang gebunden bin. Indem wir Leuten, insbesondere Frauen erzählten, sie könnten alles haben, wenn sie sich nur genügend anstrengten, entbanden wir unsere Arbeitgeber von der Pflicht, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem das auch tatsächlich möglich ist. Für viele Menschen sind daher die Einschränkungen bei ihrem Einkommen, ihrem Lebensstil, ihren Zielen und ihrer Verantwortung, die eine Elternschaft verursachen würde, einfach zu groß, ist das Opfer zu beträchtlich. Ich erinnere mich daran, wie mich auf der Grillparty zum dreißigsten Geburtstag einer Freundin ihre in Leopardenmuster gekleidete Tante über einem gegrillten Würstchen behutsam ausfragte.
»Hast du Kinder?«, wollte sie wissen.
»Nein«, antwortete ich und zog ein Stückchen Kohle zwischen meinen Zähnen heraus.
»Ah, verstehe«, erwiderte sie mit wissendem Lächeln. »Du bist also eine Karrierefrau.«
Ich weiß noch, wie ich ihr ins Gesicht schreien wollte, dass dies nicht unsere einzige Wahlmöglichkeit sein sollte. Dass auch Mütter ehrgeizig sein dürfen sollten. Dass auch Karrierefrauen Babys bekommen können sollten. Stattdessen ließ ich nicht ganz aus Versehen etwas Ketchup auf ihre Schuhe tropfen.
Ironischerweise bekam ich nur wenige Monate nach dem Vorfall mit dem Glasbaby und meinem Post-Pasta-Weckruf bezüglich meiner Karriereaussichten als Redaktionsassistentin eine Art von Beförderung. Das Gespräch war aus zwei Gründen bemerkenswert: Erstens brach ich beinahe in Tränen aus, als mein Chef mich fragte, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Lasst euch gesagt sein, diese Frage gehört in eine Therapiesitzung und nicht in ein Gespräch mit dem Vorgesetzten. Als ich an dem kleinen weiß lackierten Tisch saß und durch eine halb heruntergelassene Jalousie auf das Hochhaus The Shard blickte, schien mich als Reaktion auf seine Frage die schiere Unsicherheit meiner Zukunft zu überrollen wie ein Tsunami.
Wäre ich in fünf Jahren noch immer Single? Hätte ich noch einen Job? Würde ich noch in London leben? Wäre ich bereits in den Wechseljahren? Würde ich eine Kolumne für eine überregionale Zeitung schreiben? Wäre ich verheiratet? Hätte ich meine eigene Abteilung? Würde ich noch immer drei Flaschen Weißwein trinken, bevor ich mit dem Fahrrad über die London Bridge nach Hause fuhr und mir einbildete, ich wäre unbesiegbar? Würde ich ein Baby haben? Würde ich mit meiner letzten übrig gebliebenen Singlefreundin in einer kleinen Mietwohnung an einem Fluss leben? Wäre ich auf Radio 4 zu hören? Wäre ich glücklich? Würde irgendjemand mich lieben?
Mein armer Chef sah die Flut von Panik in meinem Gesicht anschwellen und wechselte rasch zu weniger schwerwiegenden Themen, wie dem Zustand meines Schreibtischs und meinen Reisekosten.
Der zweite bemerkenswerte Augenblick kam ein wenig später, als ich ihn auf meine Stellenbezeichnung ansprach. Ich erklärte ihm, dass ich gern noch vor meinem dreißigsten Geburtstag von einer Redaktionsassistentin zu etwas mit ein wenig mehr Status aufsteigen wollte. Ich erklärte ihm, sollte ich jemals eine Zeit lang mit dem Arbeiten aufhören, um ein Baby zu bekommen, würde ich wahrscheinlich zwei bis drei Jahre später mit demselben Titel in die Branche zurückkehren müssen, mit dem ich sie verlassen hatte. Wenn dann etwas wie »Redakteurin« oder »stellvertretende Redakteurin« in meinem Lebenslauf stünde, könnte das den Unterschied zwischen einer sofortigen Absage und auch nur der Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ausmachen. Ich erklärte, wenn ich jemals in der Lage sein sollte, eine Familie zu gründen, dann müsste ich vorher aus dem Pool der Redaktionsassistentinnen aussteigen, um bei meiner Rückkehr in den Beruf wenigstens den leisen Hauch einer Chance zu haben, eine Stelle zu bekommen, mit der ich diese Familie ernähren könnte. Ich musste jetzt die nächste Sprosse der Karriereleiter erklimmen. Ich brauchte eine Beförderung, auch wenn es nur eine veränderte Stellenbeschreibung war. Er hörte mir schweigend zu, machte sich Notizen und nickte.
Zwei Wochen später wurden meine Tischnachbarin und ich zu Redakteurinnen ernannt. Er hatte mich angehört, verstanden und, wie alle guten Chefs, etwas getan, um eine Situation zu verbessern, die ihm bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal bewusst gewesen war. Selbstverständlich erledigte ich auch einige Aufgaben, um mir den neuen Titel zu verdienen, aber um eine Situation zu verändern, genügt es manchmal, das Problem öffentlich anzusprechen. Daran glaubten auch die Teilnehmerinnen der Ruskin Women’s Liberation Conference von 1970. Und daran glaubten auch jene Männer in der Krippe der Konferenz. Da draußen gibt es Verbündete. Aber manchmal muss man erst um Hilfe bitten, bevor man sie bekommt.
Als ich an jenem seltsamen Septembertag in der Galerie stand, das Glasbaby in den Händen hielt und einen Ansturm von Gewalttätigkeit, Scham und Sehnsucht verspürte, tat ich meine Arbeit: Ich reagierte auf einen Reiz in der Welt, um diese Erfahrung durch mein Schreiben anderen zu kommunizieren. Ich war Journalistin und Kritikerin. Aber mehr noch war ich ich selbst: eine warmblütige, intelligente, hormongesteuerte, biologische Person im Fluss. Der Fluss. Ich wurde konfrontiert mit der physischen Manifestation aller Entscheidungen, die zu treffen ich mich nicht imstande fühlte, ich blickte in eine noch nicht realisierte Zukunft, die sich jedoch erkennbar am Horizont abzeichnete. Während ich mich in der Welt der Arbeit befand, warf ich einen Blick auf die Mutterschaft und geriet in Panik angesichts der offenkundigen Widersprüche, Kompromisse und Verwirrungen vor mir. Die Panikjahre bedeuten eine Abrechnung mit Sex, Geld, Biologie und Macht. Man kann sie überleben, muss dafür jedoch handeln, sich rüsten und Verbündete suchen.