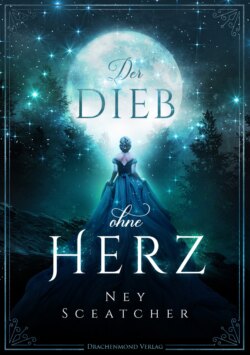Читать книгу Der Dieb ohne Herz - Ney Sceatcher - Страница 7
Оглавление1
Wo Sterne funkelten
vor einigen Jahren
Es war bereits dunkel auf den Straßen, keine Menschenseele war mehr zu sehen. Der Mond beleuchtete schwach die kleinen gepflasterten Wege, die durch das Dorf führten, während vereinzelte Schneeflocken sich einen Weg hinunter auf die Erde bahnten. Kalt war es und dunkel, nur das leise Flüstern des Windes drang durch die Ritzen hinein in die Häuser. Die meisten Menschen lagen in ihren Betten, verkrochen sich unter dicken Wolldecken und träumten bereits von morgen.
In einem Haus, das etwas weiter abgelegen stand, da brannte noch Licht. Eine Frau mit dichtem schwarzem Haar saß an ihrem Arbeitstisch und hatte sich über einen Gegenstand gebeugt. Diese Frau liebte die Nacht, da war es ruhig und man konnte ungestört arbeiten. Während die anderen schliefen, da stellte sie Masken her.
In ihrer Hand lag das neueste Werk, die Bestellung einer reichen Adelsdame. Die Maske war aus Glas, ganz bunt und farbenprächtig, die Seiten zierten Federn von Vögeln. Vögel, die man seit Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte. Die Frau fuhr sich seufzend durch das Haar. Bis morgen früh musste sie fertig sein, nur fehlte noch das gewisse Etwas. Nur was?
Sie wollte erneut aufseufzen, als ein schwaches Klopfen an der Tür sie zusammenzucken ließ.
»Herein!«, rief die Frau, die sich selten fürchtete. Sie glaubte an die Gerechtigkeit und auch an das Gute in den Menschen. Wenn jemand sie bestehlen wollte, dann könnte sie es ohnehin nicht verhindern. Mehr als Masken und bunte Federn konnte sie nicht bieten, denn das Geld, das sie nicht brauchte, das schenkte sie den Armen und Bedürftigen.
Die Holztür schwang auf und ein Mädchen erschien in ihrem Sichtfeld. Zitternd blickte es zu der Frau, eine Hand noch immer auf der Klinke. Der Wind blies ihr durch das Haar, verlieh ihr etwas Gespenstisches. Vielleicht lag es auch einfach an ihrer Haarfarbe. So hell wie das milchige Gesicht des Mondes.
»Verzeihung«, stammelte das Mädchen und umklammerte den Griff der Tür etwas fester.
Die Frau mit dem schwarzen Haar legte die Maske auf die Seite und blickte dann wieder zu ihr auf.
»Wie kann ich dir helfen?«, fragte sie zögerlich.
»Ich brauche eine Maske.« Noch immer zitterte es und erst jetzt fiel der Frau auf, dass diese dürre Gestalt mit dem hellen Haar nur ein einfaches Kleid trug. Der Stoff wehte um ihre Beine und bedeckte kaum ihre Knie. Immer wieder versuchte das Mädchen, das Kleid herunterzuziehen, der Wind war jedoch kräftiger. Die Haut des Mädchens war voller Dreck, kaum eine saubere Stelle war in seinem Gesicht zu finden.
Besorgt stand die Frau auf. »Masken sind hier kostbar, beinahe unbezahlbar.« Sie schüttelte den Kopf. »Komm erst einmal herein.« Auffordernd winkte sie das Mädchen in die warme Stube.
Das Kind nickte erleichtert, trat ein und schloss die Tür hinter sich. Das Rauschen des Windes verwandelte sich augenblicklich wieder in ein sanftes Flüstern.
»Wo sind deine Eltern?«, fragte die Frau und drehte sich kurz um, um nach einer dicken Decke zu greifen, die über einem der Stühle lag. Eilig reichte sie dem Kind das Stück Stoff.
Das Mädchen schwieg, starte einfach geradeaus zu der flackernden Kerze, die auf dem Holztisch stand und den Raum spärlich beleuchtete.
»Bist du auf der Flucht?«, versuchte es die Frau weiter.
Noch immer schwieg das Mädchen.
»Du brauchst nicht zu antworten, wir sind alle auf der Flucht vor irgendetwas.«
Das Mädchen lächelte und nickte. Die Frau wusste nicht warum, doch dieses Lächeln erweichte ihr Herz. Sie durfte dieses Kind nicht einfach wieder hinaus in die Kälte schicken. Bestimmt hatte es seine Eltern bei dem Sturm verloren und morgen, sobald der Himmel wieder klar war, würde sie dem Mädchen helfen, seine Familie zu finden.
»Was für eine Maske möchtest du denn?«
»Eine dunkle, mit Sternen«, sprach das Mädchen ganz überzeugt. Ihre anfängliche Unsicherheit schien wie verflogen.
»Ich muss dich leider enttäuschen, ich werde dir keine Maske machen.«
Die Mundwinkel des Kindes wanderten wieder nach unten.
»Ich werde dir zeigen, wie es geht, und dann machst du deine eigene.«
»Malina!«
»Malina!«
»Himmel noch mal, Malina, das Wasser!«
Erschrocken zuckte ich zusammen. Meine Gedanken waren gerade bei meiner ersten Begegnung mit Irena gewesen. An diesen Tag aus meiner Kindheit konnte ich mich noch gut erinnern. Er war einer der wenigen, die mir im Gedächtnis geblieben waren.
»Malina!«
»Ja!« Ich rollte mit den Augen und nahm den Topf mit dem kochenden Wasser von der Feuerstelle.
»Ich wundere mich bei dir manchmal, dass die komplette Hütte noch nicht in Brand steht.« Irena seufzte und fuhr sich energisch durch ihr dichtes, dunkles Haar.
Ich schwieg und verdrängte den Gedanken, dass mir genau das beinahe vor einer Woche passiert wäre. Ich hatte das Feuer vergessen und war eingeschlafen. Zum Glück befand Irena sich zu dieser Zeit auf dem Marktplatz.
»Irgendwelche interessanten Bestellungen?«, fragte ich, um sie von dem Thema abzulenken. Es war warm und die Sonne schien erbarmungslos vom Himmel. Manchmal bedauerte ich es, dass wir nicht unten am Meer wohnten. Dort wehte wenigstens ein kräftiger Wind. Den brauchten die Fischer auch. Sie verbrachten den ganzen Tag auf ihren Segelbooten und waren der Sonne ausgeliefert.
»Eine Maske für die Zofe eines adligen Herrn, eine Maske für den Stadtältesten für ein Fest, eine Maske für eine reiche Dame aus Bolinski und eine Maske für einen Handelsmann.« Irena setzte sich auf ein beiges Holzscheit neben dem Feuer und betrachtete die Flammen. Hinter ihr befand sich unser Heim, in dem wir beide lebten. Das Haus war wie alle Behausungen des kleinen Fischerdorfes Rondama klein, alt und trotzdem robust. Der einzige Unterschied waren die vielen kleinen Verzierungen an den Wänden. Es waren vergilbte Zeichnungen aus einer früheren Zeit und trotzdem erkannte man anhand der Umrisse, was sie darstellen sollten. Es waren Bilder von Geschichten, von Märchen, die man sich erzählte. Irenas Zuhause befand sich in der Nähe des Waldes, den keine Menschenseele betrat. Unheimliche Erzählungen rankten sich darum. Dort lebte nämlich der Dieb ohne Herz mit seinen Kameraden. Der Wald war ihr Zuhause, und wer dort vorbeiwollte, der musste einen hohen Preis zahlen. Der Dieb konnte mit den Bäumen und dem Wind sprechen, auch die Dunkelheit war ein Teil von ihm, und wer es wagte, ihn zornig zu machen, der würde sich in den Tiefen des Waldes verirren und nie mehr zurückkehren. Gleich dahinter lag Malufra, die Stadt der Masken.
»Das klingt nach viel Arbeit«, sprach ich und stellte den Topf mit dem Wasser neben mir ab.
»Viel Arbeit für nichts.« Sie seufzte und erst jetzt fielen mir die dunklen Schatten unter ihren Augen auf. Ich wusste nicht, wie alt sie war. Irena wirkte immer noch jung, und wenn ich sie ansah, dann vergaß ich irgendwie immer, dass sie diejenige war, die mich aufgezogen hatte. Sie war mehr Freundin als Ersatzmutter für mich. Sie besaß keine Familie, ihre Eltern starben schon früh an einer Krankheit und ihr Bruder verließ nach seiner Verlobung mit einer angesehenen Frau das kleine Fischerdorf.
»Mein Einkommen reicht kaum für uns beide, wie will ich weiterhin die Armen unterstützen? Viele Menschen stellen Masken her und jeder bietet sie günstiger an. Die Preise gehen immer mehr zurück und irgendwann können wir diese Dinger verschenken.«
Ich schwieg, wusste nicht so recht, was ich darauf antworten sollte. Etwas nachdenklich betrachtete ich meine Hände. An der linken Hand zog sich ein tiefer Schnitt quer über die Handfläche. Er war noch frisch. Masken aus Glas herzustellen war aufwendig und schwer. Die Glasstücke hatte Irena von einem bekannten Händler aus dem Dorf. Mithilfe eines speziellen Schneidwerkzeuges konnte man die Stücke kleiner schneiden. Dabei musste man äußerst vorsichtig sein; wenn man zu kräftig drückte, dann zersprang das Glas in Tausende Teile und bohrte sich in die Handflächen. Trotz des Aufwandes liebte ich diesen einen Moment, wenn man die bunten Stücke vereinte, die fertige Maske abschliff und gegen das Licht hielt. Erst im Licht bekamen die Farben Leben und funkelten im Schein der Sonne. Magie, hatte Irena diesen Vorgang genannt. Magie war der Teil des Lebens, der einen zum Staunen brachte.
»Wo hast du schon wieder deine Gedanken?« Erneut weckte die Stimme von Irena mich. Sie ließ mich auftauchen aus meiner tiefen Gedankenwelt, in der ich mich manchmal verlor.
Lächelnd sah ich in ihre grünen Augen. »Die Idee mit den Masken, die Idee …« Ich wollte gerade weitersprechen, als Irena die Augen schloss und die linke Hand hob, um mich zum Schweigen zu bringen.
»Ich weiß, was du sagen möchtest. Fang bitte nicht wieder damit an.«
»Irena, hör mir doch zu. In Malufra ist der Bedarf nach Masken viel größer als hier, und wenn wir erst einmal Masken in Malufra selbst verkaufen würden, dann würden wir …« Abermals hob sie die Hand, um mich zu unterbrechen. Ich schwieg und blickte zu Boden. Die hellen Haarsträhnen schoben sich vor mein Blickfeld.
»Wenn ist ein Wort mit vielen Bedeutungen. Erinnerst du dich an die Geschichte des Fischerjungen, der den Mond besitzen wollte?« Irena war inzwischen aufgestanden und hatte sich das schwarze Haar mit einem Tuch zurückgebunden. Ihre Hände waren makellos. Kein Kratzer, keine Schwielen, keine Verletzungen. Nur ab und an entdeckte man bei starkem Licht kleine Narben. Narben von früher, aus einer Zeit, in der Irena noch lernen musste, dass auch Masken ihren eigenen Willen hatten.
»Die Geschichte vom jungen Fischer, der alles besaß und alles hatte?«
»Genau diese Geschichte.« Irena nickte zufrieden und klopfte sich die Hände an dem schwarzen, langen Kleid ab, das sie trug. »Holst du die bestellte Ware ab? Ich fange derweil schon mal an.« Sie wartete erst gar nicht meine Antwort ab, sondern verschwand im Inneren des Hauses.
Ich dachte noch einmal über ihre Worte und die Geschichte vom Fischer nach.
Er hatte viele Freunde, eine Familie und ein wunderschönes Mädchen an seiner Seite. Seine Taschen waren gefüllt mit Geld und dennoch wollte er immer mehr. Er wollte ein Schloss wie das des Königs, er wollte ein Pferd so schnell wie der Wind, ein Huhn, das goldene Eier legte, und eine Schar an Dienern. Irgendwann, nach unzähligen Jahren, waren all diese Dinge in seinem Besitz. Er hatte wirklich alles und doch war es noch nicht genug. Er blickte hoch in den Himmel und sah den runden Mond dort hängen. Den Mond dort oben, den wollte er auch besitzen. Die Gier spiegelte sich in seinen Augen, und seine Freunde und seine Familie hatten bald Angst um den Fischer. Doch dieser ließ sich nicht beirren und jagte fortan den Mond. Er lief dem Mond entgegen, achtete nicht auf seine Schritte und den Weg zu seinen Füßen. Er war so versunken in seinen Gedanken, so voller Gier, dass der Fischer nicht bemerkte, dass er gerade einen Fluss durchquerte. Ehe er sich’s versah, da riss die reißende Strömung an seinen Kleidern und zog ihn hinab in die Tiefe des Wassers. Ja, dort lag er nun und starb eines einsamen Todes. Manchmal war alles einfach nicht genug.
Seufzend warf ich einen Blick hinüber zu dem Wald, der nicht weit von uns entfernt lag. Dichte Bäume versperrten mir die Sicht. Die Blätter raschelten im Wind. Irgendetwas Unheimliches ging von diesem Wald aus. Schnell schüttelte ich den Kopf, um meine Gedanken zu vertreiben, und machte mich auf den Weg hinab zu dem Dorf. Ja, manchmal war alles einfach nicht genug.