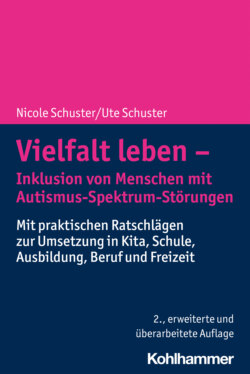Читать книгу Vielfalt leben - Inklusion von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen - Nicole Schuster - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5 Interview mit Hansjörg Elsler
ОглавлениеInterview mit Hansjörg Elsler vom »Arbeitskreis Eltern Behinderter« (AEB), der Betroffenenvereinigung in Südtirol18, und Vater eines schwer mehrfachbehinderten Sohnes
Herr Elsler, warum ist Inklusion wichtig und erstrebenswert?
Seit 1977 gibt es in Italien die gesetzlichen Vorgaben der Integration. Bis aus den Gesetzen gelebte Realität wurde, hat es gut eine Generation gedauert. Unser inklusives Bildungssystem heute ist das Ergebnis eines über 30-jährigen Prozesses. Am Anfang hatten wir gegen so manche Widerstände zu kämpfen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir nicht nur von Integration sondern endlich auch von der Inklusion sprechen können. Diese Entwicklung ist wertvoll für die Gesellschaft als Ganze und ganz besonders für die Menschen mit Behinderungen. Sie kommen früh mit nicht-behinderten Menschen zusammen und fühlen sich zugehörig. Würde man sie hingegen von Anfang an separieren, so hätten diese Menschen im späteren Berufsleben nur wenig Chancen und würden auch in der Freizeit immer außen vor stehen. So aber haben sie die Chance auf eine Anteilnahme in allen Bereichen.
Was betrachten Sie als Grundvoraussetzung für ein inklusives Bildungssystem?
Gesetze, die den Rahmen für ein inklusives Bildungssystem vorgeben, sind unverzichtbar aber längst nicht genug. Inklusion wird erst dann Realität, wenn sie von allen Beteiligten, also vor allem den Lehr- und Fachkräften sowie den Eltern, gewollt und gelebt wird. Von allen Seiten ist Offenheit gefragt. Auch das war ein langer Weg. So mussten Eltern von Kindern mit Behinderungen erst lernen, sich in die Öffentlichkeit zu wagen und für die Rechte ihrer Kinder einzutreten.
Ein Lehrer kann nicht Experte für jede Behinderungsform sein. Wie kann eine Schule trotzdem adäquat auf den einzelnen Schüler mit Behinderung eingehen?
Es ist richtig, dass die Fachlehrer in der Regel keine Experten für Sonderpädagogik sind. Das ist bei uns auch nicht vorgesehen. Die Lehrer erhalten eine Grundausbildung im Bereich Behinderungen. Wir gehen davon aus, dass die richtige und bejahende Einstellung eines Lehrers wichtiger ist als viel Fachwissen. Und diese Einstellung bringen die meisten unserer Lehrer mit. Abstriche muss man freilich bei spezieller Förderung machen. Diesbezüglich können Sonderschulen mehr bieten.
Es gibt auch Eltern behinderter Kinder, die gegen Inklusion sind, weil sie ihr Kind dort nicht genügend gefördert sehen. Sind diese Ängste berechtigt?
Wenn es um die rein sonderpädagogische Förderung geht, sind diese Ängste nachvollziehbar. Es gibt auch tatsächlich Eltern, die eine spezielle Förderung ihrer behinderten Kinder wünschen, die die Regelschule so nicht leisten kann. Diese Eltern stellen aber eine Minderheit dar. Den meisten ist es wichtiger, dass ihr Kind ganz früh mit nicht-behinderten Kindern zusammen ist und so Normalität erfahren kann.
Gibt es einen Nachteilsausgleich für behinderte Kinder?
Anstelle eines Nachteilsausgleichs schreibt bei uns der Gesetzgeber das zieldifferenzierte Lernen vor. Das bedeutet, dass Kinder einen auf sie zurechtgeschnittenen individuellen Entwicklungsplan bekommen, der ihre Behinderung und Einschränkung berücksichtigt. An der Erstellung arbeitet das Lehrerteam zusammen mit den Eltern und mit Psychologen. Regelmäßig werden die festgelegten Ziele überprüft und gegebenenfalls angepasst. So lernen die Kinder zwar zusammen, aber nicht alle das gleiche.
In Deutschland kommt beim Thema Inklusion oft die Angst auf, dass dadurch viele sehr intelligente Kinder auf der Strecke bleiben. Wie begegnen Sie solchen Bedenken?
Es ist richtig, dass sehr intelligente Kinder zu kurz kommen können. Dies scheint mir aber nicht nur ein Problem des italienischen Schulsystems zu sein. Ideal wäre natürlich ein zieldifferenziertes Lernen nicht nur für behinderte, sondern auch für hochbegabte Kinder.
Da es so eine Lösung (noch) nicht gibt, gehen wir heute offensiv mit solchen Ängsten von Eltern um und sprechen sie offen an einem runden Tisch an. Wir versuchen den Bedenken zu begegnen, indem wir betonen, was vorteilhaft an unserem System ist und wie nicht-behinderte Kinder davon profitieren können. Wir informieren über verschiedene Behinderungsformen und können dadurch Vorurteile abbauen. Im Großen und Ganzen nehmen die negativen Stimmen meiner Erfahrung nach ab. Mehr und mehr Eltern erkennen den Wert der sozialen Komponente von Inklusion an.
In wie fern können Kinder ohne Behinderung vom gemeinsamen Lernen profitieren?
Vom gemeinsamen Lernen profitieren alle Seiten. Schüler ohne Behinderungen profitieren vor allem in ihrer sozialen Entwicklung vom gemeinsamen Lernen. Sie begreifen früh, dass die Gesellschaft sehr vielfältig ist und dass auch Menschen mit Behinderungen dazugehören und als Teil der Gesellschaft anzunehmen sind. Ihre Berührungsängste nehmen ab, sie werden offener und reifen sehr oft durch das gemeinsame Lernen. Viele Kinder gehen dadurch mit anderen Augen durch die Welt. Des Weiteren kann es für sie eine sehr positive Erfahrung sein, wenn sie behinderten Kindern helfen, diesen als Vorbild dienen können und Dankbarkeit entgegengebracht bekommen. Die Kinder mit Behinderungen profitieren, indem sie sich von ihren Mitschülern mitziehen lassen, Verhaltensweisen und Fertigkeiten abgucken und übernehmen.
Welche Fachkräfte sollten zusammenarbeiten, damit Inklusion gelingen kann?
Bei uns arbeiten die Lehrerteams mit speziell ausgebildeten Mitarbeitern für Integration zusammen. Sie haben keinen pädagogischen Auftrag, sondern sind beispielsweise für den Pflegebedarf eines Schülers verantwortlich. In der Realität müssen aber oft auch diese Kräfte pädagogisch tätig werden, da infolge von Sparmaßnahmen Lehrpersonal fehlt.
1 Siehe dazu die Angabe »6–7 Betroffene von 1000 Menschen« von Autismus Deutschland e. V.: http://w3.autismus.de/pages/startseite/denkschrift/was-sind-autis tische-stoerungen/haeufigkeit.php (abgerufen am 31. August 2012).
2 Maenner MJ, Shaw KA, Baio J, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ 2020;69(No. SS-4):1–12. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6904a1.
3 Vgl. Artikel 3, Absatz c der UN-Konvention.
4 Vgl. Artikel 3, Absatz d der UN-Konvention.
5 Siehe hierzu URL: http://www.hf.uni-koeln.de/data/gbd/File/UNKonvention24.pdf.
6 Für weitere Informationen siehe Ahrbeck, Bernd: Der Umgang mit Behinderung, Stuttgart 2011 S. 28–29.
7 Goethe, Johann Wolfgang: Faust I, Vers 940.
8 Siehe dazu: Schatz, Yvette/Schelbach, Silke: Inklusion beginnt. In: Inklusion von Menschen mit Autismus, Karlsruhe 2011.
9 Im Folgenden wird zur erleichterten Lesbarkeit weitgehend nur die männliche Geschlechtsform angegeben. Gemeint sind aber ausdrücklich beide Geschlechter.
10 Siehe dazu: Frese, Christian: Rechtsansprüche von Menschen mit Autismus im Lichte der UN-Behindertenrechtskonvention, in: Inklusion von Menschen mit Autismus, Karlsruhe 2011.
11 Siehe dazu: Schabert, Martina: Die »Werkstatt für Menschen mit Autismus«. In: Inklusion von Menschen mit Autismus, Karlsruhe 2011.
12 Siehe dazu: Gödecker, Margret: Selbstbestimmtes Wohnen und Leben von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. In: Inklusion von Menschen mit Autismus, Karlsruhe 2011.
13 Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. N 014 vom 19. Februar 2021, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/02/PD21_N014_63.html#:.
14 Siehe dazu Booth, Tony/Ainscow, Mel/Kingston, Denise: Index for Inclusion: developing learning and participation in schools. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2011.
15 Siehe zum integrativen Schulsystem in Japan Gogg, Karin: Integration in Japan. In: Bürli, Alois/Strasser, Urs/Stein, Anne-Dore (Hrsg.): Integration/Inklusion aus internationaler Sicht, Bad Heilbrunn 2009.
16 Siehe dazu Benkmann, Rainer/Goll, Harald/Gundermann, Thomas/Opalinski, Saskia: Inklusion von Schülern mit Lernschwierigkeiten in den USA: Bedingungen, Forschungsbefunde und Handlungsansätze. In: Bürli, Alois/Strasser, Urs/Stein, Anne-Dore (Hrsg.): Integration/Inklusion aus internationaler Sicht, Bad Heilbrunn 2009.
17 Siehe dazu Schumann, Brigitte: Inklusive Bildung in den nordischen Ländern im Kontext gesellschaftlicher Entwicklung. In: Zeitschrift für Inklusion, Nr. 2 (2010).
18 Südtirol zählt seit 1918 politisch zu Italien, kann sich aber in vielen Bereichen autonom verwalten. Im Bildungsbereich ist Südtirol verpflichtet, die Gesetze des italienischen Staates umzusetzen. Das Gesetz zur gemeinsamen Beschulung aller Kinder und zur Auflösung der Sonderklassen wurde 1977 erlassen.