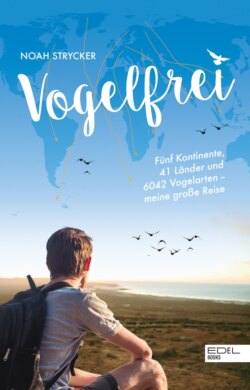Читать книгу Vogelfrei - Noah Strycker - Страница 4
1 Am Ende der Welt
ОглавлениеDer erste Vogel, den man am Neujahrstag sieht, ist ein Omen. Das behaupten jedenfalls viele abergläubische Vogelbeobachter. Der Neujahrsaberglaube ist erstaunlich treffsicher. Einmal schaute ich an einem 1. Januar nach dem Aufwachen aus dem Fenster und entdeckte draußen eine Schwarzkopfmeise, ein hübsches und freundliches Wesen, das man einfach gernhaben muss. Es war der Auftakt zu einem grandiosen Jahr. Im Jahr darauf war mein erster Vogel der Gemeine Star – ein missliebiger Eindringling aus Europa, der sich in Nordamerika breitmacht und mir nichts, dir nichts Hüttensängerküken tötet. Im Vergleich zum Jahr der Schwarzkopfmeise konnte man das Jahr des Stars so ziemlich vergessen.
Mit entsprechend mulmigen Gefühlen ließ ich am 1. Januar 2015 meinen Blick schweifen und stellte mir die bange Frage, welcher Vogel wohl diesmal die Marschroute für die folgenden 365 Tage vorgeben würde. Dass ein außergewöhnliches Jahr vor mir lag, war schon klar: Soeben hatte ich mein einziges geregeltes Arbeitsverhältnis beendet, mit meiner Freundin Schluss gemacht und meine Ersparnisse zusammengekratzt. Ich hatte meine gesamten Habseligkeiten in einen kleinen Rucksack gestopft und mich buchstäblich auf den Weg ans Ende der Welt gemacht. Punkt Mitternacht saß ich mit einer schottischen Historikerin, einer Pinguinforscherin und einer Geologin in einem warmen Whirlpool auf dem Oberdeck eines russischen Schiffes irgendwo in den eisigen Weiten der Antarktis, eine Sektflasche in jeder Hand und ein Fernglas um den Hals. Welcher Vogel würde wohl prophezeien, wo das alles hinführte?
Mit etwas Glück wäre es ein Pinguin. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, dieses Neujahrsfest so einzufädeln, dass 2015 gleich nach dem obligatorischen Countdown und dem Zuprosten zum Jahr des Pinguins erklärt werden durfte, damit – karmatechnisch gesprochen – überhaupt nichts mehr schiefgehen konnte. Eine Woche zuvor hatte ich in Los Angeles eine einsame Weihnacht auf dem Flughafenfußboden zugebracht, um von dort zum südlichsten Zipfel Argentiniens zu fliegen. Dann hatte ich dieses Schiff bestiegen und mich nach der Überfahrt durch die stürmische Drake-Passage für den entscheidenden Augenblick in Stellung gebracht, in dem das Schicksal den Startschuss zum besten Jahr meines Lebens und vielleicht sogar zum besten Jahr in der internationalen Birding-Geschichte geben würde.
Mein Plan war denkbar einfach. In den nächsten zwölf Monaten wollte ich auf meiner ultimativen Reise um die Welt 5000 Vogelarten sehen – also rund die Hälfte aller Vogelarten, die es auf dieser Erde gibt. Nach dem Auftakt in der Antarktis wollte ich vier Monate in Südamerika verbringen, dann in nördlicher Richtung Mittelamerika, die Karibik und Mexiko durchqueren, um im Mai wieder in den Vereinigten Staaten zu sein. Wenn alles glattlief, wollte ich anschließend nach Europa fliegen, einen großen Bogen durch Afrika machen, mich im Nahen Osten tummeln, im Zickzack weite Teile Asiens durchreisen und zum Schluss mit einem Insel-Hopping in Australien das nächste Neujahrsfest einläuten. In dem Zeitraum, in dem die Erde ein Mal die Sonne umrundet, würde ich ohne einen Tag Auszeit 41 Länder bereisen. Mir war klar, unter Vogelkundlern wurde über die Frage gestritten, ob es überhaupt möglich sei, in einem Kalenderjahr 5000 Arten aufzuspüren. Am Ende sollte die Reise sogar meine kühnsten Träume übertreffen. Doch hier und jetzt wusste ich vorerst nur, dass um Mitternacht die Uhr zu ticken begann.
Die flugfreudigsten Vielflieger der Welt bekommen keinen Platinstatus und auch keine Gratis-Upgrades. Sie haben nicht einmal einen Reisepass. Stunde um Stunde fliegen Millionen dieser Zuwanderer ohne Papiere über Staatsgrenzen hinweg, und niemand käme auf die Idee, sie mit Mauern an der Einreise zu hindern. Das wäre ja auch schlecht möglich. Vögel sind eben echte Weltbürger, die ganz nach Belieben kommen und gehen.
Vor einigen Jahren befassten sich zwei britische Forscher mit der Frage, wie viele Vögel auf der Erde leben. Diese weltweite Vogelvolkszählung ergab, dass zwischen 200 und 400 Milliarden gefiederte Freunde den Planeten mit uns teilen.
Das bedeutet, dass auf jeden Menschen von hier bis Timbuktu ungefähr 40 Vögel kommen. Vögel nehmen nahezu jeden Winkel unserer Erde in Beschlag, vom wilden Amazonas bis in den New Yorker Großstadtdschungel. Sie stoßen sogar dorthin vor, wo es anscheinend gar kein Leben gibt: Sowohl am Südpol als auch über dem Gipfel des Mount Everest traf man auf unerschrockene Vogelspezies. Hunderte Kilometer von der Küste entfernt gleiten sie über das offene Meer. 2015 wurden auf unserem Planeten 10.365 Vogelarten nachgewiesen. Diese Zahl vermittelt aber nur einen schwachen Eindruck von ihrer endlosen Vielfalt. Der kleinste Vogel, die kubanische Bienenelfe, findet bequem Platz auf dem Fußnagel des größten Vogels, des Afrikanischen Straußes.
Birding, also das Beobachten von Vögeln, ist in erster Linie eine Geisteshaltung und entsprechend schwer auf den Begriff zu bringen. Nach den Worten von Roger Tory Peterson, der allgemein als Vater der modernen Vogelbeobachtung gilt, haben Vögel für jeden Menschen eine andere Bedeutung. Mal sind sie eine Wissenschaft, mal eine Kunst und mal ein Sport. Es ist schwer, Birding in eine Schublade zu stecken, obwohl das schon viele versucht haben. Birding ist Jagen, Sammeln und Glücksspiel in einem. Niemand weiß genau zu sagen, ob es mehr eine Sucht, ein Freiheitsdrang oder einfach nur ein Spiel ist, mit dem sich Öko-Nerds die Zeit vertreiben.
Mein Interesse für die Vogelwelt erwachte im zarten Alter von zehn Jahren. Ich ging in die fünfte Klasse. Eines Tages brachte meine Lehrerin ein durchsichtiges Plastikvogelhäuschen mit und befestigte es mit Saugnäpfen am Klassenzimmerfenster. Als ich zwölf war, half mir mein Vater beim Bau eines Nistkastens für Blaukehl-Hüttensänger und nahm mich mit zu einem Birdwatching-Festival in Oregon. Schon bald schleppte ich halbverweste Hirschkadaver mit nach Hause, um Truthahngeier anzulocken, damit ich sie fotografieren konnte. Später schob ich den Collegebesuch auf, um in Panama Vogelnester zu untersuchen. Wenn mich jemand fragte, stellte ich mich als „Bird Man“ vor.
Von Anfang an gab mir die Beschäftigung mit Vögeln das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Wenn ich den Himmel beobachtete, begann ich die Welt mit anderen Augen zu sehen, ich ließ mich von meiner Neugier an Orte führen, die ich noch nicht kannte. Mit Mitte 20 verbrachte ich mehr als anderthalb Jahre im Zelt an allerlei entlegenen Enden der Welt. Zwischendurch war ich mit vogelkundlichen Forschungsprojekten und Expeditionen beschäftigt und gestand mir irgendwann ein, dass es auf dem eingeschlagenen Weg wohl kein Zurück mehr gab. Außerdem schwante mir allmählich, dass meine verbleibende Zeit auf Erden selbst dann nicht ausreichen würde, wenn ich mein ganzes restliches Leben so weitermachte – es gibt einfach zu viele Vögel und zu wenig Zeit.
Das Gefühl, dass die Zeit drängt, scheint allgegenwärtig. Psychologen nennen es „FOMO“ (Fear Of Missing Out) – die Angst, etwas zu verpassen. Naturschützer nennen es „Habitatverlust“ und Hollywood-Regisseure „Apokalypse“. Wenn wir unseren Kontakt mit der freien Natur betrachten, leben wir in einer spannenden Ära. Vor 100 Jahren beobachtete man Vögel, weil man hoffte, neue Spezies zu entdecken. Dieses goldene Zeitalter der ornithologischen Entdeckungen ist weitgehend vorbei. Von praktisch allen Vögeln gibt es inzwischen ausführliche wissenschaftliche Beschreibungen und ausgestopfte Musterexemplare in den Museen. Diejenigen, die sich heute für Birding interessieren, haben genau entgegengesetzte Beweggründe: Sie wollen in Zeiten, in denen weite Teile der Bevölkerung sich kaum mehr ins Freie wagen, die Natur wiederentdecken und feiern. Schmerzlicherweise ist ausgerechnet heute, wo rekordverdächtig viele Menschen ihnen Beachtung schenken, die Zukunft der Vögel ungewisser denn je. In einem nie dagewesenen Tempo wird unser Planet abgeholzt, planiert, umgepflügt, angebohrt, zugepflastert und erschlossen. Was das für Vögel, Menschen und den Rest der Natur bedeutet, ist heute noch gar nicht absehbar.
Das kann einen schon leicht entmutigen. Aber Birder sind eine ausgesprochen optimistische und handlungsorientierte Sorte Mensch. Sie wissen: Wenn du den ganzen Tag die Wände anstarrst, wirst du nicht viel zu sehen bekommen. Außerdem ist ihnen bewusst, dass sich manche Erfahrungen nicht digital nachbilden lassen. Eine echte Scharlachtangare zu beobachten, ist eine besondere Freude und etwas ganz anderes als der Blick auf einen roten Vogel auf dem Smartphone-Display, auch wenn das Foto noch so gut ist. Vögel sind die freiesten Geschöpfe der Welt, sie verbinden die entlegensten Winkel unserer Erde miteinander. Vögel lehren uns, dass Grenzen nur Linien sind, die irgendjemand in eine Landkarte eingezeichnet hat.
Kurz vor meinem 30. Geburtstag fasste ich einen kühnen Plan: Ich wollte den Planeten bereisen, die passioniertesten Birder der Welt kennenlernen, vielleicht einen nicht ganz ernst gemeinten Rekord aufstellen und eine einzigartige Momentaufnahme von der Erde machen – alles auf einen Schlag. Ich machte mich auf den Weg, um Vogel für Vogel die Welt zu erkunden.
Rund 100 Passagiere und 40 Besatzungsmitglieder hatten sich zu dieser Antarktis-Expedition eingefunden, für die mit dem Slogan „Neujahr bei den Kaisern und Königen“ geworben wurde – eine Anspielung auf die beiden größten Pinguinarten der Welt, den Kaiser- und den Königspinguin. Wenn du dich anschickst, eine Weltreise zu machen, kannst du ruhig am Ende der Welt anfangen, dachte ich mir, und die Antarktis schien mir der ideale Auftakt für meinen Einjahrestrip.
Als offizieller Bordornithologe für den kanadischen Schiffsreiseanbieter One Ocean Expeditions hatte ich die Aufgabe, die Passagiere auf Pinguine und sonstige Fauna hinzuweisen, bis das Schiff eine Woche nach Neujahr nach Argentinien zurückkehren würde. Unser Schiff hieß Akademik Ioffe und war in sowjetischen Zeiten offenbar für ozeanografische Forschungen gebaut worden. Gerüchteweise hieß es allerdings, im Kalten Krieg habe die Sowjetunion damit amerikanische U-Boote ausgespäht. Die Reisegesellschaft bestand aus Ärzten, Rechtsanwältinnen, Geschäftsleuten, Technikfreaks und diversen gut betuchten Globetrottern aus Südafrika, Australien, den USA und allerlei Ländern in Europa. Für etwa jeden Dritten bestand der Sinn und Zweck der Reise darin, auf der persönlichen To-do-Liste den siebten Kontinent abzuhaken. Das Betreuerteam setzte sich aus jüngeren Leuten zusammen, die Freigeister waren wie ich und meist sehr gut bewandert auf ihrem Gebiet. Sie konnten gut und gerne längere Zeit an entlegenen Orten der Erde zubringen. Für mich war die Reise die 19. Polarexpedition in drei Jahren, und sie würde für eine Weile meine letzte sein.
Als es gegen Mitternacht ging, wehten aus der zwei Decks tiefer liegenden Schiffsbar einzelne Fetzen des Volksliedes „Auld Lang Syne“ zu uns nach oben, das im englischsprachigen Raum zum Jahreswechsel gesungen wird. Wir saßen indessen zu viert in dem Whirlpool und ließen uns einweichen. Die Geologin Casey, Master-Studentin an der New Yorker Stony Brook University, schüttelte eine Champagnerflasche und ließ den Korken wie eine Startschusspistole knallen. Der Flascheninhalt verteilte sich als eiskalter Schaum auf alle Anwesenden.
„Happy New Year”, schrien wir.
Ein paar Passagiere kletterten aus der Bar an Deck und machten Handy-Videos von uns. Wer – ich meine: welcher normale Mensch? – begrüßt das neue Jahr schon in einem Whirlpool in der Antarktis und lässt sich mit Schaumwein besprühen? Sorgsam schirmte ich mein Fernglas gegen die Champagnerdusche ab. Das Fernglas ließ sich kaum scharfstellen, ich hatte das Gefühl, die ganze Welt sei ins Wanken geraten. Vielleicht lag es an den Schiffsbewegungen oder am Champagner oder am allgemeinen Durcheinander oder an der Aussicht auf die viele Tausend Kilometer lange Reise ins Unbekannte, die mir bevorstand … Im Moment gab es jedenfalls keine Vögel zu sehen. Nicht einen einzigen. Dabei wollte ich jetzt doch unbedingt einen Pinguin erspähen.
Die schottische Historikerin, eine rothaarige Doktorandin namens Katie, schaute mich neugierig an. „Und? Siehst du irgendwas?”
Aus dem Whirlpool, den man strategisch günstig auf dem Oberdeck platziert hatte, bot sich uns in der Mitternachtssonne ein unvergleichlicher Ausblick. So weit das Auge reichte, war der Ozean gesprenkelt mit Tausenden eigentümlich geformten Eisbergen, die in allen möglichen Nuancen von Kobalt- über Saphir- bis Stahlblau glitzerten, während am Horizont ein schmaler Streifen leuchtend weißer Gletscherabbrüche das antarktische Festland markierte. Einer meiner Freunde, ein Künstler, verriet mir einmal eine Idee, zu der ihn ein ähnlicher Anblick inspiriert hatte: Man könnte doch, so überlegte er, ein paar Eisberge wie Skulpturen bearbeiten und damit die Passagiere vorbeifahrender Schiffe schocken. Stell dir vor, du fährst im Südpolarmeer mit dem Schiff an einem haushohen Micky-Maus-Eisblock vorbei. Aber der Freund musste zugeben, dass die menschliche Kreativität mit den gewaltigen Kräften der Natur nicht mitzuhalten imstande ist, zumal hier unten am Südpol. Ein Eisberg, der so lang ist wie ein Fußballfeld, wiegt eine Million Tonnen und damit in etwa genauso viel wie der gesamte Weizen, den Äthiopien in einem Jahr importiert. In den eisigen Wassern des Südpolarmeers habe ich sogar schon Eisberge gesehen, die mehrere Kilometer breit waren. Vor Jahren brach vom Ross-Schelfeis südlich von Neuseeland ein Brocken ab, der größer war als die gesamte Landfläche Jamaikas. Lange trieb der Brocken durchs Meer und brachte den Pinguin- und Schiffsverkehr durcheinander. In diesem Teil der Welt dürfte das Eis jahrzehntausendealt sein, und die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs macht ja wirklich nur ungefähr ein Zehntel seiner Größe aus. Eisbergbeobachtung ist wie Vogelbeobachtung: Je mehr man darüber nachdenkt, umso unbedeutender kommt man sich vor, und erst allmählich realisiert man, wie viel unter der Oberfläche schlummert.
Die tief stehende Sonne tauchte die ganze Szenerie in ein gespenstisches Licht. In der Ferne konnte ich die Trinity-Insel erkennen, eine 24 Kilometer lange Fels- und Eisformation. Ich wusste, dass sich Esels- und Zügelpinguine (Letztere nennt man auch Kehlstreifpinguine) diese Insel als gut geschützten Nistplatz ausgesucht haben, aber aus der Entfernung konnte man die Tiere nicht erkennen. So nah an einer Brutkolonie machte ich mir aber doch Hoffnungen, den einen oder anderen streunenden Pinguin vorbeischwimmen zu sehen. Diese Tiere können ohne Weiteres Hunderte von Kilometern schwimmen und machen gerne auf Eisbergen Rast.
Aber nein … es war kein einziger Pinguin in Sicht. Obendrein wurde das Wasser in unserem Minipool allmählich kalt. Die Antarktis ist wirklich nicht der ideale Ort für Whirlpools im Freien, und unsere Wanne war den frostigen Temperaturen nicht auf Dauer gewachsen. Wenn wir uns nicht bald in die Sauna retteten, würden wir alle vier zu Eiszapfen erstarren.
„Zähle ich mit meiner Gänsehaut auch als Vogel?“, fragte Nicole, die junge Pinguinforscherin, bekam aber keine Antwort.
Wenn im Südsommer die Sonne rund um die Uhr strahlt und das Phytoplankton kräftig gedeihen lässt, ist das Südpolarmeer vielleicht der produktivste Lebensraum der Erde. Trotzdem zeigte sich nirgendwo ein Anzeichen von Leben, weder ein Walblas (so heißt die Atemfontäne des Wals) noch eine Robbe. Und so etwas nannte sich Pinguin-Land. Wo war denn der Pinguin, wenn man wirklich – ich meine: wirklich – einen brauchte?
Irgendjemand sagte: „Du bist der weltschlechteste Birder überhaupt! Wie willst du denn auf 5000 Vögel kommen, wenn du noch nicht mal Nummer eins auftreiben kannst?“
Casey stieg aus dem Whirlpool, Katie folgte ihr. Wasser schwappte über den Beckenrand und gefror auf dem Metallboden des Freidecks. Nicole verließ mich kurz danach ebenfalls. Ich blieb übrig, der selbst ernannte „Bird Man“, kurz vor ein Uhr morgens allein in einem halb gefüllten, halb gefrorenen Whirlpool in der Antarktis, und kein Pinguin war in Sicht.
Was tun? Vögel sind launische Geschöpfe. Ich griff mir ein Handtuch, folgte den anderen ins Warme und begrub meinen akribisch ausgetüftelten Plan, den ersten Vogel des Jahres von einem warmen Pool aus am Ende der Welt zu sichten. In den engen Fluren verkrümelten sich die Passagiere in ihre Kabinen. In der gedimmten Beleuchtung patrouillierte ein russischer Offizier in Uniform nüchtern auf der Brücke, während der kanadische Barkeeper den Wischlappen schwang. Nach einem langen und bewegten Abend kehrte Ruhe ein. Direkt im Anschluss an das Frühstück würde uns ein Abenteuer erwarten, ein Ausflug zu einer großen Pinguinkolonie. Dort bekam ich mit Sicherheit Tausende der befrackten Vögel zu Gesicht.
Zum Schlafengehen war ich noch zu aufgedreht. Nachdem die meisten Mitreisenden sich in ihre Kojen gerollt hatten, zog ich mir zwei lange Unterhosen übereinander an, dazu Wollsocken, eine Skihose, einen Fleece-Pullover, eine wasserfeste Daunenjacke, einen Fleece-Nackenwärmer, wasserdichte, isolierte Handschuhe, eine Wollmütze, wasserdichte Stiefel mit Fleece-Futter, griff mir mein Fernglas und begab mich nach draußen. Diesmal postierte ich mich aber nicht auf dem Oberdeck, obwohl es einen weiten Ausblick bot, sondern ging ganz nach hinten zum Achterdeck, von wo ich in das schäumende Kielwasser hinunterschauen konnte. Ich zwängte mich zwischen Ankerwinde, Bordkran, Taurollen und den festgezurrten, aufblasbaren Beibooten hindurch und lehnte mich an die Reling. Vor dem Wind schützte mich ein Metallcontainer, in dem der ganze Expeditionsmüll gesammelt wurde.
Hier war mein Lieblingsplatz auf dem Schiff. Auf einem 117 Meter langen Schiff mit 140 Leuten ist persönlicher Freiraum ein knappes Gut. Deshalb zog ich mich, wenn ich einen Augenblick lang für mich sein wollte, immer hierher zurück. Hinter dem Abfallcontainer traf man nie jemanden. Außerdem fliegen etliche Meeresvögel gern hinter Schiffen her. Häufig schon sah ich Vögel über dem Kielwasser hin- und herjagen. Manchmal kamen sie dabei dem Achterdeck zum Greifen nah. Jetzt war zwar gerade kein Vogel zu sehen, aber immerhin war das hier ein netter Aussichtspunkt.
Ob ich wirklich ein ganzes Jahr durchhalten konnte, auf Vogelsuche durch die Welt zu reisen? Ich war mir nicht sicher. Von heute bis Ende Dezember wollte ich nichts anderes tun. Dafür würde ich manches Weltwunder – von Machu Picchu in Peru bis zum Taj Mahal in Indien – links liegen lassen müssen, nur damit ich mich möglichst viele Stunden an die Vogelwelt heranpirschen konnte. War das nicht irgendwie ein bisschen sehr verschroben? Meine Freunde ziehen mich gerne damit auf, dass ich permanent Vögeln nachstelle, und ich gebe zu: Die Idee, sich eine Auszeit zu nehmen, hat etwas Befremdliches. Ganze 365 Tage lang vor dem Morgengrauen aufstehen, sich unter wildfremden Menschen bewegen und eine Reisestrapaze nach der anderen auf sich nehmen, das würde schon ein echter Belastungstest werden, etwa so, wie wenn ein Drogenabhängiger ein Jahr lang nur kokst. Entweder wird es ein Totalabsturz oder ein grandioser Höhenflug.
Es gab nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich das durchstehe. Hochmotiviert war ich jedenfalls.
Meine Armbanduhr zeigte drei Uhr morgens. Plötzlich bewegte sich zwischen den Eisbergen etwas, keine 100 Meter entfernt. In dem schwachen Licht war es kaum auszumachen. Es sah aus wie ein dunkler Fleck, der im weiten Zickzack über die Wasserfläche glitt und dem Schiff allmählich näher kam.
Noch bevor ich durch das Fernglas guckte, wusste ich, was sich da näherte. Dieser Vogel flog mit unbewegten Flügeln und ließ sich trickreich von den Windströmungen tragen, die von den Wellen abgelenkt wurden; ab und zu machte er ein paar Flügelschläge, um die Richtung zu ändern, aber die meiste Zeit ließ er sich einfach durch die Luft gleiten. Er war so lang wie ein American Football und genauso prall. Sein mattschwarzer Kopf kontrastierte mit dem Blütenweiß an Bauch und Flügelunterseiten, sein Schwanz war dunkel. Das Auffälligste an diesem Vogel wurde für mich erst sichtbar, als er eine Kurve in meine Richtung flog und auf meine Augenhöhe herabstieß: die schwarz-weiß gescheckten Oberflügeldecken, die aussahen wie ein gestochen scharfes Bild im Stil des abstrakten Expressionismus.
Viele nennen diesen Vogel wegen seines klecksigen Aussehens „Pintado“, was so viel heißt wie „bemalt“. Mit richtigem Namen hieß das Tier, das ich gesichtet hatte, Kapsturmvogel – ein im Südpolarmeer recht weitverbreiteter Vogel, der auf abgeschiedenen Felsklippen nistet. Obgleich die Kapsturmvögel gelegentlich Magenöl aus ihrem Schnabel ausstoßen, wenn sie schlechte Laune haben, erwecken sie bei den meisten Menschen, die das Glück haben, ihnen zu begegnen, Bewunderung und Sympathie. Dieser zähe, eher kleine Meeresvogel, der um drei Uhr morgens versuchte, mit dem Schiffstempo mitzuhalten, war zwar kein Pinguin, aber er passte trotzdem perfekt. Der englische Name dieses graziösen Sturmvogels – „Petrel“ – wird mit dem heiligen Petrus in Verbindung gebracht, weil der übers Wasser wandeln konnte. Unter diesem ganz besonderen Segen legte das „Year of the Petrel“ einen verheißungsvollen Start hin.