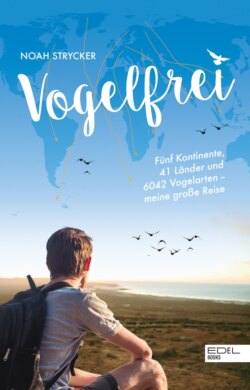Читать книгу Vogelfrei - Noah Strycker - Страница 8
5 Die Harpyie
ОглавлениеEnde Januar begannen die Tage immer schneller zu vergehen. Sie verschwammen förmlich ineinander. Nachdem ich mich in Jujuy von Freddy und seinen amigos verabschiedet hatte, wollte ich im Eiltempo den Nordosten Argentiniens abklappern und dann drei Wochen lang die vogelreichsten Gegenden Brasiliens durchstreifen, immer Seite an Seite mit lokalen Kontaktpersonen.
In Argentinien leistete mir der wild entschlossene Birder Guy Cox Gesellschaft. Wir erkundeten in seinem frisch gekauften Chevy-Wohnmobil (Baujahr 1974) die Provinz Misiones. Wegen einer kaputten Antriebswelle, die erst einmal repariert werden musste, verzögerte sich unser Treffen. Somit hatte ich Gelegenheit, einen Abstecher einzulegen, und zwar zu den spektakulären, 2700 Meter breiten Iguazú-Wasserfällen und zu einer dort lebenden Art, den Rußseglern, die am Fels hinter dem herabstürzenden Wasser nisten. Im Anschluss zockelten Guy und ich über rote Schotterpisten ins nahe Waldschutzgebiet San Sebastián de la Selva, ein wenig bekanntes Juwel. Wir fanden uns alsbald von tropischen Vögeln umringt: Ameisenwürger, Ameisenranken, Ameisenfänger, Ameisendrosseln, Ameisenhirne, Ameisenpittas und Ameisentangare.
Endlich war ich in den Tropen, mit allem, was dazugehörte: erbarmungslose Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit, stinkender Morast, farbenprächtige Aras, Lianen und Farnwedel aller Art, Springaffen … und Ameisen. Die nordöstlichste Ecke Argentiniens bildet die westliche Grenze eines feuchten und stickigen Dschungels, der Atlantischer Regenwald heißt und sich als schmales Band 4000 Kilometer an der Küste entlang bis in den Osten Brasiliens zieht. Nach Norden hin ist der Wald durch trockene Savannen vom Regenwald des Amazonasbeckens getrennt und hat deshalb eine reiche endemische Flora und Fauna zu bieten. Mehr als 150 Vogelarten, die im Atlantischen Regenwald leben, gibt es nur hier und nirgendwo sonst. Leider ist der Regenwald auch einer der am stärksten bedrohten Lebensräume der Welt. Der brasilianische Teil wurde nahezu komplett abgeholzt. Auf der argentinischen Seite wurde ein System von Reservaten eingerichtet, um den Wald zu schützen. Während früher nur vier Prozent des Atlantischen Regenwalds außerhalb von Brasilien lagen, liegt heute rund die Hälfte dessen, was noch übrig ist, in Argentinien.
Guy und ich pirschten durch den Dschungel und spähten und lauschten nach den hiesigen Spezialitäten. Dank Guys Ortskenntnis und seines unglaublich feinen Gehörs wurden wir oft fündig. Am 22. Januar sahen wir unter anderem einen blau-schwarz-grün-rot schillernden Surucuatrogon, der meinen ersten wichtigen Meilenstein setzte: Er war der 500. Vogel des Jahres. Jetzt fehlten mir nur noch 4500.
Ich nahm Abschied von Guy, fuhr im Taxi über die brasilianische Grenze und flog weiter nach Sāo Paulo. Brasilien war strategisch eine ganz wichtige Reisestation, aber wegen eines Visastreits zwischen Brasilien und den USA war es für mich als Bürger der Vereinigten Staaten ein echtes Unterfangen, ins Land einzureisen. Für die meisten Länder bekam ich ein Visum online oder bei der Einreise. Wer als US-Bürger nach Brasilien einreisen will, muss sich hingegen im Voraus bei einem brasilianischen Konsulat ein Touristenvisum besorgen und dafür zu einem bestimmten Termin persönlich erscheinen, mit ausgefülltem Antragsformular, extra Foto, gültigem Pass, Kopie des Rückflugtickets und US-Postanweisung über den fälligen Betrag (Bargeld oder Schecks unerwünscht). Damit revanchierte sich die brasilianische Regierung für die 2001 von der US-Regierung beschlossene Verschärfung der Visaanforderungen für Brasilien und andere Länder. Von den vielen Visa, die ich mir für das Big Year besorgen musste, war das Visum für Brasilien mit Abstand am kompliziertesten zu bekommen und obendrein am teuersten. Schlussendlich kaufte ich mir einen zweiten Pass und bemühte die Spezialisten von VisaHQ, mir aus dem Chaos herauszuhelfen. Im Laufe des Jahres blätterte ich, nebenbei bemerkt, über 2000 Dollar nur für Einreisegenehmigungen hin.
In Brasilien tat ich mich für ein paar Birding-Tage mit Guto Carvalho zusammen. Der Birder und Filmproduzent hatte vor einigen Jahren seine Produktionsfirma verkauft, um sich besonderen Projekten und dem Vogelschutz zu widmen. Früher war er nach Hollywood und New York gependelt, hatte Special Effects für Filme und Werbespots entwickelt. Heute reist er durch Südamerika, hält Vorträge über Vögel, veranstaltet die alljährliche brasilianische Vogelmesse und weitere regionale Messen und veröffentlicht in seinem kleinen Verlag Natur- und Fotobücher. Vor Kurzem hatte er eine TV-Zeichentrickserie zum Thema Nachhaltigkeit abgeschlossen, und in wenigen Wochen wollte er in den Norden Brasiliens aufbrechen, um dort an einem Buch über die Vogelwelt im Amazonasgebiet zu arbeiten. Der harte Kern engagierter brasilianischer Birdwatcher und Naturschützer, zu dem auch Guto gehört, ist einer der Gründe, warum die Birding-Kultur in Brasilien so rasant wächst.
„Vor zehn Jahren gab es in Brasilien fast keine Birder“, erzählte er mir, als wir kurz vor Mitternacht die Lichter São Paolos hinter uns ließen, „aber heute gibt es viele im ganzen Land.“ Guto und ich steuerten den Parque Estadual Intervales an, eines der letzten verbliebenen Gebiete des Atlantischen Regenwalds. Dort sahen wir mit tatkräftiger Unterstützung des Parkführers Luis Avelino, der die Vogelnamen auf Latein ausrief, über 120 Arten. Ein echter Ausnahmetag. Hinterher beim Abendessen kam mir zu Bewusstsein, dass hier ein denkbar heterogenes Trio zusammensaß: ein brasilianischer Filmproduzent (Guto), ein Parkführer (Luis) und ein 28-jähriger Vogelnarr aus Oregon (ich). Normalerweise wären wir uns niemals über den Weg gelaufen. Außerdem sprach Luis nur Portugiesisch. Und doch fanden wir über unser gemeinsames Interesse an Vögeln sofort einen Draht zueinander.
Guto übergab mich an René Santos, einen 34-jährigen Birder, der ebenfalls in São Paolo lebte und sich einen Spix-Ara auf die linke Schulter hatte tätowieren lassen. Auf den Reservereifen seines 17 Jahre alten Jeeps hatte er auf Portugiesisch den Spruch „Aussterben ist für immer“ geschrieben. Der hochgewachsene und athletische René, der gern surft und die brasilianische Kampfkunst Capoeira beherrscht, fuhr mit mir die Küste hoch zur Insel Ilhabela, was so viel wie „schöne Insel“ heißt. Dort durften wir im Haus eines Freundes wohnen und spazierten zum Abschluss der Etappe auf der Suche nach endemischen Vogelarten stundenlang durch schwüle Tieflandwälder. Der Anblick eines gefährdeten Fleckenbrustwürgerlings war fast so genussvoll wie das Açai-Eis mit Bananenscheiben und Honig, das wir danach feierlich verspeisten.
René setzte mich am Flughafen von São Paulo ab und wünschte mir alles Gute. Ich flog nordwärts und freute mich auf den Kulissenwechsel. Während des zehntägigen Trips durch die verschiedenen Gebiete des Atlantischen Regenwalds mit Guy, Guto und René hatte ich an zehn verschiedenen Orten geschlafen. Nachdem ich mich anderthalb Wochen durch den feuchten Dschungel gekämpft hatte, waren meine paar Anziehsachen vollgeschwitzt und mussten dringend in die Waschmaschine. Ich hatte noch nicht einmal die Energie aufgebracht, sie in der Dusche abzubrausen. Die vielen schnellen Ortswechsel, später Aufbruch, nächtliche Ankunft, Aufstehen im Dunkeln, Vogelpirsch in aller Herrgottsfrühe – das war enorm anstrengend und Schlafen wichtiger als saubere Wäsche. Trocken geworden wären die Sachen ohnehin nicht.
Die Reiseetappen legte ich meist auf den Nachmittag oder Abend, damit ich die kostbaren Morgenstunden zum Vogelbeobachten nutzen konnte. Ich hatte keine Ahnung, ob ich dieses Pensum auf Dauer durchhalten würde. Zum Schlafmangel kam hinzu, dass ich keine Zeit mehr für mich hatte. Immer wenn ich an einem neuen Ort ankam, traf ich dort auf einen startbereiten einheimischen Birder. Es kam mir vor wie der ständige Pferdewechsel beim Ponyexpress früherer Zeiten. Elf Monate hatte ich noch vor mir. Sollte ich meine Kräfte besser einteilen? Der große Vorteil beim Nonstop-Reisen ist, dass du dich immer wieder auf neue Eindrücke, Menschen und Vögel freuen kannst und jeder Wechsel dich aufs Neue beflügelt. Trotz einer gewissen Ermattung, die ich in den Tropen gespürt hatte, war ich doch froh, eine durchgehende Reise geplant zu haben. Ich genoss das hohe Tempo und wollte auch nicht, dass es nachließ. Man findet sich in eine Routine und vertraut zunehmend auf die Energie, die freigesetzt wird, sobald man Neuland betritt. Pausen würden den Flow unterbrechen, die Achterbahn stoppen. Lieber weiter so.
Nach fast einem Monat auf Achse lief auch alles fantastisch. Nichts von dem, was ich theoretisch befürchtet hatte, war eingetreten. Ich war nicht krank geworden. Es hatte keine Logistikkatastrophen gegeben. Keine Kontaktperson hatte mich versetzt. Und meine Vogelliste wuchs schneller, als ich zu hoffen gewagt hatte. Trotz des schleppenden Starts in der Antarktis hatte ich am 29. Januar 617 Vogelarten beisammen und lag damit deutlich über dem Tagesdurchschnitt, den ich brauchte, um bis Jahresende auf 5000 Arten zu kommen. Das Jahr war noch jung, ich spürte, wie das Big Year eine Eigendynamik entwickelte. Die Sonne schien die Welt in ein neues Licht zu tauchen, und nichts konnte mein Glück trüben. Schon möglich, dass es nicht von Dauer sein würde, aber bis hierhin war alles gut. Sehr gut sogar.
Bei meiner Landung im zentralbrasilianischen Cuiaba erreichten mich ganz unerwartet sehr aufregende Neuigkeiten.
Im weitläufigen Bundesstaat Mato Grosso, im tiefsten Zentralbrasilien unweit der Grenze zu Bolivien, gibt es ein wenig bekanntes Mittelgebirge namens Serra das Araras. Diese Gegend zwängt sich zwischen mächtige Nachbarn. Nördlich erstreckt sich das Amazonasgebiet mit dem größten Regenwald der Welt bis nach Guyana und in den Osten Ecuadors. Im Süden und Osten grenzt die Serra das Araras an den Cerrado, ein Binnenlandplateau, etwa so groß wie Grönland, mit tropischen Savannen und unendlichen Weiten, wie man sie auch in Ostafrika findet. Und westlich schließt sich das berühmte Pantanal an, ein saisonales Feuchtgebiet von der Größe Spaniens. Der Oberlauf des Río Paraguay fließt von der Serra das Araras herab und durchquert auf weit mehr als 2500 Kilometern die Niederungen des Pantanal bis nach Argentinien, mündet in den Paraná und plätschert dann gemächlich noch weitere 1280 Kilometer bis in den Atlantik nördlich von Buenos Aires.
Das westliche Zentralbrasilien ist weit ab vom Schuss. Die zwischen Amazonas, Cerrado und Pantanal eingezwängte Serra das Araras lassen die meisten ausländischen Reisenden links liegen. Ihre Steilwände sind kein spektakulärer Touristenmagnet, obwohl man hier in einer kleinen brasilianischen pousada, einer Art Privatpension, mit Spa und gemütlichen Zimmern eine angenehme Zeit neben weidendem Vieh und einer Kalksteinmine verbringen kann. Es ist brütend heiß und stickig, und die Fernstraße, die von der nächstgelegenen großen Stadt Cuiaba hierherführt, hat wegen des Schwerlastverkehrs so tiefe Spurrillen wie ein Trampelpfad von Pferdekarren.
Über diese Straße holperte ich in der Abenddämmerung mit dem jungen Vogelführer Giuliano Bernardon und seiner Schwester Bianca, die zu Besuch war und sonst als Biologin in der nordbrasilianischen Provinz Amazonas arbeitete. Die beiden hatten mich nachmittags nach meiner Landung in Cuiaba abgeholt. Kaum hatten wir die Stadtgrenze hinter uns, verlief die Straße so schnurgerade, wie nur ein Papagei fliegen kann. Die Landschaft war platt, platt und nochmals platt. Wir sahen Lkw, Lkw und nochmals Lkw. Alle paar Kilometer kamen wir an einem Reifenservice vorbei, angesichts der vielen Schlaglöcher im Asphalt offenbar ein lukratives Geschäft. Nach Sonnenuntergang fühlten wir uns wie in einem holprigen Tunnel: Die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge blendeten, dazwischen versanken wir in tiefem Schwarz. Ich war erleichtert, als Giuliano in dem kleinen Städtchen Jangada hielt, um etwas zu Abend zu essen und ein paar Stunden zu schlafen. Ursprünglich hatten wir vorgehabt, direkt das Pantanal anzusteuern, aber als Giuliano mich am Flughafen abholte, hatte er sensationelle Nachrichten.
„In der Serra das Araras gibt es ein bewohntes Harpyien-Nest!“, platzte er heraus, als wir über den Parkplatz zum Wagen gingen. „Das liegt zwar nicht unbedingt auf dem Weg, ist eher ein Abstecher, aber wir könnten morgen ganz früh dort sein.“
Giuliano setzte sein breites Lächeln auf. Er berichtete, nach Aussage mehrerer Vogelbeobachter habe wenige Tage zuvor ein Weibchen in dem Nest gehockt. Wir hätten also gute Chancen, den schwer aufzuspürenden Greifvogel zu Gesicht zu bekommen. Auch wenn es für meine Big-Year-Liste nur eine von vielen Vogelarten sei, lohne es sich auf jeden Fall, einen Vormittag für die einmalige Gelegenheit zu investieren, den mächtigsten Raubvogel der westlichen Hemisphäre zu sehen.
Mit einer Flügelspannweite von bis zu zwei Metern und einem Gewicht von bis zu neun Kilogramm sieht die bis zu 90 Zentimeter große Harpyie aus wie ein Sherman-Panzer mit Düsenjägertragflächen. Frühe südamerikanische Forschungsreisende benannten den Vogel nach dem Mischwesen aus der griechischen Mythologie. Harpyien gelten darin als heißhungrige Bestien mit Vogelkörper und Frauengesicht, die Zeus ausschickt, um missliebige Menschen vom Erdboden verschwinden zu lassen. Der Vergleich ist absolut treffend. Harpyien machen am liebsten Jagd auf Affen und Faultiere, die sie ohne viel Federlesens von den Baumwipfeln pflücken. Sie können auch Spießhirsche und andere größere Regenwaldbewohner erbeuten, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Zu diesem Zweck entwickelten sie im Laufe der Evolution gewaltige Krallen, länger als die eines Grizzlybären, und Beine, so dick wie ein Kinderhandgelenk. Wie bei den meisten Adlerarten sind Harpyien-Weibchen fast doppelt so groß wie Männchen.
Mit aufgestelltem Federschopf und dem schwarzen und weißen Gefieder sind diese Wesen ein überwältigender Anblick. Mühelos fegen die Kraftpakete mit 80 Stundenkilometer durch das dichte Baumkronendach und packen blitzschnell ihre Beute. Affen haben inzwischen das Loslassen gelernt. Sobald sie eine Harpyie im Anflug sehen, lassen sie sich ungeachtet der Risiken lieber wie ein Stein auf den Waldboden fallen, als dass der Raubvogel sie auf Baumkronenhöhe erwischt. Aber meist ist es schon zu spät. Harpyien sind Überraschungsangreifer und Tarnungsspezialisten, die für den Nahkampf im Dschungel bestens gerüstet sind. Sie sind die vollendeten Raubvögel.
Weil sie zum Leben und Brüten große und intakte Waldgebiete brauchen, sind Harpyien ziemlich selten. Ein Paar benötigt in der Regel ein Dutzend Quadratkilometer unberührten Regenwald, und die sind heutzutage nicht leicht zu finden. Die meisten angestammten Lebensräume der Harpyien vom Süden Mexikos bis in den Norden Argentiniens sind bedroht. In nennenswerter Zahl kommen Harpyien inzwischen nur noch in den ursprünglichsten Bereichen des Amazonasbeckens einschließlich Nordbrasiliens vor.
Doch selbst in den unberührtesten und entlegensten Wäldern ist es verteufelt schwer, eine Harpyie zu sichten. Sie gleiten lautlos durch das Blätterdach und fliegen nicht über den Wipfeln. Um dennoch eine Harpyie zu sehen, braucht es deshalb entweder extrem großes Glück oder man muss ihr unbemerkt am Nest auflauern.
Während wir an einem Straßenimbiss zwischen ausgehungerten Truckern getoastete Sandwiches verspeisten, erklärte Giuliano, das Harpyien-Nest in der Serra das Araras werde seit ungefähr 20 Jahren, also seit Mitte der 1990er Jahre, benutzt. Schon viele Vogelbeobachter hätten dort die erste frei lebende Harpyie ihres Lebens gesehen. Die Aufzucht der Jungen dauert zwei Jahre, und das Nest wird unregelmäßig genutzt. An verschiedenen Orten in Brasilien gebe es ein paar weitere Nester, aber die Vögel hielten sich nicht immer dort auf, und zur Zeit meines Besuchs war offenbar keines der anderen Nester bewohnt. Dieses hier war also meine einzige reelle Chance, den geradezu mythischen Vogel zu Gesicht zu bekommen.
Giuliano und Bianca quartierten uns in einem kleinen Hotel ein und ließen mich mit einem kurzen Boa noite in meinem Zimmer zurück. Um 4.45 Uhr sollte ich am nächsten Tag zur Harpyien-Pirsch abfahrbereit sein. Ich legte meinen Rucksack in einer Ecke ab, setzte mich aufs Bett und schaltete den Fernseher ein. Es gab nur eine Handvoll Sender, allesamt auf Portugiesisch, sodass ich nicht viel verstand. Während ich meinen Laptop auspackte, auf das Kopfkissen legte und das eine oder andere notierte, was sich heute zugetragen hatte, ließ ich im Hintergrund eine brasilianische Nachrichtensendung laufen.
Es war ein seltsames Gefühl, um die Welt zu reisen und trotzdem so losgelöst von ihr zu sein. Ohne dass ich irgendetwas davon mitbekommen hatte, war in der vergangenen Woche der jemenitische Präsident zurückgetreten, in Nigeria hatte es ein Massaker gegeben, Schweizer Banken hatten für Aufruhr auf den Finanzmärkten gesorgt, der US-Senat hatte die umstrittene Keystone-XL-Pipeline genehmigt, und in Westafrika grassierte das Ebola-Virus. Vor einem Monat noch hatte ich zu Hause Nachrichten aus aller Welt aufmerksamst verfolgt, schließlich würde ich bald dort sein, wo die Schlagzeilen entstanden. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus: Hier, in diesem winzigen Nest, mitten in Brasilien, war das Nachrichtengetöse der Welt weit, weit weg. Jetzt, da ich tatsächlich den Planeten bereiste und mich jeden Tag enger mit seinem Vogelreichtum und den Einheimischen verband, schien sich das Mediengeschehen auf ein völlig anderes Universum zu beziehen, mit dem ich nichts zu tun hatte. Die Vogelsuche war so intensiv – und durch das Bewusstsein, bald schon wieder weiterfahren zu müssen, noch mal intensiver –, dass sie allen Raum einnahm. Verwirrt sank ich in einen unruhigen Schlaf mit unruhigen Träumen.
Als einige Stunden später mein Wecker schrillte, brauchte es einen Moment, um zu realisieren, wo ich war. Harpyien! Ich griff nach meinem Rucksack, hastete hinaus in die Dunkelheit und traf draußen Giuliano und Bianca. Wir warfen unser Zeug in den Wagen und brachen voller Vorfreude zum Harpyien-Nest auf.
Der Verkehr um 4.45 Uhr floss so spärlich, dass wir flott vorankamen und kurz nach Sonnenaufgang in der Serra das Araras ankamen. Der zerfurchte Straßenbelag ging erst in Schotter und schließlich in Weidegras über. Vorsichtig suchte Giuliano zwischen Kühen und Kuhfladen einen Platz zum Parken und ging die letzten paar Hundert fußläufigen Meter voran.
Als die Sonne aufging, waren überall Vögel. Auf und über den Lichtungen und in den Waldstücken. Schriftarassaris, eine kleine Vogelart aus der Familie der Tukane, spielten im Laub Verstecken, während sich ein paar ausgelassene Gelbbrauenspechte gegenseitig um einen Baumstumpf herumjagten. Ein dunkel gefiederter Fledermausfalke, nicht größer als eine fliegende Bierflasche, strich über unsere Köpfe hinweg. Aus dem Dickicht drang das Geschwätz einiger Drosselzaunkönige zu uns, und ein Schwarzohrpapagei genoss die Aussicht von der Spitze eines hohen Baumes, dieweil aus der Ferne ein Brasilsperlingskauz rief. Fast alle Vögel, die wir hier sahen, standen noch nicht auf meiner Jahresliste, da heute ja mein erster Morgen in Zentralbrasilien war, aber sie alle gehörten gängigen Arten an, die ich in den folgenden Wochen noch verschiedentlich sehen würde. Hier und jetzt hatte ich aber nur ein Ziel und konnte meine Aufregung kaum bändigen.
Plötzlich standen wir vor einem riesigen Baum. Etwa auf Zweidrittelhöhe des Stammes erblickte ich in einer dreigliedrigen Astgabel ein Nest in VW-Bus-Größe, eine Konstruktion aus Stöcken, in der ich mich bequem hätte ausstrecken können – wenn denn dort nicht eine der wildesten Kreaturen der Welt wohnen würde. Die Harpyien hatten sich eine prächtige Festung in den Lüften gebaut. Ich schaute durch mein Fernglas, stellte es scharf und sah …
Nichts. Keine Harpyie.
Wir hatten offenbar die richtige Stelle gefunden, aber wo waren die Harpyien?
„Hmmm“, machte Giuliano, nachdem er das Nest eine Minute sorgfältig beäugt hatte. „Siehst du irgendwas, Bianca?“
„Nö“, gab sie zurück. „Nur das Nest und sonst nichts.“
Zu dritt starrten wir nach oben. Überall um uns herum zwitscherten und sangen Vögel, aber wir waren einzig und allein auf den einen Vogel fixiert, der ausgeflogen war.
„Letzte Woche waren sie noch hier“, versicherte Giuliano ratlos. „Eine Gruppe von Birdern war hier und hat erzählt, das Weibchen habe im Nest gehockt und das Männchen sei mit Nahrung angeflogen. Das Nest muss also bewohnt sein. Versuchen wir es mal aus einem anderen Blickwinkel. Vielleicht ist das Weibchen ja da und wir sehen es nur nicht, weil es tief im Nest hockt.“
Wir gingen um den Baum herum und hielten den gleichen Abstand, bis wir auf der anderen Seite ankamen. Keine Harpyie, auch wenn das Nest aus diesem neuen Blickwinkel schon für sich imposant genug war. Stell dir vor, du müsstest aus lauter Einzelteilen ein Baumhaus bauen, ohne die Arme zu benutzen! Was für eine Arbeit.
„Hmmm“, machte Giuliano noch einmal. „Sie müssen irgendwo in der Nähe sein. Am besten, wir warten eine Weile, ob eine der Harpyien auftaucht. Vielleicht besorgen sie gerade das Frühstück.“
Wenn einer dieser Vögel „das Frühstück“ besorgt, läuft das vermutlich auf einen Affenmord hinaus, eine unangenehme bis barbarische Vorstellung. Ob die Harpyien jemals einen Moment darüber nachdenken, was sie da tun?
Wir hockten uns auf einen umgestürzten Baumstamm und warteten. Giuliano und Bianca saßen im Partnerlook nebeneinander: pastellgrüne Hemden, Outdoorhosen, kniehohe Gummistiefel und Sonnenhüte. Giuliano als hauptberuflicher Vogelführer kannte diesen Ort gut und wirkte völlig tiefenentspannt. Er plauderte angeregt über Vögel, Kultur und Essen. Bianca war indes gerade erst aus dem Norden des Landes angereist, wo sie als Ornithologin im Amazonasregenwald arbeitete. Sie bekam jedes Mal leuchtende Augen, wenn irgendwo eine neue Vogelart auftauchte. Bruder und Schwester vermeldeten einen Vogel nach dem anderen, ich hatte meine liebe Mühe hinterherzukommen.
„Schuppenbauchtaube!“ Giuliano richtete sein Spektiv auf eine Baumspitze in einiger Entfernung, damit er den Vogel besser sehen konnte. In 30-facher Vergrößerung sah ich den roten Schnabel, den braunen Körper und das filigrane Muster an der Halspartie, das diesem Vogel seinen Namen gibt und wie eine Schlangenhaut anmutet.
„Da, ein Epaulettentrupial“, warf Bianca ein und zeigte auf einen pechschwarzen Vogel mit hellgelben Flecken an den Schultern. Wenige Minuten später beobachteten wir einen Rothalsspecht, einen der größten Spechte der Welt. Er arbeitete sich wie ein gefiederter Presslufthammer an einem toten Baum hoch. Später hörten wir sein Balztrommeln, immer zwei Trommelschläge hintereinander. Dann sahen wir einen kurzen Auftritt des Schwarzhalssaltators, zu erkennen an seinem orangefarbenen Schnabel und schwarzen Gesicht, und ich dachte, wie vorteilhaft es ist, wenn man in Überlappungszonen auf Vogelsuche geht. Der Specht ist ein echter Amazonasbewohner, während der Saltator meist nur im zentralbrasilianischen Cerrado vorkommt. Doch hier, wo beide Biome aufeinandertrafen, konnte man Vögel aus beiden Habitaten Seite an Seite sehen.
Während die Sonne in einen krass blauen Himmel aufstieg, erzählte Bianca mir von ihren Forschungen in der Provinz Amazonas, wo sie sich demnächst an eine Promotion über Amerikanische Scherenschnäbel machen wollte. Die sonderbaren Vögel erinnern an Seeschwalben, sie ziehen ihren verlängerten Unterschnabel durchs Wasser und schnappen im Flug Fische aus dem Wasser. Doch plötzlich verstummte Bianca und zeigte auf einen entfernten Baum. „Hey, was ist das da für ein weißer Fleck?“
Wir nahmen alle drei die Stelle, auf die sie zeigte, mit unseren Ferngläsern ins Visier und sahen auf einem Ast einen Vogel hocken, der ziemlich groß sein musste. Er hatte eine massige Raubvogelstatur und hängende Schultern. Er blickte grimmig drein und war gerade so weit entfernt, dass wir nur wenige Einzelheiten erkennen konnten. Giuliano stellte sein Spektiv scharf und lächelte dann.
„Das … ist … ein … Adler … “
Mein Herz machte einen Freudensprung. Ich beugte mich vor und starrte durch das Okular. Mein Blick wurde erwidert von einem großen Vogel mit böser Miene und schwarzem Rücken, blütenweißer Brust, ebenfalls weißem Kopf, gelben Augen, schwarzem Augenstreif und orangefarbenem Schnabel.
„… aber keine Harpyie“, beendete Giuliano den Satz. „Das ist ein Elsteradler. Wir haben echt Glück! Die sind sehr selten und launenhaft. Für Elsteradler haben wir keine Neststandorte oder Beobachtungsstationen. Dass uns einer im Wald über den Weg läuft, ist ein echter Glücksfall.“
Sollten wir uns nun wirklich besonders glücklich schätzen? Ich wusste nicht, ob ich vor Freude aus dem Häuschen oder enttäuscht sein sollte. Die Harpyie, fast doppelt so groß und zehn Mal so schwer, ließ sich nach wie vor nicht blicken. Unter anderen Umständen wäre dieser Elsteradler für mich das Highlight des Tages gewesen. Er war ein forsch wirkender Vogel mit markanten Konturen und starken Farbkontrasten. Ich studierte ihn lange und eingehend durch das Spektiv. Der Elsteradler macht Jagd auf alle möglichen Tiere, aber seine Hauptspeise sind kleinere Vögel. Deshalb muss er schnell und wendig sein. Unser Exemplar stellte irgendwann seine Schwanzfedern zu einem Fächer auf, ließ dabei kurz ein Streifenmuster zum Vorschein kommen und verschwand im Wald. Die Begegnung mit dem Elsteradler war, wie sich später herausstellte, tatsächlich eine Seltenheit: Im ganzen Rest des Jahres sah ich keinen zweiten.
Ich kam innerlich wieder zur Ruhe, hockte mich erneut auf den Baumstamm und wartete weiter auf die Harpyie. Eine Stunde verging. Das Gespräch erstarb. Die bereits bekannten Vögel – Arassaris, Spechte, Tauben – hüpften weiter um uns herum. Ich beobachtete und studierte sie, hielt aber gleichzeitig Ausschau nach dem überdimensionierten Greifvogel, auf den wir warteten. Vermutlich hielten auch die anderen Vögel die Augen offen, weil sie nicht wussten, ob und wann sie vielleicht Ziel eines Luftangriffs wurden. Für mich war das Ganze eine schöne Vormittagsveranstaltung, aber für die anderen Waldgeschöpfe war das Ausschauhalten nach den Adlern eine Existenzfrage.
Inzwischen waren schon zwei Stunden vergangen. Dann drei. Giuliano und Bianca wirkten ein bisschen nervös, und ich schaute unwillkürlich immer wieder auf meine Armbanduhr. Wie viel Zeit konnten wir guten Gewissens auf eine einzige Spezies verwenden, Harpyie hin oder her? Aus strategischer Sicht war es unsinnig, über eine Stunde auf einen einzelnen Vogel zu warten. Ich kam mir schäbig vor, weil ich solche Berechnungen anstellte; jedem war völlig klar, dass eine Harpyie überdurchschnittlichen Einsatz wert ist. Doch als wir uns allmählich der Vier-Stunden-Marke näherten und mein Magen Interesse an einem Mittagessen bekundete, begann ich mich zu fragen, welche Opfer wir noch bringen sollten, wenn der Ehrengast sich nicht bald blicken ließ.
In unserem Harpyien-Ausguck wurde mir wieder einmal klar, dass Birding, wie so viele andere Beschäftigungen – Kreuzworträtsel lösen, polizeiliche Ermittlungsarbeit, Raumfahrt –, ein Geduldspiel ist, unterbrochen von intensivsten Spannungsmomenten. Der Nervenkitzel packt dich völlig unerwartet und in unbekannter Dosierung. Wenn Vögel komplett berechenbar wären, würde eine Vogelsuche keinen Spaß machen. Das Warten ist Teil des Gesamtpakets. Je länger du wartest und hoffst, umso größer die Belohnung, sogar wenn diese Belohnung ausbleibt.
Einer der Gründe, warum Leute wie ich dem Birding verfallen, sind die Zufallsbelohnungen oder das, was der amerikanische Psychologe B. F. Skinner in den 1950er Jahre als „variables Belohnungsschema“ beschrieb. In seinen berühmten Experimenten zur sogenannten Operanten Konditionierung hat Skinner demonstriert, dass man Mäusen beibringen kann, einen Hebel zu drücken, um an einen Leckerbissen zu kommen. Skinner konnte zeigen, dass die Mäuse viel versessener auf das Hebeldrücken werden, wenn sie mal mit einer großen, mal mit einer kleinen Futterportion und manchmal gar nicht belohnt werden. Diese Eigenheit ist auch beim Menschen zu beobachten. Paradoxerweise macht es weniger Spaß, jedes Mal eine Belohnung zu bekommen, als ab und zu den Jackpot zu knacken. Ein Paradebeispiel für diese „zufällige Verstärkung“ sind Spielcasinos. Casinobetreiber überlegen sich genau, wie sie diese Funktionsweise unseres Gehirns ausnutzen können. Man stelle sich einen Spielautomaten vor, der jedes Mal, wenn du einen Dollar einwirfst, stoisch 90 Cent ausspuckt. Wo soll denn da der Spaßfaktor sein? Programmiert man den Spielautomaten aber so, dass er dann und wann mehr und manchmal gar nichts auswirft, ist das Spiel garantiert unwiderstehlich.
Beim Birding ist es genauso. Für jeden Spannungsmoment gibt es im Gehirn eine Ladung Dopamin. Das ist der Neurotransmitter, der Glücksempfindungen erzeugt. Dadurch werden die verschiedensten gewohnheitsbildenden Verhaltensweisen verstärkt. Untersuchungen haben gezeigt, je unerwarteter die Belohnung, umso mehr Dopamin wird ausgeschüttet, was im Zusammenhang mit Skinners variablem Belohnungsschema einleuchtet. Das ist aber noch nicht alles. Diese chemischen Stoffe werden oft schon in das System gepumpt, bevor sich die Belohnung tatsächlich einstellt. Das Dopamin macht sich also bereits auf den Weg, wenn wir eine Belohnung erwarten. Dieser halb angespannte Zustand sorgt dafür, dass wir neugierig und bei der Sache bleiben. Mit anderen Worten verdanken wir es der Chemie, dass uns die Vogelsuche ebenso viel Freude bereitet wie die Vogelentdeckung.
Auf diese Weise macht ein eigentlich irrationales Verhalten – vier Stunden in einem gottverlassenen brasilianischen Wald sitzen wegen einer einseitigen Verabredung mit einem in freier Wildbahn lebenden Vogel – dann doch Sinn. Während die Mittagsstunde Stück für Stück näher rückte, dachte ich die ganze Zeit: Wenn wir noch ein kleines bisschen länger hierbleiben, wird die Harpyie jeden Moment auftauchen.
Als die Harpyie kam, legte sie einen geräuschlosen Auftritt hin. Mit steifen Flügeln schwebte sie direkt über unseren Köpfen heran. Giuliano, Bianca und ich hatten soeben beschlossen, definitiv nur noch 15 Minuten zu warten und uns dann geschlagen zu geben.
„Wir müssen ja noch zum Pantanal“, sagte Giuliano so positiv wie möglich. „Es gibt jede Menge andere Vögel zu entdecken.“
Ich sah die Enttäuschung in seinen Augen wie ein Spiegelbild meiner eigenen Enttäuschung. Mag sein, dass eine Harpyie für mein Big Year genauso viel (oder wenig) zählte wie ein Sperling, aber der Gedanke, an einem so vielversprechenden Ort nach stundenlangem Warten einen so spektakulären Vogel zu verpassen, war echt schwer zu ertragen. Ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass wir einen halben Tag für nichts und wieder nichts verplempert hatten. Und dann, als hätte es für den großen Auftritt auf diesen emotionalen Tiefpunkt gewartet, tauchte das mythische Wesen einfach auf, und alle Enttäuschung löste sich binnen einer Nanosekunde in Wohlgefallen auf.
Mein erster Gedanke war: Wow! Was für ein Riesenvogel! Die Harpyie bewegte sich im Sinkflug auf ihren Nistbaum zu, kam mit gespreizten Flügeln in der Luft zum Stehen, setzte sanft auf einem dicken Ast auf und zeigte uns den Rücken. Dann drehte sie den Kopf in unsere Richtung, fixierte uns durchdringend und wandte sich ab, sodass wir sie von unten betrachten konnten. Von vorn konnte ich die beiden gewaltigen Krallen bewundern, die etwas Pelziges festhielten.
„Sie hat sich was zu essen geholt“, raunte ich. Giuliano richtete sein Spektiv auf die Krallen.
„Stimmt“, gab er zurück. „Aber ich kann nicht genau erkennen, was es ist. Hier, schau mal durch.“
Die Harpyie war so riesig, dass sie das Sichtfeld des Spektivs komplett ausfüllte. Bei dieser starken Vergrößerung konnte ich jede einzelne Feder erkennen. Ich sah ihr schwarzes Brustband, einen kronenähnlichen Federschopf, den Hakenschnabel und das schwarz-weiße Streifenmuster an Flügeln und Schwanzfedern. Farblich changierte die Harpyie zwischen Holzkohle, Asche und Tusche. Ihre Augen waren tiefschwarz und glanzlos. Größe und Gefieder ließen auf ein ausgewachsenes Männchen schließen. Im Verhältnis zu den Weibchen sind Harpyien-Männchen zwar relativ klein, aber natürlich trotzdem immer noch riesengroß. Insgesamt machte diese Harpyie den Eindruck, als sei mit ihr nicht zu spaßen.
Bei näherem Hinsehen erkannten wir, dass der Vogel ein Tier in den Krallen hielt, dessen langer, gestreifter Schwanz lose herunterhing.
„Was meinst du, was er da erbeutet hat?“, fragte ich. Giuliano, Bianca und ich schauten jetzt abwechselnd durch das Spektiv.
Die ortsansässigen Affen hatten einfarbige Schwänze und schieden daher aus. Schließlich kamen wir zu dem Ergebnis, dass es sich um einen Nasenbär handeln müsse, ein in den amerikanischen Tropen weitverbreitetes, waschbärähnliches Tier. Das Schicksal dieses Nasenbären hier war besiegelt; er war bereits zum Teil verspeist worden. Vermutlich hatte das Harpyien-Männchen sein Mittagessen schon eingenommen, um jetzt die Reste mit seiner Gefährtin zu teilen. Doch wo war sie? Vielleicht selbst irgendwo auf Beutefang? Oder versteckte sie sich im Nest? Das Männchen war offensichtlich unsicher und schaute sich suchend um. Es machte keine Anstalten weiterzuessen. Still saß es da und wartete auf das Weibchen. Ironie des Schicksals, dachte ich. Erst warten wir vier Stunden auf den Auftritt dieses Raubvogels, und jetzt wartet er.
Für einen Vogel dieser Größe war die Harpyie sonderbar unauffällig. Wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie sie über unseren Köpfen herangeschossen war, hätte ich die schattenhafte, vom Blattwerk teilweise verdeckte Gestalt unter dem Laubdach leicht übersehen. Der halb verspeiste Nasenbär hatte bestimmt erst im letzten Moment realisiert, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte.
Nachdem aus den geplanten 15 Minuten eine ganze Stunde geworden war, sah es immer noch nicht danach aus, als würde sich das Männchen vom Fleck bewegen oder seine Gefährtin auftauchen. Widerwillig gab ich Giuliano sein Spektiv, damit er es einpacken konnte.
„Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns und wollen uns noch ein paar andere Arten anschauen, bevor es dunkel wird.“
Trotzdem zögerte ich. Mich von einem der seltensten und spektakulärsten Vögel der Welt einfach so abzuwenden, widerstrebte mir. Es kam mir vor, als hätte ich im Lotto gewonnen und würde achselzuckend das Glückslos zurückgeben. Wenn man ein Ungetüm nur lange genug anstarrt, kommt es einem irgendwann zahm vor. Ich wollte die Harpyie aber in ihrer ganzen Wildheit in Erinnerung behalten. Wir waren lange genug hier gewesen.
High von der Harpyie oder dem Dopamin kehrten Giuliano, Bianca und ich auf dem gleichen Weg, den wir gekommen waren, zum Auto zurück. Vor uns drei lag die Reise zum Pantanal und vor mir allein eine noch immer elfmonatige Reise um die Welt. Die Harpyie wurde Vogelart Nummer 657 auf meiner Liste, Stand 30. Januar.