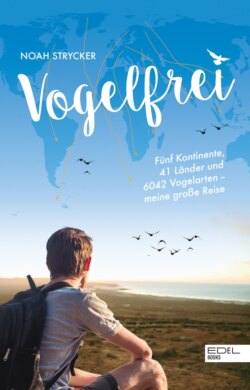Читать книгу Vogelfrei - Noah Strycker - Страница 6
3 Cerro Negro
ОглавлениеNach meiner Landung im nordwestlichen Argentinien war der Ankunftsbereich des winzigen Flughafens von Jujuy (sprich: Hu-Hui) wie ausgestorben. Ich irrte mit meinem Rucksack und meinem Fernglas ein paar Minuten hin und her, ging nach draußen, setzte mich auf den Bordstein und wartete. Meine wenigen Mitpassagiere schlenderten zu ihren Autos, fuhren davon und ließen mich auf dem leeren Parkplatz zurück. Ob mich jemand abholte?
Meine Planung war diesmal ein bisschen unausgegoren. Ein lokaler Birder namens Freddy Burgos hatte mich eingeladen, in den nächsten vier Tagen mit ihm die Provinz zu erkunden, aber da Freddy kein Englisch sprach, hatte ich ihm in meinem unbeholfenen Spanisch geschrieben und die Lücken im Text mit Google Translate gestopft. Wenn ich es richtig verstanden hatte, schlug Freddy eine Campingreise vor, aber die Einzelheiten waren unklar geblieben. Vielleicht hatte ich seine Instruktionen nicht ganz verstanden – sollte ich ihn irgendwo treffen? Ich hatte keine Ahnung, wie er aussah und wo er wohnte, und besaß auch keine Telefonnummer von ihm. Zumindest war das Wetter gut: warm und sonnig. Über der Ziegelfassade des Flughafengebäudes zogen fluffige weiße Wolken dahin. Ideale Bedingungen zum Campen, sofern ich das mit der Campingreise richtig verstanden hatte.
Das neue Jahr war inzwischen 16 Tage alt. Ich hatte über 300 Arten auf meiner Vogelliste und war also mit Blick auf meine 5000er-Marke voll auf Kurs. Mit meiner Ankunft in Zentralargentinien zwei Tage zuvor hatte das Anwachsen meiner Liste im Tempo dramatisch zugelegt. In Buenos Aires hatte ich mich mit dem 31-jährigen Birder Marcelo Gavensky und seinem 28-jährigen Freund Martin Farina getroffen, der Hundetrainer und Student der Paläontologie war. Zu dritt waren wir ins sumpfige Weidehochland der Provinz Entre Ríos rund 200 Kilometer nördlich der Hauptstadt gebraust. Schon am ersten Tag hatten wir 146 Vogelarten entdeckt – mehr als ich an vier Tagen insgesamt in Chile gesehen hatte. 108 von ihnen standen noch nicht auf meiner Liste.
Das Weideland von Entre Ríos ist ungemein fruchtbar. Bei einer Tasse Mate-Tee erzählte Marcelo mir stolz von der Umweltschutzorganisation Alianza de Pastizal, die Farmbesitzer für eine nachhaltige Beweidung zu gewinnen versucht. Dahinter steht die Idee, dass Rinderfarmer auch mit weniger Kühen ihre Profite einfahren und gleichzeitig die Landschaft schonen, wenn sie mit den richtigen Methoden arbeiten. Zertifiziertes Bio-Rindfleisch lässt sich in Europa gewinnbringend verkaufen und findet auch in Argentinien immer mehr Abnehmer. Der Export nach Übersee ist ökologisch keine Ideallösung, aber gut bewirtschaftete estancias sind eine entscheidende Voraussetzung für den Habitatschutz in dieser Region, in der es keine ausgewiesenen Parks oder Schutzgebiete gibt. Auf den Feldern sahen wir Dutzende prähistorisch anmutende Halsband-Wehrvögel, ein paar langbeinige Maguaristörche und vereinzelte Rosalöffler in ihrem aberwitzigen Pink. Einmal stakste ein anderthalb Meter großer Nandu – die Antwort Südamerikas auf den Strauß – ganz nah an uns vorbei.
Nach diesem Kurztrip schlief ich ein paar Stunden auf dem Fußboden von Marcelos Einzimmerwohnung in Buenos Aires, wobei meine Füße in die Küche ragten und mein Kopf unter dem Esstisch lag. Dann sagte ich Zentralargentinien adiós und nahm einen Morgenflug in Richtung Nordwesten. Nun saß ich übernächtigt vor dem Flughafen Jujuy und fragte mich, ob Freddy vielleicht etwas zugestoßen war.
Gerade wollte ich ihm vom Handy aus eine E-Mail schicken, als ich einen kleinen Vogel bemerkte, der den Abflugbereich umschwirrte. Ich eilte hinüber, um ihn besser zu sehen. Das Tier hatte ein Gefieder in warmen Brauntönen und einen dunkelbraunen Kopf, im Flug schienen seine Flügel fuchsrot aufzuleuchten. Dieser Vogel stand definitiv noch nicht auf meiner Liste, aber was war es für einer? Er verhielt sich wie ein Fliegenschnäpper, hockte auf seinem Ausguck und versuchte, Insekten zu erhaschen. Ab und zu schwebte er auf Käferjagd am Dachsims entlang.
Ich schloss das E-Mail-Programm auf dem Handy und öffnete die Fotogalerie. Da alles dagegen gesprochen hatte, einen Zwei-Meter-Stapel schwergewichtiger Nachschlagewerke rund um die Welt zu schleppen, hatte ich vor der Abreise Dutzende von Bestimmungsbüchern und Naturführern sorgfältig eingescannt und auf meinem Smartphone gespeichert. In dem Ordner „Birds of Argentina“ scrollte ich durch lauter Illustrationen zum Tyrannen- bzw. Fliegenschnäpper-Kapitel. Ich wurde fündig: Mein Vogel Nummer 338 war der Schwalbentyrann, ein verbreiteter Bewohner der südamerikanischen Wälder, der offenbar auch eine Schwäche für Laternenmasten auf Flughafenparkplätzen hatte. Dieses Prachtexemplar flatterte 20 Minuten später noch herum, als ein weißer Pickup schnittig auf den Parkplatz fuhr und an der Bordsteinkante hielt. Vier junge Leute sprangen aus dem Wagen, kamen lachend und gestikulierend auf mich zu und streckten mir die Hand entgegen.
„Noah“, rief einer von ihnen, „yo soy Freddy!“
Er war ungefähr so groß wie ich und eher stämmig. Seine glatten rabenschwarzen Haare reichten über die Koteletten und bis in den Nacken. Der Spitzbart am Kinn eignete sich perfekt zum Darüberstreichen, was Freddy – wie ich bald feststellte – denn auch oft und gerne tat. Er trug ein langärmeliges Military-Hemd, eine schwarze Outdoorhose und Wanderschuhe. Sein auffälligstes Merkmal war sein Lächeln, das er offenbar nie abstellte.
Freddy hatte ein paar Freunde mitgebracht, die mich sogleich umringten. Spanische Sprachfetzen flogen mir um die Ohren. Sie baten um Entschuldigung für die verspätete Abholung, redeten etwas von Lebensmitteln und Proviant und stellten sich alle auf einmal vor: Claudia Martin, José Segovia und Fabri Gorleri. Ich war heilfroh, dass sie da waren, und angesichts dieser netten Begrüßung rundum beruhigt.
Ich warf mein Bündel auf die Ladefläche, auf der sich allerhand Zeug für eine Bergsteigerexpedition stapelte. Was Freddy in den kommenden vier Tagen wohl vorhatte? Zu fünft quetschen wir uns in die Doppelkabine des Pickups und brausten davon. Der Schwalbentyrann flatterte vor der Windschutzscheibe herum, um noch schnell ein Insekt aufzupicken, und ich zeigte von der Rückbank aus auf den Piepmatz.
„Sí, sí“, sagte Freddy, der gleichzeitig lenkte, navigierte und ein Auge auf unsere Sachen hatte, damit sie nicht aus dem Wagen geworfen wurden. „Hirundinea ferruginea.“
Ich schaute verdutzt. Dann begriff ich, dass er den wissenschaftlichen Namen des Vogels genannt hatte.
„Genau, ein Schwalbentyrann“, sagte ich. Alle schauten mich verdutzt an. Dass die englischen Vogelnamen – in diesem Fall „Cliff Flycatcher“ – ihnen nichts sagten, war nur natürlich. Aber die meisten Birder in Lateinamerika benutzen auch die spanischen Namen nicht, weil sie nicht vernünftig standardisiert sind. Stattdessen eignen sich spanischsprachige Birder die lateinischen Bezeichnungen an, mit denen sich Forscher auf der ganzen Welt verständigen. Das konnte ja interessant werden, wenn wir in freier Wildbahn einen Vogel nach dem anderen sichten würden.
Freddy fuhr schnurstracks aus der Stadt hinaus, und als wir die Zivilisation hinter uns gelassen hatten, bog der Pickup von der Landstraße ab und machte sich auf einer Schotterpiste an den Aufstieg in die üppig bewachsenen östlichen Andenausläufer. Nach und nach schnappte ich die eine oder andere Information auf. Freddy arbeitete als Biologe in Jujuy, seine Freundin Claudia war Botanikerin und interessierte sich für alles, was mit Natur zu tun hatte. José und Fabri studierten an einer Universität im Osten Argentiniens und hatten weit über 900 Kilometer im Bus zurückgelegt, um zu uns zu stoßen. Alle vier waren zwischen 23 und 34 Jahre alt, teilten die Begeisterung für die Vogelwelt und liebten Abenteuer.
Als Freddy meine erste E-Mail bekam, dachte er, das sei eine gute Gelegenheit für einen Trip zum Cerro Negro, ein selten besuchter Gebirgszug mit seltenen Vogelarten. Die Höhenlagen des Cerro Negro waren mit dem Auto nicht erreichbar. Wir würden also auf einem gewundenen Pfad mehr als 15 Kilometer wandern und dabei über 1000 Meter Höhenunterschied überwinden. Für unser Gepäck hatte Freddy drei Maultiere organisiert, damit wir vier Tage im Nebelwald der Yungas und im Grasland über der Baumgrenze verbringen und dort in Zelten übernachten konnten. Er versicherte uns, dass er reichlich Lebensmittel eingepackt hatte. Bei einem kurzen Zwischenstopp in einem Dorf stieg ein Fahrer zu, der den Pickup zurückbringen sollte. Am frühen Nachmittag erreichten wir den Ausgangspunkt unserer Wanderung. Die Piste endete an einem Fluss, der sich seinen Weg durch den dichten grünen Wald bahnte. Über dem Tal zeigten sich kahle Berggipfel.
Tatsächlich tauchten drei Maultiere mit ihrem Besitzer auf, einem campesino in Jeans und Gummistiefeln, der unsere Bündel an den Satteln festzurrte. Hoffentlich hatte Freddy einen zusätzlichen Schlafsack eingepackt, denn in großer Höhe würde mein Seidenschlafsack sicher nicht warm genug sein. Das Maultiergespann trottete voraus zum Lagerplatz, während Freddy, Claudia, José, Fabri und ich eine Stunde lang den Windungen des Flusses folgten. Die Sonne war hinter einer Wolkenschicht verschwunden, was allmählich ein bisschen besorgniserregend aussah, aber auf Schritt und Tritt tauchten neue Vögel in unserem Blickfeld auf.
„Cypseloides rothschildi“, rief Freddy, und ich sah einen zigarrengroßen Vogel mit sichelförmigen Flügeln über uns hinwegjagen. Er sah wie ein Segler aus, und ich scrollte durch das eingescannte Bestimmungsbuch auf meinem Handy, um die Entsprechung des wissenschaftlichen Namens zu finden. Aha! Rothschildsegler. Eine hübsche regionale Rarität und Jahresvogel Nummer 342.
„Psittacara mitratus“, sagte Fabri, was ich als Rotmaskensittich übersetzte. Noch ein Neuling auf der Liste.
„Empidonomus varius!“, rief Claudia.
Zeitgleich meldete José, der in die entgegengesetzte Richtung schaute: „Progne elegans!“
„Sporophila lineola“, kam von Freddy.
„Momentmomentmoment!“, rief ich und wollte sie bitten, mir etwas Zeit zu geben, damit ich jeden Vogelnamen nachschlagen konnte, aber das war zwecklos. Vögel bleiben bekanntlich nicht still sitzen, bis man sie identifiziert hat. Wenn wir auf eine große Vogelschar im Blätterdach stießen, tat ich mein Bestes, um die auf mich einprasselnden wissenschaftlichen Bezeichnungen von Vogelnamen wenigstens in ein Notizbuch zu kritzeln, damit ich sie später heraussuchen konnte. Fast alle Vögel in diesem Teil von Argentinien sah ich zum ersten Mal. Deshalb wusste ich sehr zu schätzen, dass meine einheimischen Experten mir beim Erkennen der flüchtigen Gesellen behilflich waren.
Für das Sturzbachentenpaar, das diesen Flussabschnitt okkupierte, brauchte ich keine Übersetzung. Da ich schon in Chile eine Sturzbachente gesehen hatte, stand diese Spezies bereits auf meiner Jahresliste, aber ich hielt ein paar Minuten inne und bestaunte, wie sich diese beiden Vögel im Wildwasser behaupteten. Wie bei den meisten Enten hatte das Männchen ein auffallend anderes Federkleid als das Weibchen – er schwarz und weiß mit rotem Schnabel, sie grau und orange. Mit ihren lang gestreckten, schlanken Körpern waren sie für das Leben im strömenden Gewässer perfekt ausgerüstet. Mühelos durchschwammen diese Enten die schäumenden Stromschnellen und arbeiteten sich mit den Füßen gegen die Flussrichtung voran. Offenbar machten sie gerade Jagd und suchten im Vorbeischwimmen die Unterseiten der Gesteinsbrocken nach Wasserinsekten ab.
Als ich flüchtig aufblickte, sah ich Freddy, wie er mit bis über die Knie hochgekrempelter Hose in den Strudel watete. Seine Wanderschuhe baumelten lose um seinen Hals. Er drehte sich zu mir um und winkte.
„Vámanos!“
Wenn wir noch im Hellen an unserem Zeltplatz ankommen wollten, mussten wir jetzt zu unserer Wanderung aufbrechen. Auf der anderen Seite des Flusses führte der Pfad in den Wald hinein. Eine Brücke gab es nicht.
Claudia, José, Fabri und ich zogen unsere Schuhe aus, stiegen ins Wasser und achteten sorgfältig auf jeden Schritt. Das Wasser war eiskalt, floss sehr schnell und reichte mir bis zum Oberschenkel. Knietiefes Wasser kann einen Menschen schon bei einer Fließgeschwindigkeit von sechs Stundenkilometern aus dem Gleichgewicht bringen, und wir brauchten nur auf einem der glitschigen Steine im Wasser ausrutschen, schon würden wir flussabwärts mitgerissen. Vorsichtshalber hatte ich den Inhalt meines Rucksacks in einen wasserdichten Müllbeutel gesteckt, aber die Vorstellung, durchnässt zu werden, bevor die Wanderung überhaupt angefangen hatte, behagte mir nicht.
Die Sturzbachenten schwammen gelassen vorbei, als würden sie auf einem spiegelglatten Teich dahinziehen. Dann hockten sie sich auf einen Felsblock zwischen zwei Wasserfällen und sahen zu, wie wir uns durch den Fluss kämpften, unsere Füße abtrockneten und die Schuhe wieder anzogen. Mittlerweile brauten sich schwere, dunkle Wolken zusammen und hüllten die Berggipfel ein. Ich dachte daran, dass ich erst vor wenigen Stunden in Jujuy gelandet war und noch gestern Nachmittag 1300 Kilometer entfernt mit Marcelo und Martin Vögel beobachtet hatte. Das Farmland von Buenos Aires verschwamm bereits zu einer fernen Erinnerung. Freddy zeigte auf eine Lücke zwischen den Bäumen. Dort begann der Aufstieg. Als wir den Wald betraten, rollte das Echo des ersten Donnergrollens durch das Tal.
Alleingänge und Alleinsein sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. 2011 wanderte ich im Alleingang den über 4200 Kilometer langen Pacific Crest Trail entlang, der von Mexiko durch das Hinterland der amerikanischen Westküste bis nach Kanada führt, aber die meiste Zeit war ich zusammen mit anderen Wanderern unterwegs. Das ließ sich kaum vermeiden, denn Jahr für Jahr versuchen Hunderte, die gesamte Strecke zu erwandern, und rund 95 Prozent von ihnen wählen so wie ich die im Norden beginnende Variante, um dem fortschreitenden Sommer zu folgen. In den vier „Alleingangmonaten“ auf dem Pacific Crest Trail sah ich jeden Tag mindestens einen Menschen; oft wanderten und zelteten wir zusammen.
Mein Big Year unternahm ich auch im Alleingang in dem Sinne, dass ich die Reise allein plante und niemand mit mir von Station zu Station zog. Auf Vogelsuche wollte ich hingegen nicht allein gehen. Mir war wichtig, in jedem Land vogelbegeisterte Gefährten dabeizuhaben. Klug geworden durch die Erfahrungen, die ich bei meinen Fernwanderungen gemacht hatte, reiste ich mit ultraleichtem Gepäck, einem 40-Liter-Expeditionsrucksack, und kontinuierlich von einem Kontinent zum nächsten, ohne Pausentage und ohne Umwege. Bei einer One-Way-Reise sparst du die Rückwege. Ich schaute also immer nach vorn und freute mich auf das Neuland, das vor mir lag. Andererseits konnte ich meine Reiseroute nicht auf die Jahreszeiten in den einzelnen Regionen des Globus abstimmen. Darum würde ich einige Zugvogel-Hotspots verpassen und andere Orte zur Unzeit – nämlich während des Monsuns – ansteuern.
Ich legte Grundregeln fest. Jeder Vogel, der auf die Liste kam, musste von mindestens einer weiteren Person gesehen werden. Das würde mich vor Vereinsamung bewahren und nebenbei dafür sorgen, dass es für jede Vogelsichtung einen Zeugen gab. Außerdem entschied ich, dass meine Begleiter immer Einheimische sein oder in dem Land leben sollten, in dem wir zusammen auf Vogelsuche gingen. Es wäre ein Leichtes gewesen, professionelle Guides von internationalen Reiseanbietern anzuheuern, aber das entsprach nicht meinen Vorstellungen. Zum einen hatte ich nicht das nötige Kleingeld, zum anderen wollte ich lieber mit Freunden unterwegs sein und nicht als Kunde. Kontakte zu Einheimischen wurden zu einem ganz wichtigen Teil meiner Strategie. So ergab sich auch die Couchsurfing-Variante der Tour.
Noch vor zehn Jahren wäre es schwierig gewesen, ein solches Konzept umzusetzen. Durch die technologische Entwicklung ist die Welt heute aber dermaßen geschrumpft, dass es inzwischen leichter ist, jemanden in einem anderen Land anzurufen, als die Aufmerksamkeit des Zimmergenossen zu gewinnen. Das Internet hat Birding revolutioniert: Aus der Freizeitbeschäftigung für die Erste Welt ist eine wirklich internationale Bewegung geworden. Wer will, findet im Internet alle möglichen Informationen und kann per Mailinglisten, Diskussionsgruppen und Foren mit Gleichgesinnten in Kontakt treten.
Einheimische Birder zu finden und Zeitpläne mit ihnen abzustimmen, war eine logistische Herausforderung der besonderen Art. Nachdem meine Reiseroute in groben Zügen feststand, machte ich mich daran, an jeder Station die besten Birder zu kontaktieren, und hoffte, dass sie bereit waren, für ein paar Tage meine Gastgeber zu sein. Zuerst fragte ich Freunde, die ich schon hatte; im zweiten Schritt fragte ich nach ihren Kontakten und so weiter. Manche mussten absagen, weil sie arbeiteten, aber von allen bekam ich begeisterte Rückmeldungen, wenn ich meine Idee erklärte. An Freddy war ich zum Beispiel geraten, weil ich mich zunächst an einen Birder namens Ignacio „Kini“ Roesler von der Universität Buenos Aires gewandt hatte, der mir mitteilte, dass er im Januar mit einem Forschungsprojekt über den Goldscheiteltaucher beschäftigt sein werde, mich aber an seinen Freund Nacho Areta weiterleite. Nacho antwortete mir, er führe dann leider eine Studie zum Mississippiweih durch, gab mir aber Freddys E-Mail-Adresse.
Für manche Stationen nutzte ich die Website BirdingPal, auf der sich Birder als Gastgeber für durchreisende Vogelbeobachter eintragen. Hier findet man keine professionellen Guides, sondern wahre Gastfreundschaft und angenehme Gesellschaft. Das eigene Revier jemandem zu zeigen, der es nicht kennt, macht ja auch Spaß, und wenn die Rollen eines Tages getauscht werden, kann man sich für den erwiesenen Gefallen revanchieren.
Eine weitere wichtige Planungshilfe für mich war eBird, eine Online-Datenbank für Vogelsichtungen, die das Cornell Lab of Ornithology und die National Audubon Society 2002 ins Leben gerufen haben. Mit fast einer Milliarde Beobachtungen, die Hunderttausende Birder in aller Welt eingespeist haben, ist die Website ein unglaublich gutes Hilfsmittel, wenn man sich über die Verteilung und Erfassung von Vogelarten informieren will. Wissenschaftler verfolgen damit Wanderungsbewegungen und die Populationsentwicklung. Für meine Logistikplanung war eBird ein Segen. Mithilfe dieser Datenbank fand ich heraus, wo ich bestimmte Spezies antreffen dürfte, sie lieferte aktuelle Berichte und zeigte mir an, welche Birder in meinen Zielgebieten am aktivsten waren. Immer, wenn sich die Mundpropaganda-Methode erschöpft hatte, suchte ich in eBird nach Ansprechpartnern.
Couchsurfing klingt irgendwie bequem, aber diese Übernachtungsbesuche einzufädeln, kostete mich glatte fünf Monate Planung. Als ich von zu Hause aufbrach, wusste ich praktisch für jeden Tag des Jahres 2015, wo und bei wem ich übernachten würde. Die Birder-Liste enthielt Hunderte von Namen und wurde dadurch, dass ich meine Pläne unterwegs änderte und die Zeit voranschritt, immer länger.
Das Wissen der Einheimischen ist unersetzlich. Restaurants, Schleichwege, Sitten und Gebräuche, Sprache, Geheimtipps und die zahllosen Dinge, die nur Ortsansässige kennen. Indem ich mich Einheimischen anschloss, schaffte ich mühelos den Sprung vom Touristen zum Insider, und indem ich bei ihnen zu Hause wohnte und eben nicht in Ferienorten und Lodges, bekam ich eine Menge vom wirklichen Leben auf dieser Erde mit, ohne mein Bankkonto zu sprengen. Die Kenntnisse der Einheimischen machten sich auch in Form von Vögeln bezahlt, die ich ansonsten nicht sehen würde. Aber ob das wirklich funktionierte, wusste ich anfangs nicht. Es würde sich auf der Reise erst herausstellen.
Viele meiner Kontaktpersonen hatten keine Erfahrung als Gästeführer. Sie kamen aus allen möglichen Berufszweigen, sprachen verschiedene Sprachen und variierten altersmäßig vom Teenager bis zum Mittsiebziger. Jeder machte sich offenbar ein etwas anderes Bild von meinem Vorhaben. Manche schrieben sofort zurück, von anderen bekam ich erst Monate später eine Antwort. In einigen Fällen hatte ich bis zur Landung im fremden Land nur eine Nachricht per Facebook oder eine WhatsApp in der Hand. Ich überwies Geld auf private Bankkonten im subsaharischen Afrika oder in Südostasien, um Birdern, mit denen ich noch nie telefoniert hatte und die meine Anfragen in kaum verständlichem Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache beantworteten, die Kosten für geplante Trips in Nationalparks vorzuschießen. Verschiedentlich bekam ich kurze Panikattacken. Ob das wirklich eine gute Idee war? Alles, was ich tun konnte, war vertrauen.
Da hätte ich ja genauso gut mit den Sturzbachenten in den Fluss springen können, dachte ich, als wir uns den Pfad hochquälten. Es regnete in Strömen. Eine Zeitlang hielt ich mich verzweifelt an einem Regenschirm fest, aber das brachte überhaupt nichts. Die Tropfen prallten vom Boden ab, ein Windstoß stülpte den Schirm um, und regennasse Vegetation säumte den Weg wie die Rollbürsten in einer Autowaschanlage. Inzwischen war der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr nasser werden konnte. Hätte ich meine Unterwäsche über einem Bierglas ausgewrungen, wäre das Glas locker voll geworden.
Mehr Grund zur Sorge bereitete uns allerdings die Elektrizität in der Luft. Freddy, Claudia, José, Fabri und ich waren in ein Gewitter hineingewandert. Nicht unter ein Gewitter, sondern mitten hinein. In der Atmosphäre knackte und knisterte es, während wir einen Bergrücken erklommen. Blitz und Donner wurden eins; in einer Wolkenlücke sah ich einen Blitz in das unter uns liegende Tal einschlagen. Dann schloss sich die Lücke wieder, und wir blieben in einer wirbelnden, horizontlosen Welt von Stroboskopleuchten, widerhallenden Erschütterungen und die Sinne verwirrenden Bewegungen zurück.
Der Regen drosch auf uns ein. Ich versuchte inzwischen gar nicht mehr, den Fuß auf festen Boden zu setzen. Der zerfurchte Pfad verwandelte sich in einen kleinen Wasserfall. Ich mühte mich gegen die Fließrichtung bergan und hoffte, dass die Müllbeuteleinlage in meinem Rucksack dafür sorgte, dass wenigstens ein paar Klamotten trocken blieben. Sobald ich den Kopf hob, peitschte Wind in meine Augen, drum hielt ich beim Gehen den Kopf gesenkt. Wasser rann von meiner Nasenspitze. Ich versuchte, nicht an die schätzungsweise 20.000 Menschen zu denken, die jedes Jahr von einem Blitz getroffen werden. Hinter einer Wegbiegung wäre ich fast mit Freddy zusammengestoßen, der stehen geblieben war. Er breitete die Arme aus, sah mit wild funkelnden Augen zum Himmel hoch und rief: „Me gusta esta Cerro Negro!“ – So gefällt mir der Cerro Negro!
Ich konnte seinen Enthusiasmus nur bewundern.
Kurz bevor es dunkel wurde, erreichten wir in komplett zerfleddertem Zustand unseren Zeltplatz. Das Gewitter zog endlich ins Nachbartal hinüber und ließ zum Sonnenuntergang einen klaren Himmel und sich kräuselnde Nebelschwaden zurück. Der Maultiertreiber hatte unsere Ausrüstung auf einem Höhenrücken gestapelt. Wir fanden ein paar durchtränkte Abdeckplanen und Zelte, machten sie auf einer Grasfläche fest und fielen über das Abendessen her. Um fünf Leute vier Tage im Gebirge satt zu bekommen, hatte Freddy weiche Brötchen, Salzcracker, Corned Beef, Dosensardinen, Äpfel, Erdnüsse und Süßigkeiten eingepackt. Alles war vom Regen feucht. Unter den gegebenen Umständen glich es trotzdem einem Festschmaus. Zumindest Wasser war keine Mangelware. Wir tranken auf Händen und Knien direkt aus einem nahen Bach, bis Freddy eine Methode erfand, mit der wir aus einer Plastiktüte trinken konnten. Irgendwie hatte keiner von uns daran gedacht, eine Wasserflasche mitzunehmen.
Gott sei Dank hatte Freddy einen zusätzlichen Schlafsack für mich eingepackt. Nach einem knappen buenas noches legte ich mich früh aufs Ohr und freute mich auf den ersten guten Schlaf seit Tagen. In meinem Zelt öffnete ich meinen Rucksack, entknotete den Müllbeutel und stellte mit Entzücken fest, dass der Inhalt flauschig und trocken geblieben war. Ich schälte mir die nassen Kleider vom Leib, zog trockene an und schlief sofort ein. Die ganze Nacht bevölkerten sonderbare, nicht identifizierbare Vögel meine Träume.
Am Morgen wachte ich benommen auf und wusste im ersten Moment nicht, wo ich war. Ich steckte den Kopf aus dem Zelt und sah einen riesigen Andenkondor vorbeigleiten, der seinen Kopf hin- und herschwenkte. Stimmt, Argentinien. Die Gipfel ringsum waren mit frischem Schnee überzogen. Das Zelt roch nach Regen, das Gras roch nach Regen, die Bäume rochen nach Regen, die durchnässte Kleidung auf unserer Wäscheleine roch nach Regen, und der Ausblick war herrlich. Mit Bergregenwald überwachsene Hügelketten zogen sich, einander überlagernd, in alle Richtungen hin. Ich sah auf meine Armbanduhr, aber die Batterie war leer; auch mein Handy funktionierte nicht. Ich konnte die Uhrzeit also nur am Stand der Sonne ablesen, die so strahlend hinter dem Horizont hervorkam, wie ich es in meinem Leben noch nicht gesehen hatte.
Jetzt regten sich auch die anderen. Claudia schlenderte um den Zeltplatz herum und nutzte ihr botanisches Wissen für die Suche nach wilden Pfirsichen. Plötzlich schrie sie: „Oh!“
„Que pasó?“, rief José aus seinem Zelt.
„Una culebra.“ Claudia beugte sich vor, um ein Ding im Gras näher in Augenschein zu nehmen.
Ich quetschte mich in meine klatschnasse Hose, legte die trockene Schlafhose zusammen, zog eiskalte, feuchte Socken und Schuhe an und trottete hinüber, um zu sehen, was los war. Eine 30 Zentimeter lange Schlange mit einem regelmäßigen X-Muster auf dem Rücken hatte sich dort eingeringelt wie eine Brezel.
„Eine Lanzenotter“, stellte Claudia fest. Die Lanzenotter gehört zur Familie der Grubenottern, hochgiftige Bewohner Lateinamerikas. Claudia bedeutete mir, das Tier nicht zu berühren. Ich sah, keine zehn Meter von meinem Schlafplatz entfernt, eine attraktive kleine Schlange mit einem kantigen Dreieckskopf, die ein Pferd zur Strecke bringen konnte. Wir ließen sie gerne in Ruhe.
Kurz darauf verspeisten wir ganze Sardinen zum Frühstück. Während ich deren Wirbelsäule knackend zerkaute und das tropfende Öl abschleckte, beäugte uns von seinem nahen Ausguck ein Aplomadofalke. Freddy knabberte an einem Schokoriegel, strich sich durch seinen Spitzbart und erläuterte unseren Plan: Die nächsten beiden Tage würden wir el pastizal, das Grasland, durchwandern und bis auf 3500 Meter vorstoßen, um uns auf die Suche nach seltenen Vögeln mit verlockenden Namen wie Baerammerfink, Dornbuschcanastero und Graukehltapaculo zu machen. Anschließend würden wir zum Ausgangspunkt unserer Wanderung zurückkehren und uns dort am Nachmittag des nächsten Tages abholen lassen. Wenn wir Glück hatten, würde der vom Regen angeschwollene Fluss bis dahin wieder weniger Wasser führen, sodass wir zurückwaten könnten und nicht durch die Stromschnellen schwimmen müssten.
Das war wieder einer der Momente, in denen mir die Vorteile des Prinzips „Go Local“ klar wurden. Mit einer organisierten Tour würde man niemals hierhin gelangen. Als ich später professionelle Guides nach Cerro Negro befragte, sagten sie, dass sie davon noch nie gehört hätten. Das Gebiet war zu schwer zu erreichen und kam deshalb als Touristenziel nicht infrage. Aber hier waren eben die besonderen Vögel, und genau deshalb hatte ich Freddy kontaktiert. Er kannte die hintersten Winkel der Provinz Jujuy besser als jeder Guide.
Mein System funktionierte! Ich konnte es kaum glauben. Das Jahr war schon zwei Wochen alt, und noch niemand hatte mich versetzt. Allmählich begriff ich, dass meine kontaktierten Birder dieses Projekt ebenso spannend fanden wie ich, dass sie tolle Pläne austüftelten und Gleichgesinnte mitbrachten. Genau darum geht es beim Birding. Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft, teils aus ganz verschiedenen Erdteilen und vielleicht sogar ohne gemeinsame Sprache, kommen als Fremde zusammen, setzen sich ein gemeinsames Ziel und werden dickste Freunde. Als ich meine erste E-Mail an Freddy schickte, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir jetzt zu fünft mit drei durchnässten Maultieren und einem Mordsausblick auf diesem Berg hier stehen würden.
Freddy zeigte sein breites Lächeln. Der Tag war jung, und wir hatten noch allerhand Vögel zu entdecken. „Okay, vámanos!“ – Auf geht’s!