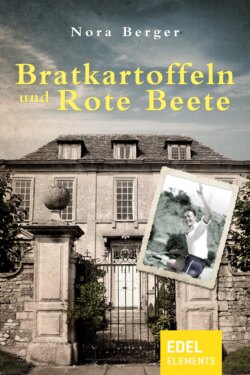Читать книгу Bratkartoffeln und Rote Beete - Nora Berger - Страница 7
III. Kapitel Ein unbarmherziger Winter
ОглавлениеMühsam stapfte der Trupp Freiwilliger, der Zugführer und einige seiner Mannschaft, im trüben Licht des grauen Wintertags durch den tiefen Schnee dem Dorf zu, das nur zwei Kilometer vom Halt des Zuges entfernt lag. Die Kälte war schneidend, aber nicht so stark wie in den vergangenen Nächten, in denen es manchmal 30 Grad minus gehabt hatte.
Emilias Füße schlotterten in den weiten Stiefeln, die ihr jemand geliehen hatte, und ihr Mäntelchen über der Schwesterntracht hielt kaum dem von Schneestaub durchsetzten Wind stand. Aber sie wusste, wenn sie als Schwester des Roten Kreuzes dabei war, hatte der Bittgang einen seriöseren Anstrich und man würde eher Kohlen und Lebensmittel herausgeben. Manchmal wurde ja auf den Gehöften auch ihre Hilfe gebraucht, dankbar angenommen und großzügig belohnt. Eigentlich war sie froh, ihre steifen, nach der langen Fahrt unbeweglichen Glieder rühren zu können, und nach und nach erwärmte die Bewegung ihren Körper und färbte ihre Wangen rot.
Das erste Bauernhaus, das sie erreichten, schien Hals über Kopf verlassen. Das Vieh schrie in den Ställen und ein Teil der Tiere war verendet, so hastig hatte die Angst vor den Russen, vor Raub, Vergewaltigung und Plünderung die Bewohner davongetrieben. Im Keller lagen Kohlen, die sie dringend brauchten, und ein Berg Kartoffeln. Die Frauen fanden einen Rest eingepökelten Speck und ein Fass voller Wein, den sie in Gefäße zu füllen versuchten. Im Hühnerstall gab es sogar noch Eier. Mühsam schleppten die Männer einen ersten Sack der kostbaren Kohlen den Weg zum wartenden Zug. Mehrmals mussten sie die Strecke gehen.
Emilia, auf der Suche nach Milch und Brot für die Kinder, wanderte ein Stück die hart gefrorene Dorfstraße entlang, auf der ihr Menschen entgegenkamen und sie mit Fragen bestürmten, ob sie etwas von den Russen wüsste und ob es besser wäre auszuharren oder wegzuziehen. Eine junge Frau, in ein wollenes Schultertuch gehüllt, packte sie aufgeregt beim Arm.
„Sie sind Schwester? Kommen Sie, der Himmel hat Sie gesandt! Mein Kind ist krank, es hat solches Fieber und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Mann ist mit den anderen Kindern und einem Karren des Notwendigsten schon voraus. Ich konnte den Kleinen nicht mitnehmen – er fieberte und fror so sehr. Ein Transport in der Kälte hätte ihn umgebracht. Ich wollte warten, bis es ihm besser geht, und mit den Nachbarn nachkommen. Aber der Doktor ist weg – es gibt niemanden mehr, der mir helfen könnte; es geht ihm täglich schlechter und ich hab keine Medizin mehr.“
Emilia folgte der jungen Polin in die enge Bauernstube, wo ihr das spitze, schon abwesende Gesicht eines etwa fünfjährigen Buben entgegenblickte, der unter einer dicken Daunendecke zitterte. „Sehen Sie, mein Ignazy, mein kleiner Sonnenschein!“, schluchzte die junge Frau auf, mit der Schürze das Gesicht bedeckend. „Ich habe schon alles versucht – das Fieber will nicht weichen. Ich weiß nicht einmal, was er hat! Helfen Sie ihm, ich flehe Sie an.“
Emilia beugte sich über den Kleinen, auf dessen geröteten Wangen sich weiße Flecken bildeten. „Sei ruhig, mein Kleiner“, murmelte sie, „ich versuche, dir nicht wehzutun. Lass mich einmal in deinen Hals sehen.“
Das Kind wendete mit schmerzverzerrter Miene den Kopf ab. „Ignazy, mein Kind! Tu, was sie sagt! Die Schwester will dir doch nur helfen!“, schrie die Mutter auf, das Herz von unsagbarem Schmerz zerrissen.
Der Junge stieß ein greinendes Geheul aus, als Emilia versuchte, seinen Kopf anzuheben und im Schein der Öllampe, die die Mutter hielt, in seinen Rachen zu blicken. In dem kurzen Moment, in dem es ihr gelang, den Mund des Kindes zu öffnen, sah sie die dicken, weißlich hellrot entzündeten Placken, die sich im hinteren Bereich gebildet hatten. Sie legte den Kopf des Kindes auf das Kissen zurück und strich ihm beruhigend über die Stirn. Dann sah sie die Mutter mit ernster Miene an. „Ich glaube, es ist Diphtherie. Gott wird ihm helfen. Halten Sie ihn warm, machen Sie ihm stündlich Wadenwickel und wechseln Sie seine Wäsche, wenn er schwitzt. Ich lasse Ihnen Chinintabletten gegen das Fieber da. Er sollte mit Salzwasser gurgeln – versuchen Sie es, auch wenn er sich wehrt. Ich kann nichts weiter für ihn tun, es wäre Sache eines Arztes. Wenn Sie Salbeitee haben – mit Honig ... Gott sei mit Ihnen!“
Die junge Frau brach in Tränen aus und schlang die Arme um ihr Kind. „Oh, mein Ignazy! Er darf nicht sterben!“ Dann sah sie mit schwimmenden Augen und erleichtertem Ausdruck die Schwester an und nahm die Tabletten entgegen. „Wenn Sie wüssten, wie dankbar ich Ihnen bin! Ich werde alles so machen, wie Sie gesagt haben. Beten Sie für mich und mein Kind!“
Der Kleine hatte die Augen verdreht und geschlossen, um in einen tiefen, bewusstlosen Schlaf zu fallen. Seine eiskalten Hände auf der weißen Bettdecke krampften sich zusammen und öffneten sich in eigenartigem Rhythmus. Emilia, die seinen Puls gefühlt hatte, wusste, dass nur noch wenig Hoffnung bestand. Aber sie wollte der Mutter nicht die letzte Zuversicht nehmen. Sie zögerte ein wenig, bevor sie zu sprechen begann.
„Mein Transport mit Kranken und Verwundeten steht auf halber Strecke. Auch viele Kinder sind dabei. Wir haben nichts zu essen – und es ist bitterkalt. Vielleicht können Sie uns helfen – ich brauche Milch ...“
„Alles, was Sie wollen, was ich habe! Kommen Sie!“, rief die junge Frau aufgeregt und zog die Schwester mit sich in die Speisekammer. „Hier, alles, was Sie brauchen, gehört Ihnen. Mein Mann konnte nicht alles mitnehmen.“ Hastig griff sie einen Korb und packte Würste und Speck hinein, dazu einen halben Laib Brot, der auf einem Holzbrett lag. Aus einer Kanne füllte sie Milch ab, mehr als die feingliedrige Schwester tragen konnte. Emilia stand, mit Korb und Kanne bepackt, an der Tür und lächelte ihr einen Abschiedsgruß zu, als die Bauersfrau sie noch einmal aufhielt. „Aber Sie, Sie selbst! Ihr Mantel ist doch viel zu dünn für die Kälte dort draußen. Hier.“ Sie nahm ihr wollenes Umschlagtuch ab und legte es um die Schultern der Schwester.
Als hätte sie an sich selbst bisher nicht gedacht, spürte Emilia plötzlich die Kälte und Erschöpfung in ihren Gliedern und die durchwachten Nächte in ihrem Kopf, der wieder zu schmerzen begann. Sie setzte sich noch einmal auf den Hocker, der vor dem Küchentisch stand, und versuchte den Schwindel zu vertreiben, der sie wegen des leeren Magens und der Anstrengung ergriffen hatte. Kaum noch spürte sie Leben in ihren Füßen, die, wund gerieben durch die Löcher in den dünnen Socken, fast nackt in den weiten Stiefeln steckten. Vorsichtig entfernte sie die gepolsterten Soldatenstiefel, die sie vor der größten Kälte schützten.
Die Bauersfrau stieß einen Schrei aus, als sie die blutigen Fersen erblickte. Rasch holte sie aus ihrem eigenen Fundus ein paar dicke gelbe Socken und legte noch ein Bündel Wolle dazu.
Emilia umwickelte die aufgeschürften Stellen mit Mullbinden und zog dankbar die dick gestrickten Socken darüber. Diese einfache Frau erschien ihr wie ein Engel, vom Himmel gesandt. Mochte ihr Sohn trotz aller schlechten Voraussichten wieder gesund werden! Sie küsste die Bäuerin in einer plötzlichen Anwandlung dankbar auf beide Wangen und machte sich schwer beladen auf den Weg.
Draußen traf sie die anderen, jeder hatte etwas ergattert. Die auf ihrem Besitz gebliebenen Menschen waren hilfreich und teilten das Letzte; wenn der Russe käme, würde er ihnen sowieso alles wegnehmen.
Die zusammengeschmolzene Division Soldaten hatte noch eine auf der Karte klein scheinende Strecke über ein flaches Landgebiet vor sich, das zur Weichsel führte. Dieses Gebiet galt es heil zu durchqueren, möglichst ohne von den feindlichen Angreifern, die sie auf der anderen Seite vielleicht schon eingeschlossen hatten, gesehen zu werden. Flüchtlingstrecks, Schlitten mit Menschen, die ihre gesamte Habe aufgepackt hatten, Karren mit einem Pferd davor und größere Gefährte, an die man Schlitten mit den Schwächeren, die nicht laufen konnten, angehängt hatte, begegneten ihnen.
Langsam bewegte sich der Zug in Richtung Fluss und in aller Augen stand die bange Frage: Wie weit ist der Russe? Ist es besser zu bleiben oder wegzugehen? Lohnt sich die Flucht? Erwartet uns der Feind nicht hinter der Weichsel? Ist er in unserem Rücken, bereit, uns auf der Stelle zu töten, wie er gedroht hat? Der versprengte Trupp Infanterie konnte diese stumme oder offene Frage selbst nicht beantworteten. Alles war ungewiss. Sie deuteten resigniert in Richtung Weichsel und antworteten müde mit dem Ausruf: „Am besten fort, weiter westwärts!“ Die Menschen senkten die Köpfe, packten ihre Habe aufs Neue und trotteten enttäuscht und in banger Angst vor der Zukunft weiter voran auf dem hart gefrorenen Boden, auf dem eine dicke Schneedecke lag.
Am Fluss waren mittlerweile Tag und Nacht Männer beschäftigt, einen stabilen Untergrund aus Eis zu bilden, über den die Flüchtlinge so sicher wie möglich hinüberkommen sollten. Die alten Brücken waren gesprengt, besetzt oder auf andere Art unpassierbar geworden, und die Vertriebenen in den vielen Trecks, die angezogen kamen, starrten mit leeren Augen auf den zugefrorenen Strom, unsicher, ob das Eis halten würde oder nicht. Obwohl man die Menschen warnte, versuchten immer wieder einige, die es besonders eilig hatten, die trügerisch glitzernde, von weitem kristallen schimmernden Fläche des Flusses zu überqueren, die aussah, als ob sie problemlos trüge; manchem Gefährt, mit dem sie sich leichtsinnig zu weit vorwagten, konnte man nicht mehr helfen, wenn plötzlich an einer fest scheinenden Scholle das Eis brach und die Flüchtenden mitsamt ihren Pferden, dem Wagen und Mann und Maus schreiend in den Fluten versanken. Einige der leichteren Kutschen, die das Wagnis unternahmen, schafften es wie durch ein Wunder, das andere Ufer unbeschadet zu erreichen – vom seltenen Glück geleitet, mit viel Mut und hoher Geschwindigkeit, bei ruhig gebliebenen Pferde, die mit aller Kraft zogen.
Die großen Pumpen arbeiteten unablässig und an einer bestimmten, flacheren Stelle des Flusses versuchte man immer wieder Wasser über die brüchigen Schollen zu sprühen, um eine feste und tragfähige Eisdecke zu bilden. Der Weg wurde endlich abgesteckt und mit großer Vorsicht ließ man jeweils nur ein Fahrzeug nach dem anderen hinüber.
Das alles nahm sehr viel Zeit in Anspruch. Die Wagen stauten sich an der Furt; manche versuchten sich vorzudrängen und es gab Unruhe und Streit. Immer wieder musste die Fahrt der Schlitten gestoppt und mit Hilfe der Pumpen neues Eis aufgesprüht werden. Obwohl man sich bemühte, nicht zu viele Fahrzeuge gleichzeitig auf die präparierte Fläche zu lassen, rumpelten manche Wagen ohne Kontrolle vor, weil die Pferde in der Mitte des Flusses in Panik lospreschten, abrutschten und vor den Augen derer, die nicht helfen konnten, im reißenden Wasser versanken. Die anderen auf dem Eis durften die Augen nicht vom Weg und den eigenen Zügeln abwenden und mußten sich angestrengt nur auf die schmale Brücke konzentrieren, die kein Geländer hatte, eisig, rutschig und voll tückischer Löcher war. An manchen Stellen rauschte der offene Strom so bedrohlich, dass bloßes Hinschauen schon Schwindel verursachte. Nicht selten gab es auf halbem Wege auf der glitschigen Bahn einen Stau, weil nervös gewordene Pferde sich weigerten, weitere Schritte vorwärts zu tun, erschreckt von dem Knacken des Eises, dem Rauschen und Brechen der Schollen und dem Gluckern des Wassers, das manchmal gar ihre Hufe umspülte. Dann saßen die Wagen in der Mitte der gefährlichen Eisbrücke fest, die hinteren drängten, Panik drohte im gesamten Zug auszubrechen und voll bepackte Schlitten rutschten zur Seite, sackten in das brechende Eis und versanken unter entsetzten Schreien in den trüben, schlammigen, mit kristallenen Brocken durchsetzten Fluten.
Die kleine Truppe der technischen Unteroffiziere und Feldwebel, die sich mühsam von der Schule für Heeresmotorisierung in Kulm bis hierher durchgeschlagen hatte, erhielt über Funk den Befehl, vorerst nicht weiterzumarschieren, sondern auszuharren, den Rückzug zu sichern und jeden Meter Bodens zu verteidigen. Jenseits der Weichsel sollten sie sich später auf Gut Kasau treffen und von dort aus die Verteidigung einer wichtigen Bahnlinie übernehmen sowie die Straße zur Festung Thorn freihalten. Das Gut war von einer Vorhut, die sich dort verbarrikadiert hatte, bereits eingenommen und wartete auf Verstärkung.
Die Männer richteten sich in einer alten, halbverfallenen Burg am Ufer des Flusses in der Nähe von Graudenz ein, ermüdet von den Strapazen, geschockt von den Bildern der Flüchtlinge und entmutigt von der Nachricht, der Russe sei schon übergesetzt und am anderen Ufer. Dort sollten noch andere Truppen zu ihnen stoßen, auch aus der Heeresmotorisierungsschule, die ebenfalls den Auftrag hatten, sich um jeden Preis bis zum Letzten zu verteidigen. Außerdem musste der große Treck der Flüchtlinge, besonders der schwierige Übergang über die Weichsel, von den Soldaten organisiert und zum Teil begleitet werden. So hatte es sich Hitler auf dem Papier, auf seinen Plänen, zurechtgelegt. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Täglich spielten sich die erschütterndsten Szenen eines schrecklichen Dramas am Ufer des Flusses ab, eines Schauspiels, auf das die Soldaten bei allem guten Willen wenig Einfluss hatten. Sie sicherten die Festung nach Kräften und legten sich ein Lager aus Vorräten an, die aus den vielen öden, im Stich gelassenen Gehöften nicht schwer zu beschaffen waren.
Der Zug nach Stolp konnte seinen Weg mit neuem Brennstoff ungehindert fortsetzen. Emilia hatte trotz Übermüdung und Erschöpfung ihren mühsamen Rundgang durch die Waggons wieder aufgenommen und verteilte die Lebensmittel, die den Flüchtlingen neuen Mut und frische Kraft verliehen. Die Leute brauchten sie, ihre Medikamente, das Essen und auch Trost und Zuspruch.
Die junge Frau, die bisher stumm neben ihr gesessen hatte, schüttelte nur ängstlich den Kopf, als sie ihr Milch für ihr Kind reichen wollte. Aber dann konnte sie die ungeheure Beherrschung, zu der sie sich zwang, nicht mehr länger aufrecht halten. Über ihre Wangen liefen plötzlich die zurückgehaltenen Tränen und sie schluchzte laut und herzzerreißend auf, während sie das Kind, auf dessen Gesichtchen schon die Totenblässe stand, an sich presste. Vorsichtig versuchte Emilia, ihre verkrampften Hände von dem Körper des starren Wesens in ihrem Arm zu lösen. „Geben Sie mir das Kind! Ich weiß, dass es schon seit Stunden tot ist. Sie müssen es hergeben – ich kann nicht zulassen, dass Sie es behalten!“
„Nein!“, schrie die Mutter in unnennbarem Schmerz auf und stieß die Schwester zurück. „Ich gebe es nicht her! Ich ertrage es nicht, dass man meinen kleinen Schatz so einfach an den Wegrand in den Schnee legt, wie es mit den anderen Kindern geschieht. Ich will ihn mitnehmen und ordentlich begraben. Ich bitte Sie, haben Sie Mitleid mit mir, mit einer Mutter, der das Wertvollste genommen wurde, das sie besitzt!“
Neuerliches Schluchzen erschütterte die Brust der armen Frau, die sich von ihrem toten Kind nicht trennen wollte, und Emilia spürte in aller medizinischen Abgebrühtheit, in dem unnennbaren Schrecken und bei all dem unbegreiflichen Elend um sie herum, mit dem sie täglich konfrontiert war, heißes Mitleid in sich aufsteigen. Dieser Krieg war schrecklich, erbarmungslos und grausam. Es traf doch nur die Unschuldigen! Konnte sie einer Mutter ihr Kind entreißen? Aber die Vorschriften schrieben es ganz klar vor – was sollte man denn mit all den toten Kindern machen, die unterwegs starben, die erfroren und an Entkräftung und Krankheit zugrunde gingen? Wenn jede Mutter so dächte, würden bald Seuchen ausbrechen und sie alle wären verloren.
Die Schwester zögerte, Unsicherheit lag in ihrem Blick. „Behalten Sie es, aber sagen Sie niemandem etwas davon. Tun Sie wie bisher so, als sei der Kleine noch am Leben und nur eingeschlafen.“
Die junge Frau ergriff weinend die Hand der Schwester und bedeckte sie mit Küssen. „Ich danke Ihnen, Gott wird Ihnen alles vergelten! Ich bete für Sie, Sie haben ein Herz!“
Völlig erschöpft, am Ende ihrer Kräfte, kauerte die junge Schwester sich wieder auf ihrem Sitz zusammen, um augenblicklich in einen dumpfen, bleiernen Halbschlaf zu fallen, eingelullt von dem steten Rattern des fahrenden Zuges, doch mit einer gewissen Wachsamkeit des Unterbewusstseins, die sie in einen ständigen unbewussten Alarmzustand versetzte, bereit, jeden Moment fluchtbereit aufzuspringen.
Vor den Fenstern der halbverfallenen Burg am Ufer der Weichsel dämmerte kalt und grau der Morgen herauf, als Conny, der beim Wachehalten für Sekunden vor Ermattung eingenickt war, bei einem kratzenden Geräusch hochschreckte und seinen Karabiner in Anschlag brachte. Er sprang auf und seine halb eingeschlafenen Füße, die er tagsüber mit Lappen umwickelte, um sie vor der Kälte zu schützen, schlotterten ausgepackt in den weiten, viel zu großen Armeestiefeln und verursachten ein hallendes, schlurfendes Geräusch auf dem Steinboden des weiten Gewölbes, in das man alle Möbel zusammengetragen hatte, die man in der alten Festung finden konnte. Auf Stühlen, Truhen, alten Tischen hatten sich schlafende Soldaten, die nach den unendlichen Anstrengungen der letzten Zeit in fast bewusstloser Lähmung wie hingemäht darnieder lagen, in Vorhänge und Teppiche gewickelt, um nicht auf dem kalten Steinboden übernachten zu müssen. Vorsichtig blickte der Soldat durch die kleinen Fenster und Schießscharten – doch draußen zeigte sich kein Leben, schien alles verlassen, kalt und öde. Aber Achtung, das konnte ein Trick der Russen sein. Man hatte ihnen gesagt, sie müssten mit allem rechnen. Mit schmerzenden, taub gewordenen Gliedern nahm er vorsichtig die paar Stufen zu der dicken verrammelten Eichentür, hinter der das kratzende Geräusch, das sich zu einem Klopfen verstärkt hatte, lauter zu vernehmen war, „Wer da?“, rief er mit rauer, grober Stimme durch die Tür hindurch.
Eine Frauenstimme antwortete in unverständlichem Mischmasch aus russischem Dialekt und deutschen Worten in hellem, verzweifeltem Ton, aus dem er nur das Wort „Hilfe“ her aushörte.
Sollte das etwa eine Falle sein? Wenn er jetzt die Tür öffnete, wären er und die Kameraden vielleicht verloren. Er blieb unbeweglich stehen und horchte dem Gejammer vor der Tür, in das sich noch eine zweite Frauenstimme mischte, die das deutsche Wort „Essen“ prononcierte. Ja, er hörte ganz deutlich: „Hier Essen, wir Freunde.“ Es kam oft vor, dass versprengte Polinnen oder Wolgadeutsche, halb deutsch, halb russisch, Frauen, die die Orientierung in ihrem Leben verloren hatten, sich aus irgendeinem Grund deutschen Soldaten anschlossen, ihnen zu Diensten waren und ihnen halfen, aus unerfindlichen Gründen – sei es, dass ihre weiblichen Seelen fasziniert von diesen fremden blonden Männern waren, die nicht die raue Grobschlächtigkeit ihrer russischen Gefährten an den Tag legten, von denen sie misshandelt und geschlagen wurden, sei es, dass sie ihre Familie in den Wirren des Krieges verloren hatten, ihre deutschen Wurzeln suchten und nicht wussten, wohin. Manchmal nutzten sie auch die Gelegenheit, um aus unerträglichen Situationen der Leibeigenschaft auszubrechen, in denen man sie ausnützte, und schlossen sich als eine Art Marketenderinnen den Soldaten an, mit denen sie das Essen teilten, für die sie sorgen konnten und die glücklich über ihre Gesellschaft waren. Conny lief zum Fenster und spähte erneut hinaus. Er klopfte an die Schreibe und schrie: „Komm hierher – sehen – ich will euch sehen!“
Es waren nicht nur zwei Frauen, sondern ein ganzes Grüppchen, das sich, mit Körben und Bündeln beladen, vorsichtig nach allen Seiten spähend, langsam näherte. Die Mutigste von ihnen, ein vollbusiges Weib mit langen schwarzen, wild herabhängenden Haaren, kam entschlossen heran, die Hände mit einer flehenden Gebärde ausstreckend und dann theatralisch ans Herz drückend. Sie deutete auf die Körbe und führte die Hand mit einer Bewegung des Essens zum Munde.
Der Soldat öffnete das enge Fenster nur einen Spaltbreit und sicherte sich mit seiner Waffe. Man hatte eine gute Aussicht von der Festung, die auf einem leichten Hügel lag, von dem man die Umgebung bis zum Fluss ausgezeichnet überblicken konnte. Weit und breit war keine feindliche Bewegung zu sehen. „Wartet!“, schrie er hinaus, schloss das Fenster und stieg so schnell wie möglich die steilen Treppen des Turmes hinauf, um oben in alle Himmelsrichtungen schauen und ganz sicher sein zu können, dass kein Hinterhalt im Spiel war.
Inzwischen waren einige der anderen Soldaten erwacht und kamen verschlafen und neugierig herbeigeeilt. Frauen waren immer eine angenehme Abwechslung, sie kochten, kümmerten sich um die Wäsche, brachten Schnaps mit, waren zärtlich und belebten das karge Leben auf unerwartete Weise. „Wenn sie gut aussehen, kannst du sie reinlassen!“, schrie der plumpe Oberleutnant Otto, der Abenteuern nie abgeneigt, aber bei Frauen wegen seiner kurzen Beine nicht sehr beliebt war, mit verschlafener Stimme und glättete eitel seine wirr vom Kopf abstehenden Haare. Neugierig hatten sich die meisten Soldaten ächzend erhoben und ordneten ihre Uniform.
„Was soll ich machen?“, rief Conny fragend in die Runde und sah den Kommandanten an, der die Achseln zuckte. „Sie wollen uns was zum Essen bringen. Das Gelände um die Burg ist verlassen. Niemand zu sehen – nichts Verdächtiges.“
„Lass sie rein! Ich hab einen fürchterlichen Kohldampf – wir haben doch schon seit Tagen nichts richtig Gekochtes mehr zwischen die Zähne gekriegt“, rief der kleine Alfons aus und versetzte dem ausgefransten Teppich, der vom Tisch gefallen war, einen Tritt.
„Halt!“, ging Willi dazwischen, „vielleicht wollen sie uns hier ausräuchern und vergiften.“
Brüllendes Lachen antwortete ihm. „Das glaubst du wohl selbst nicht. Unser kleiner Haufen ... Wer soll schon wissen, dass wir gerade hier sind? Da müssten sie viele Frauen losschicken.“
„Na gut, mal sehen, was sie uns bringen wollen.“ Conny nahm den Karabiner, schob den Riegel beiseite und öffnete die Tür einen Spalt. „Wie heißt du?“, rief er mit strenger Stimme und musterte die kecke Schwarzhaarige, die ihr Schultertuch ein wenig öffnete und verlockend schimmernde Haut am Ansatz eines üppigen Busens sehen ließ.
„Marja Warintschkaja.“ Sie lächelte mit weißen Zähnen und ihre schwarzen Augen über den roten Wangen blitzten mutwillig. „Ich bring euch frische Eier – hier, wenn ihr wollt.... Und ein wenig Speck.“ Sie hielt den Korb hoch, den sie im Arm getragen hatte, und lüpfte eine Ecke des Tuches, das darüber lag. Conny lief das Wasser im Munde zusammen, er öffnete die Tür und machte eine einladende Handbewegung, „Gut, kommt rein – aber nur, wenn ihr uns ein nettes Frühstück macht!“ Marja nickte und winkte den anderen Frauen, die abwartend im Schnee standen.
Hinter Connys Rücken waren die Kameraden neugierig zusammengelaufen und blickten auf die Frauen, die wie selbstverständlich über die Schwelle traten, ihrerseits mit unverhohlenem Interesse die Gesichter der Männer betrachtend, die grinsend die fünf Frauen abschätzten, sie insgeheim schon unter sich aufteilend. Murmelnd strichen sie sich das wirre Haar zurück und rückten die Kragen gerade. „Da ist wenigstens was dran, an den Russinnen“, flüsterte der dünne Hans feixend, „nicht so wie bei uns – diese Knochengerüste!“ „Das musst gerade du sagen“, antwortete sein Kamerad mit ironisch abschätzigem Blick auf seine schlotternde Jacke und das viel zu weite Hemd, das ihm hinten aus der Hose hing. „Das ist doch mal eine nette Überraschung“, rief der verschlafene Bodo aus, der gerade erst seine Augen aufgemacht hatte, „jetzt wird es hier ja richtig gemütlich!“
Marja machte den anderen Frauen ein Zeichen, ging lächelnd durch die Reihen gaffender Soldaten und stellte den Korb auf den Tisch. Die anderen taten es ihr nach und unter den staunenden Blicken packten sie die Schätze aus, die sich in ihren Bündeln und Körben befanden. Mit Gesten und gebrochenen Worten gab Marja zu verstehen, dass sie und die anderen Frauen von nun an gern bei ihnen bleiben und mit ihnen ziehen wollten. Ihre Männer waren gefallen oder verschollen, ihre ganze Habe war verloren und sie wussten nicht, wie sie sich weiter fortbringen sollten. Wenn der Krieg zu Ende war, würde sich schon etwas finden; aber jetzt – jetzt fühlten sie sich ohne männlichen Schutz verloren. Sie wussten nicht wohin, wollten aber über den Fluss.
„Wo kommt ihr denn her?“, fragte Willi, dem die Frauen immer noch nicht ganz geheuer waren, und sah eine Rundliche, noch sehr jung und schüchtern Scheinende, an. „Wie heißt du?“
„Sonja“, stotterte die Kleine, senkte die Augen und nestelte an ihren zusammengesteckten Zöpfen, während eine Blutwelle ihr in die runden Pausbacken stieg. Dann hob sie den Blick und nahm eine bauchige Flasche aus ihrem Bündel, in der sich eine dunkle Flüssigkeit befand.
„Ahhh!“ Aus den Kehlen der Soldaten, die sich um die Frauen gedrängt hatten, erklang beifälliges Gemurmel. „Rübenschnaps, nicht schlecht. Den brennt ihr doch selbst, nicht wahr? Das wird uns an den eisigen Abenden ein wenig erwärmen!“
„Ein gutes Schlafmittel außerdem, lass doch mal sehen!“ Otto griff nach der Flasche, doch Kommandant von Lehnsberg, der herantrat, strafte ihn mit wütendem Blick, so dass er die Hand auf der Stelle sinken ließ.
„Ruhe! Ich bitte um Disziplin! Die Frauen können von mir aus bleiben. Aber keine Dummheiten! Das wäre ja noch schöner, eine Sauferei – da könnte man uns gleich mühelos einkassieren, wenn wir uns auf den Weg machen. Wir dürfen unser militärisches Ziel nicht aus den Augen verlieren. Der Russe hat auf der anderen Seite schon die Brückenköpfe besetzt; also müssen wir noch vor dem Tauwetter über die Weichsel kommen. Aber vorerst bleibt uns nichts anderes übrig als hier auszuhalten und zu helfen, die Flüchtlinge geordnet rüberzubringen – Befehl vom Hauptquartier! Die Verstärkung aus der Heeresmotorisierungsschule, die uns ablöst, kann ja jeden Augenblick eintreffen.“
„Wer’s glaubt ... Ausgerechnet wir müssen den Kopf hinhalten“, murrte Willi aufbegehrend. „Die anderen sind schon längst drüben und können in aller Ruhe abhauen.“
„Schluss jetzt, Maul halten!“, schrie ihn von Lehnsberg, dem die Zweifel an seinen eigenen Worten ins Gesicht geschrieben standen, unbeherrscht an.
Die Frauen wichen zurück. Dumpfes Schweigen breitete sich aus und der Kommandant atmete schwer. Die Männer waren verunsichert und hatten Angst, das spürte er. Nach einer kurzen Pause sagte er ruhiger, mit einem Blick auf die vollen Körbe der eingeschüchterten Frauen: „Nun gut, durchsucht sie. Dann könnt ihr sie dort oben Frühstück machen lassen, wenn ihr wollt. Zeigt ihnen die Kochgeschirre im Waffenraum und den Saal mit dem Kamin. Wir haben etwas Holz für ein Feuer, das könnte vorerst genügen.“
Die Frauen, denen man die Erleichterung darüber ansah, dass sie bleiben durften, zogen sich leise und aufgeregt miteinander tuschelnd zurück und folgten Conny, der sie in die große Halle begleitete, wo das Regiment seine Ausrüstung aufbewahrte und Vorräte lagerte. Aus den verlassenen Gehöften hatten sie mitgeschleppt, was sie an Proviant nur tragen konnten. Doch das Hinunterschlingen von kalten Schinkenstücken bekam dem Magen nicht so recht und so waren sie froh über die Aussicht auf eine warme Mahlzeit. Außerdem gab es eine Menge zu flicken und Löcher im Armeezeug zu stopfen; da hätten die Frauen wirklich genug Arbeit.
„Männer!“ Die Stimme des Kommandanten hallte in den steinernen Wänden der Räume und versuchte sich in dem Stimmengewirr, Lachen und Schreien noch einmal Bahn zu brechen. „Stillgestanden! Haltung einnehmen!“
Schlagartig gehorchten die Soldaten, lichtete sich das heillose Durcheinander. Die Disziplin, die sie alle gelernt hatten, war das Einzige, was sie überleben lassen konnte.
„Ihr wisst, was zu tun ist! Wir warten auf ein Ersatzbataillon der Heeresgruppe Weichsel, das jetzt unter Oberbefehlshaber Himmler steht, und bis dahin haben wir den Befehl, die letzten Flüchtlinge sicher über den Fluss zu geleiten. Und dem werden wir nachkommen. Die Kameraden, das Vaterland verlässt sich auf jeden Mann. Einer für alle, alle für Einen!“
„Heil! Heil Hitler!“, entrang sich allen Kehlen der gewohnte Ruf eingedrillten Gehorsams, obwohl die meisten nicht mehr von dem Heil, das er bringen sollte, und ebenso wenig von seinem guten Stern überzeugt waren. Sie hofften jetzt einzig und allein, wenigstens ihren eigenen Hals zu retten und aus dieser Eiswüste noch einmal lebend herauszukommen. Im Führerhauptquartier konnte man gut Befehle erteilen; sie aber waren die Dummen, auf ihrem Rücken sollte der Kampf ausgetragen werden. Warum mussten ausgerechnet sie den Rückzug der Flüchtlinge sichern und warten, bis der letzte Mann über den Fluss war? Wenn die versprochene Verstärkung ausblieb, wären sie völlig hilflos der Übermacht der Russen ausgeliefert, die sie dann in aller Ruhe auf der anderen Seite erwarten und abschlachten konnten. So sah es aus – sie sollten ganz einfach geopfert werden!
Doch niemand wagte diese aufrührerischen Gedanken laut auszusprechen. Schließlich konnten sie die armen Menschen, die sich mit ihrer ganzen Habe auf den Weg ins Ungewisse gemacht hatten, nicht im Stich lassen. Die Ehre des Soldaten gebot, die Zivilbevölkerung zu schützen und bis zum letzten Atemzug zu kämpfen!