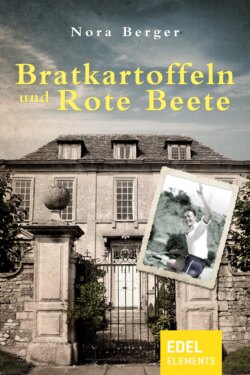Читать книгу Bratkartoffeln und Rote Beete - Nora Berger - Страница 8
IV. Kapitel Blinde Flucht
ОглавлениеAls der Zug in Stolp einlief, atmete Emilia erleichtert auf. Sie hätte nicht gedacht, dass sie diese Höllenfahrt lebend und gesund überstehen würde. Immer in der Angst vor einem Überfall, musste der Lokführer den Zug unterwegs noch ein paarmal anhalten; einige Passagiere – Alte, Verwundete und vor allem Kinder – überlebten die Strapazen nicht; man legte sie, der Not gehorchend, einfach in den Schnee und setzte die Fahrt fort. Die junge Frau, die ihr Kind nicht hergeben wollte, hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und die Schwester gab ihr wie vielen anderen, die auf irgendeine Weise durchdrehten, eine starke Dosis Veronal; aber selbst dann ließ sie ihr totes Kind nicht los, das sie in einem eigenen Grab beisetzen wollte. Emilia ließ sie gewähren; man hätte es ihr mit Gewalt wegreißen müssen, und das brachte sie nicht übers Herz. Mit ihrer Elendsschar im Lazarett des Roten Kreuzes angekommen, fiel sie in dem ihr zugewiesenen Zimmer in einen bleiernen Schlaf, betäubt, aber gequält von schrecklichen Träumen, in denen sie noch das Rattern des Zuges spürte, den leidvollen Ausdruck auf den Gesichtern der Menschen und den verzerrten der Sterbenden vor sich sah. Oft schreckte sie hoch und fand schließlich gar keine Ruhe mehr. Von trüben Vorstellungen heimgesucht, wälzte sie sich den Rest der Nacht hin und her.
Mehr als alles andere beunruhigte sie der Gedanke an ihre Eltern, die vielleicht mit ihrer kleinen Schwester Eleonore, mit Pferd und Wagen und dem treuen Knecht Franz genau wie alle anderen irgendwo auf dem Weg in den Westen waren. Wo mochten sie jetzt sein? Oder waren sie noch in Waltersdorf geblieben, dem Ort ihrer letzten Ansiedlung? Im Lazarett, in der Auffangstelle der Flüchtlinge, hatte man nichts von ihnen gehört.
Das Umschlagtuch der polnischen Bäuerin um ihre Schultern geschlungen, machte sich Emilia am nächsten Morgen erneut auf den Weg zum Bahnhof in Stolp, an dem sich neue Trecks mit Flüchtlingen sammelten, die ihre Angehörigen suchten. Sie drängte sich durch die Stadt, die von Menschen wimmelte, wendete sich unerschrocken an Gruppen verhärmt aussehender Soldaten, die mit weißen Verbänden umherhumpelten, immer mit der einzigen Frage auf den Lippen, die sie unablässig wiederholte: „Familie Reich aus Waltersdorf – haben Sie sie gesehen?“ Manchmal glaubte sie bekannte Gesichter zu erspähen, Menschen, die ihr schon einmal begegnet waren; doch jeder, den sie ansprach, schüttelte nur bedauernd den Kopf.
Entmutigt setzte sie sich auf einen Pfosten am Wegrand und starrte vor sich hin. Es war alles so sinnlos! Vielleicht waren sie schon tot – überfallen, erfroren, verletzt ... Sie wagte nicht weiterzudenken. Mit schweren Gliedern erhob sie sich und ging traurig und mit Tränen in den Augen den Weg ins Hospiz zurück.
Das Lazarett war völlig überfüllt. Immer weitere Neuzugänge von verletzten, zusammengeschossenen, an Entkräftung erkrankten Soldaten wurden eingeliefert. Man konnte ihrer kaum Herr werden, am wenigsten der ganz schlimmen Fälle, denen man ein Bein oder einen Arm amputieren musste. Es gab einfach nicht genügend Ärzte und Schwestern. Die strenge, aber gutmütige Oberschwester Paula, die seit Tagen ohne Pause arbeitete, ließ Emilia eines Tages auf ihr Zimmer rufen.
„Sie wissen, mein Kind, dass ich Sie hier nicht länger behalten kann, sosehr ich Sie brauchen würde! Aber Sie haben ja jetzt schon Erfahrung und ich wüsste niemanden, dem ich den nächsten Transport nach Waren anvertrauen könnte. Hier ist alles überfüllt, ich habe niemanden und mir wächst allmählich alles über den Kopf. Dort gibt es ein gutes Lazarett und ich kann einen Teil der Verwundeten mit Ihnen hinschicken. Glauben Sie mir, wenn ich Ihre Eltern sehe, werde ich Ihnen Nachricht geben, irgendwie, Sie können sich auf mich verlassen.“
Die junge Schwester brach in Tränen aus. „Ich kann nicht weiterfahren, ich kann einfach nicht nach Waren, bevor ich nicht weiß, was mit meiner Familie geschehen ist. Vielleicht sind sie noch gar nicht fort! Meine Mutter ist ganz allein mit meiner kleinen Schwester, sie ist erst acht Jahre! Wenn ihnen etwas geschehen ist, wenn sie meine Hilfe brauchen ...“, stammelte sie, das Schluchzen unterdrückend; ihre Stimme zitterte. Mitleidig sah die Oberschwester sie an. „Aber so wie Ihnen geht es doch vielen Menschen hier. Wie soll ich Ihnen denn helfen? Sie wissen doch, ich darf es gar nicht!“ Sie schwieg und sah zu Emilia herab, die den Kopf gesenkt hatte und leise weinend den Rest der Beherrschung verlor, die sie all die letzten Tage so vorbildlich aufrechtgehalten hatte. Schwester Paula schien zu überlegen und schließlich begann sie zögernd: „Gut, wenn Sie nicht weiter wollen, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag.“ Emilia hob den Kopf und sah sie abwartend an. Entschlossen fuhr die Schwester fort: „Fahren Sie zurück zum Lazarett, zum Kloster nach Kulm! Ich wüsste niemanden, dem ich mehr vertrauen würde. Doch es ist allein Ihre Entscheidung. Begleiten Sie den neuen Flüchtlingstreck hierher! Sie wissen doch, dass das Kloster sich wieder gefüllt hat, mit verletzten Menschen und Soldaten, die auf Hilfe warten, die versuchen, dort noch wegzukommen. Sie kennen sich aus, Sie haben es schon einmal geschafft! Aber ich sage Ihnen gleich, es ist gefährlich, es wird schwerer als vorher und es ist möglich, dass der Zugverkehr ganz eingestellt wird, weil die Gleise stellenweise durch Gefechte zerstört sind; dann bleiben nur Schlitten, Pferd und Wagen. Der Russe hat, den neuesten Nachrichten zufolge, mehrere Brückenköpfe der Weichsel besetzt, das heißt, es ist nicht sicher, ob noch eine Brücke passierbar ist. Die Flüchtlinge, die jetzt auf dem Weg sind, müssen sehen, wie sie über den Fluss kommen. Angeblich hat man sogar eine Eisbrücke gebaut. Und wenn der Zug nicht mehr fährt – und mit dieser Möglichkeit müssen Sie ebenfalls rechnen –, gibt es auch für die Kranken und Verletzten aus dem Lazarett nur noch diesen einen Weg.“ Sie machte eine Pause und sah Emilia fest an. „Wenn Sie es wagen wollen ... Aber ich warne Sie ausdrücklich, Sie begeben sich in Lebensgefahr, von den Strapazen ganz zu schweigen, das sollten Sie wissen. Entscheiden Sie sich! Es ist eine sehr schwere Aufgabe für eine junge Frau wie Sie. Ich weiß nicht, ob Sie die Kraft haben, noch einmal ...“
Emilia sprang auf, ihre Tränen waren mit einem Mal getrocknet. „Ich habe die Kraft – ich habe Kräfte für zwei! Ich bin jung – Sie können mir vertrauen. Lassen Sie mich zurückfahren! Ich fühle, dass meine Eltern in Gefahr sind, dass sie mich vielleicht brauchen – vor allem meine kleine Schwester Lorchen, sie hängt so an mir!“
Die Oberschwester konnte ein Lächeln nicht ganz verbergen. „Wenn alle so wären wie Sie ...“, sagte sie nur, ohne den Satz zu vollenden, und wandte sich ab. Ihre Gestalt straffte sich. „Aber jetzt genug der Sentimentalitäten. Wenn Sie sich entschlossen haben, wollen wir keine Zeit verlieren. Gott schütze Sie! Hier ist Ihr Ausweis. Ich lasse Ihre Medikamententasche auffüllen. Nehmen Sie mit, was Sie nur tragen können, und seien Sie sparsam! Im Notfall machen Sie von den Schlaftabletten, dem Veronal, Gebrauch – das einzige Mittel, das reichlich vorhanden ist. Ich wünsche Ihnen Glück – und mögen Sie Ihre Eltern finden! Sollten sie bei uns eintreffen, gebe ich Ihnen, so Gott will, irgendwie Bescheid.“ Sie reichte ihr mit kurzem Druck die Hand und wandte sich zur Tür. Dann drehte sie sich noch einmal zögernd um, als müsste sie überlegen. „Warten Sie!“ Aus dem engen Kragen ihrer Bluse nestelte sie eine Kette, an der ein schlichtes Kreuz hing, in das eine schmale Metallhülse eingearbeitet war. Beim Öffnen trat eine unscheinbare Kapsel zu Tage. „Hier – das gehört mir, ich habe es mir aufgehoben. Aber jetzt möchte ich es Ihnen geben. Ein sehr schnell wirkendes Gift. Wenn Sie einmal nicht mehr weiterwissen ... Man muss auch an das Schlimmste denken. Sollten Sie in die Hände der Russen fallen ... Sie wissen, zu welchen Grausamkeiten sie fähig sind und was bereits geschehen ist, besonders mit Frauen. Tragen Sie das an Ihrer Brust und im alleräußersten Notfall werden Sie nicht leiden müssen.“ Mit einer raschen Bewegung verschwand die Kapsel wieder in der Hülse und sie streckte die Hand aus, auf deren Fläche das Kreuz in mattem Glanz unschuldig schimmerte.
Vorsichtig und furchtsam nahm Emilia das gefährliche Geschenk an sich und drückte der Oberschwester mit einer intuitiven Gebärde einen Kuss auf die Hand. Dann legte sie sich ehrfürchtig die Kette um den Hals.
„Gehen Sie mit Gott – er wird Sie schützen.“ Die Oberschwester ging, den Kopf gesenkt, zur Tür, ihre Gefühle verbergend.
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen“, rief die junge Frau ihr nach. Neue Hoffnung keimte in ihr auf und hastig raffte sie das Wenige zusammen, das sich in ihrem Zimmerchen befand, bereit, den Weg, den sie unter so vielen Mühen bis hierher zurückgelegt hatte, aufs Neue zu gehen.
In dem alten Burggemäuer an der Weichsel unweit von Graudenz, in dem sich das Bataillon Soldaten verbarrikadiert hatte, blieb man zunächst unbehelligt. In einem der großen Kamine in der Vorhalle wurde ein Feuer unterhalten und eine Art Feldküche eingerichtet, in der die fünf Frauen sich mit Eifer nützlich machten. Jede hatte sogleich ihren Beschützer und Freund gefunden, und die schwarzhaarige Marja schloss sich vom ersten Moment dem blonden Conny an, der ihre Bemühungen lächelnd tolerierte. Ihre bedingungslose Verehrung verstärkte sich, je mehr er sie auf Abstand hielt. Ein Wort von ihm genügte und sie war da. Seine Sachen hielt sie in tadelloser Ordnung, er bekam die besten Bissen und sie hatte immer einen Schluck des selbst gebrannten Rübenschnapses für ihn, wenn er, durchgefroren von den Hilfseinsätzen am Fluss, in die Festung zurückkehrte.
Am Strom spielten sich unbeschreibliche Szenen ab; sie verfolgten die Soldaten bis in ihre Träume. Sie hatten Befehl, die Stellung zu halten und den Übergang der Flüchtlinge zu sichern. Aber konnten sie ohne die Verstärkung, die immer noch auf sich warten ließ, mit der kleinen Schar und den wenigen Waffen einen Panzerangriff des Feindes im Notfall wirklich abwehren? Zum Glück wusste der Russe nicht, wie unklar und bedrängend die Lage für die Deutschen wirklich war und wie viele Divisionen sich überhaupt noch zwischen Kulm und der Tuchler Heide befanden.
Die Zeit verstrich, die frischen Truppen, die angekündigt waren, blieben aus, Munition, alles ging zur Neige und es mangelte an Treibstoff. Je mehr widersprüchliche Funkmeldungen über die Lage des Widerstandes eintrafen – haarsträubende Geschichten, die von den entsetzten, blind drauflos Flüchtenden über schreckliche Gräueltaten der Russen erzählt wurden, die nicht davor zurückschreckten, Frauen zu vergewaltigen, Männer zu entmannen und sie mit Panzern zu überrollen –, umso stärker wurde in dem versprengten Trupp das Misstrauen gegen den Befehl, vor Ort auszuharren. Es gab kaum einen unter ihnen, der sich nicht darüber klar war, dass sie wohl kaum noch eine Chance haben und letztendlich nur als Kanonenfutter dienen würden.
„Ich hau ab“, sagte Willi eines Abends leise zu seinem Kameraden. „Kommst du mit?“
Conny schüttelte zweifelnd den Kopf. „Wir müssen unsere Pflicht tun. Du weißt doch: Wenn sie uns erwischen, werden wir sofort erschossen. Wie sollen wir ohne schriftlichen Einsatzbefehl in der Gegend herumirren? Dann ist alles aus. Wenn wir nicht den Russen in die Hände fallen, werden wir von den Unseren wegen Fahnenflucht aufgeknüpft.“
Der Freund stieß einen unterdrückten Seufzer aus. „So und so kommen wir hier nicht mehr lebend raus. Wir sitzen im Grunde doch in der Mausefalle. Wie sollen wir uns ohne Vorräte, ohne Nachschub weiter verteidigen können, wenn wir wirklich angegriffen werden? Du siehst doch, dass bis jetzt kein einziges Regiment aufgetaucht ist. Wo bleiben die denn? Wir sind die letzte Nachhut – verloren, abgeschoben, eingekesselt!“
Conny schwieg. Natürlich hatte der Freund Recht. Aber sollten sie wirklich alles im Stich lassen, die Flüchtenden dem ungewissen Schicksal kommenden Tauwetters an der Weichsel, dem herandrängenden Feind überlassen? War es denn ihre Schuld, musste man sich für einen solchen Irrsinn denn selbst opfern? Sollten sie deshalb mit untergehen? Conny schob die bedrückende Frage einfach beiseite. „Und wie stellst du dir das vor? Wie sollen wir unauffällig über die Weichsel kommen?“
„Wir müssen einzeln weg. Wir hängen uns an irgendeinen Panjewagen und jeder versucht sich allein durchzuschlagen. Später, auf der anderen Seite, treffen wir uns wieder. Wenn wir zu einer anderen Truppe stoßen, erklären wir einfach, wir seien versprengte Ingenieure von der Heeresmotorisierungsschule. Die anderen von da sind ja auch nicht gekommen – wahrscheinlich auf die gleiche Art abgehauen. Wir müssen es riskieren. Bis dahin heißt es allerdings vorsehen und die Gelegenheit ergreifen, wenn sie sich gerade ergibt.“
Plötzlich fand sich Willi beim Kragen gepackt und sah in das bleiche Gesicht des Kommandanten, der schon seit ein paar Tagen krank schien und über starke Durchfälle klagte. Das fehlte noch, dass unter den Leuten die Ruhr ausbrach! „Verräter!“, stieß er mit zusammengebissenen Zähnen hervor. „Dafür gehörst du standrechtlich erschossen!“
Willi sprang auf. Er spürte, dass im Blick des Kommandanten die gleiche Angst, das gleiche Zögern und die Gewissheit der Aussichtslosigkeit lagen, die auch er empfand. „Herr von Lehnsberg, glauben Sie denn wirklich daran, dass wir hier noch lebend rauskommen? Wenn Sie das wirklich denken, dann bleibe ich und erfülle meine Pflicht bis zum letzten Atemzug. Aber wenn ich meine Meinung sagen darf – wir haben den Krieg verloren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“
„Schweigen Sie!“ Der Kommandant drehte sich weg und in seinem Gesicht arbeitete es. Ein Würgen überkam ihn, er stürzte hinaus.
Willi warf seinem Kameraden einen bedeutsamen Blick zu und flüsterte: „Er hat es schon kapiert, das siehst du doch. So grün, wie er aussieht, wird er es eh nicht mehr lange machen – mit oder ohne Durchhalten hier drin.“
Marja hatte sich mit einer Schale in der Hand vorsichtig genähert und lächelte den Soldaten zärtlich an. „Trink! Du wirst vergessen.“
Conny schüttelte den Kopf und machte eine abwehrende Handbewegung. Er wollte nicht vergessen, wollte sich nicht betäuben, er wollte leben und einen klaren Kopf behalten. Es stimmte, Willi hatte Recht, sie mussten so bald wie möglich hier weg – hier waren sie keineswegs in Sicherheit, sondern sie saßen in der Falle. Mit dem kranken Kommandanten war nicht mehr zu rechnen. Vielleicht konnte man sich selbst bis zum nächsten Bataillon auf Gut Kasau jenseits der Weichsel durchschlagen, hinten in der Tuchler Heide, wohin sie ohnedies anfangs abkommandiert waren. Es klänge durchaus plausibel, dass man bei einem Feindangriff versprengt worden war. Wer kannte sich in dem Durcheinander schon noch aus?
Er wandte sich mit gedämpfter Stimme an die junge Frau, die ihn mit großen, dunklen Augen ansah, die Schale enttäuscht in der Hand. „Marja, du packst Vorräte ein, verstehst du? Heimlich, ohne jemandem was zu sagen. Essen, so viel es geht! Wir müssen weg. Auch du und die Frauen, ihr könnt nicht bei uns bleiben. Wir sind alle in Gefahr. Geht, geht weg von uns, verschwindet! Hier in der Festung seid ihr genau wie wir verloren. Und draußen können wir jetzt keine Rücksicht auf euch nehmen, da müssen wir uns alleine durchschlagen!“
In Marjas Augen traten Tränen und ihr Gesicht verzerrte sich. „Ich nicht weggehen!“, stammelte sie in ihrem gebrochenen Deutsch. „Ich bleibe mit dir. Ohne dich – nein!“ Sie schüttelte energisch und bestimmt den Kopf.
„Aber ich kann dich nicht mitnehmen, sieh das doch ein! Du musst selber sehen, wie du zurechtkommst.“ Der Soldat wurde wütend und schob die junge Frau fort, die sich an seinen Hals werfen wollte. „Sieh es doch ein – ich werde mich verstecken müssen! Was soll ich da mit dir?“
„Dann ich folge – in Abstand, du musst nicht achten auf mich.“ Marja warf ihre schwarzen Strähnen zurück, die ihr im Eifer ins Gesicht gefallen waren, und streckte flehend die Hände aus. „Njet, bitte – njet.“
Conny presste die Lippen zusammen; jedes weitere Wort war überflüssig. Er flüsterte Willi zu: „Es ist sinnlos. Wir werden uns irgendwann, wenn sich die Gelegenheit ergibt, einfach wegschleichen, dann löst sich das Problem von selbst. Du hast Recht – irgendein Panjewagen auf der Eisbrücke, an den hängen wir uns dran, dann soll man uns mal suchen in dem Gedränge. Wenn wir erst auf der anderen Seite sind, schlagen wir uns schon durch.“
Der Freund nickte mit Verschwörermiene. Man musste sich nur vor dem Kommandanten in Acht nehmen. Nach diesem Gespräch war er gewarnt.
In den nächsten Tagen sah es denn auch nicht so aus, als würden sie sich unauffällig davonmachen können. Der Kommandant, immer noch wachsbleich im Gesicht, aber eisern in der Erfüllung seiner Pflicht, hatte eine stärkere Bewachung der Festung angeordnet; keiner kam hinaus und keiner herein, ohne dass streng kontrolliert wurde, was man bei sich trug. Die Männer, die am Fluss halfen, wurden ebenfalls bewacht und waren nach der Anstrengung in der Kälte und von all den schrecklichen Szenen, die sich auf dem Eis abspielten, meist so erschöpft, dass sie froh waren, ihren Kopf irgendwo niederlegen zu können und in bleiernen Schlaf zu fallen. Immer neue triste, widersprüchliche Nachrichten machten die Runde, darunter das Gerücht, Hitler hätte aufgegeben, er wäre schwer krank, verletzt von weiteren Anschlägen, regierungsunfähig ... Alles schien möglich. Die deutsche Armee befand sich auf dem Rückzug, das war die traurige Wahrheit. Sie war versprengt, entmutigt und vom Feind überrannt. Es sollte einen neuen Befehl geben, bald die Festung zu verlassen und sich langsam in Richtung Danzig zurückzuziehen, wo Schiffe bereitstünden, um Flüchtlinge und Soldaten aufzunehmen. Doch Tatsache war: Wenn Graudenz erst richtig belagert würde, käme man hier sicher nicht mehr lebend raus. Dann konnten die Russen sie auf der anderen Seite der Weichsel ganz einfach abfangen.
Aber so leicht würden sie es ihnen nicht machen! Conny und Willi hatten die Situation klar vor Augen. Wenn sie bei der Truppe blieben, wären sie so und so verloren. Nur als Einzelkämpfer konnten sie sich vielleicht noch durchschlagen. Die Zeit verfloss zäh, vorerst gab es keine Möglichkeit zu entkommen und der Rückzugsbefehl ließ auf sich warten.
Auf der langen, eintönigen Strecke nach Kulm, im selben Zug, mit dem sie gekommen war, fuhr Emilia nun wieder zurück. Ein angehängter Güterwagen mit Proviant, Verbandszeug und Hilfsmitteln wurde von einer Hand voll Reservesoldaten begleitet, meist nur mit einfachen Gewehren und Panzerfäusten bewaffneten Freiwilligen – älteren und jungen Burschen, fast noch Kindern, die jetzt noch eingezogen worden waren, aufgeheizt durch Hitlers Parolen, das Vaterland bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen, obwohl nichts mehr zu retten war. Die Gruppe der zusammengewürfelten Hilfskräfte wusste nicht recht, was sie erwartete, und sie versuchten sich gegenseitig Mut zu machen.
Schon auf dem ersten Streckenabschnitt wurden sie auf die Probe gestellt. Es ereignete sich genau das, was alle seit der Abfahrt fürchteten. Geschützfeuer ertönte und russische Truppen griffen plötzlich an. Ohne Vorwarnung stoppte der Zug auf unübersichtlicher Strecke und die Mitreisenden hielten den Atem an. Dann erhob sich Tumult, alles rannte durcheinander. Die ungeschulten Soldaten, unsicher im so schnellen ersten Einsatz, brachten die Gewehre in Anschlag. Maschinengewehrfeuer und raue Schreie zerrissen draußen die eisige Luft, in der alles Leben erstorben schien. Panzer mit russischen Emblemen waren in der Ferne zu sehen und ein Kampf schien sich zu entspinnen.
Schwester Emilia wurde blass. Jetzt war die Fahrt wohl zu Ende, sie würde als Mitglied der Hilfsorganisation Rotes Kreuz in Gefangenschaft geraten, wenn ihr nicht noch Schlimmeres geschah. Ihr Herz begann rasend zu klopfen. Einer der Soldaten warf einen raschen Blick auf sie und rief ihr aus der Ferne zu: „Nehmen Sie das Häubchen ab, Schwester, und ziehen Sie die Schürze aus – man wird Sie in ein Lager sperren, wenn man weiß, was Sie hier tun!“
Hastig riss Emilia die Haube vom Kopf und nestelte mit zitternden Händen an ihrer Schürze. Mit einem Stoßgebet zum Himmel duckte sie sich angstvoll in eine Ecke des Zuges, die verräterischen Requisiten und sogar die Medizintasche bebend unter einen Stapel Holz stopfend. Bange Stunden verbrachte sie reglos, mit verhaltenem Atem, in der durchdringenden Kälte des wartenden Zuges, Stunden, in denen sie kaum wagte, von Zeit zu Zeit vorsichtig hinauszublicken. Draußen auf dem Feld betäubte erneut das nahe Rattern von Maschinengewehren die Ohren, schwere Panzergeschütze feuerten Salven ab und Detonationen zerrissen die Luft. Unzweifelhaft kamen die Kampfgeräusche aus dem Dorf an der Grenze des Horizonts hinter dem schneebedeckten Hügel, vor dem der Zug stand. Wagenrollen näherte sich und russische Befehle waren zu vernehmen. Sie waren verloren!
Die schrecklichen Geschichten gerade noch entkommener Flüchtlinge kamen Emilia in den Sinn – Bilder von verstümmelten Leichen mit abgeschnittenen Gliedmaßen, mit verrenkten Gliedern daliegenden vergewaltigten Frauen schossen wie Blitze durch ihren Kopf. Wenn ihr dieses Schicksal erspart bliebe, dann würde sie sich zumindest in einem der schrecklichen Gefangenenlager wiederfinden, in denen man die Insassen langsam verhungern ließ. Fieberhaft nestelte sie an der Kette mit dem Kreuz um ihrem Hals und öffnete die kleine Schließe der Metallhülse. Die Kapsel fiel heraus – harmlos anzusehen und doch gefährlich aufleuchtend im Dunkel des stickigen Zuges.
Ein Rütteln an den verbarrikadierten Türen des Waggons, Gewehrkolbenschläge ließen sie zusammenfahren. Neue Schüsse, Flüche und Schreie ertönten. Die Tür begann unter den Schlägen zu bersten und die Reservesoldaten im Zug packten die Panzerfäuste fester und sicherten ihre wenigen Schuss Munition, während sie in Deckung den Atem anhielten, kalten Schweiß auf der Stirn, das Gewehr im Anschlag. Was würde diese kleine, leicht bewaffnete Truppe gegen Russen mit Maschinenpistolen und anderem Geschützmaterial ausrichten können? Doch sie waren entschlossen, sich bis zum letzten Atemzug zu verteidigen.
Die junge Schwester starrte auf die Kapsel in ihrer Hand. Einfach hinunterschlucken und alles war vorbei – das Elend, der Kampf, die drohende Niederlage, der Hunger und die Angst. Niemals würde sie mehr erfahren, was ihrer Familie geschehen war, nicht mehr die immer größer werdenden Schrecken der Flüchtenden, der Verletzten, das Elend mitansehen müssen, das nicht zu lindern war. Alles war verloren. Was nützte noch das letzte Aufbegehren, ein zähes, sinnloses Durchhalten, das am Ende doch nur in den Tod führte, in einen grausamen, langsamen und qualvollen Tod? Nein, das wollte sie nicht. Sie würde Schluss machen, nicht mehr hungern, nicht mehr frieren und vor allem nicht in Gefangenschaft geraten. Langsam führte sie die Hand zum Mund und öffnete die Lippen, während das Gewehrfeuer sich verstärkte und ganz in der Nähe Detonationen dröhnten.
In den Mauern der Burg flammte der Kampfgeist der Truppe wieder auf. Ein neuer Funkspruch mit der Nachricht von unmittelbar bevorstehender Verstärkung und Rettung war wie ein Hoffnungsstrahl in die dunklen Gewölbe gedrungen. Ein weiteres Bataillon sollte ganz in der Nähe im Anmarsch sein und bald zu den Ausharrenden stoßen. Der Russe hatte zwar den westlichen Brückenkopf in der Hand, doch eine starke Division mit neuen Panzern sollte den Männern zu Hilfe kommen mit dem Führerbefehl, sich der besetzten Brücke zu bemächtigen oder eine der weiter oben liegenden Behelfsbrücken auszubauen, die an einer Furt lag, durch die man vielleicht vor der Schlammperiode noch durchkäme. Neuer Mut belebte die erschöpften Soldaten, denen Kälte und Nahrungsmangel zu schaffen machten. Abgeworfene Flugblätter forderten die Eingeschlossenen zum Durchhalten auf: Die Lage sei nicht so schlecht, auf jeden Fall müsse bis zum letzten Atemzug jeder Zoll Bodens verteidigt werden. Feiglinge und Flüchtlinge ohne Zugehörigkeit würden ohne viel Federlesens sofort erschossen!
Willi schien aufgrund dieser Nachrichten in seiner Entscheidung zur Flucht zu schwanken. Als die beiden Freunde abends in ihren Schlafsäcken lagen und sich flüsternd über die missliche Lage unterhielten, zögerte er, als die Rede auf ihren Plan kam.
„Du kannst machen, was du willst – ich hau jedenfalls ab“, flüsterte Conny entschlossen, „irgendwie, auch wenn der Alte noch so aufpasst. Mir reicht ’s. Du siehst doch, alles ist verloren, und ob wir jetzt vom Russen oder von unseren eigenen Leuten abgeknallt werden, bleibt doch schließlich einerlei.“
„Eigentlich hast du Recht.“
„Wir müssen in die Tuchler Heide, da sind wir immerhin schon ein Stück weiter weg. Wenn es hier richtig losgeht, kann es für uns bereits zu spät sein. Hier sitzen wir doch genau in der Falle – da gibt es ja gar kein Entkommen! Und das Märchen von der Verstärkung – glaubst du das?“
Willi schwieg und wickelte sich tiefer in seinen Schlafsack. Dann antwortete er leise: „Sage ich doch schon die ganze Zeit! Wir brauchen ja nur unsere Flüchtlinge fragen, ob sie etwas gesehen haben – ganz einfach. Morgen! Und wenn nicht, dann ...“ Er sprach den Satz nicht zu Ende und war mittendrin eingeschlafen.
Conny starrte in die Dunkelheit. Es war höchste Zeit. Eine Art dunkler Vorahnung presste ihm die Brust zusammen – ein Wittern der Gefahr, ein sechster Sinn, den er sich in den Jahren der ständigen Lebensgefahr wie ein Tier angeeignet hatte und der vielleicht der Grund für sein bisheriges Überleben war – ein Wegducken zur richtigen Seite, die schnelle Reaktion beim kleinsten Geräusch und das Aufspüren des Unsichtbaren, das in der Luft lag. Er fühlte ganz deutlich: Wenn er hier blieb und sich auf die imaginären anderen verließ, die zur Befreiung anrücken sollten, wäre er wohl wirklich verloren. Wer käme, das war der Feind, der unaufhaltsam vorrückte, während ihnen hier Munition und Vorräte ausgingen, vom Treibstoff, der schon längst hätte eintreffen sollen, ganz zu schweigen. „Morgen, ob du nun mitkommst oder nicht“, raunte er dem Kameraden zu, der schon in den Gefilden schönerer Träume als der Wirklichkeit schwebte, „morgen – da bin ich weg!“
Die Hand der Schwester zitterte und sie stopfte die Kapsel wieder in die Hülse zurück. Ihr war, als sähe sie das kopfschüttelnde Gesicht ihrer Mutter vor sich. Sie war doch erst am Beginn ihres Lebens! Das Geschützfeuer entfernte sich unvermittelt und verlor sich in der Ferne, die Kommandorufe wurden schwächer, die Stimmen vom Sausen des Windes, der über die Ebene fuhr, allmählich verschluckt – der Zug blieb wie durch ein Wunder unbehelligt.
Als die flache Schneelandschaft wieder in ihrer trüben, glasierten und unberührt scheinenden Einsamkeit vor ihnen lag, als hätte ein Stein eine ruhige Wasserfläche gestreift und nichts weiter, setzte die Lokomotive langsam ihre Fahrt fort, während die erleichterten Soldaten, die jungen und alten Reservisten, völlig unerfahren im Kampf, aus den Fenstern über den Horizont hinauszusehen versuchten und aufgeregt darüber berieten, was dieser Zwischenfall bedeutete, was genau überhaupt geschehen war. Sie würden es wohl nie erfahren. Wie auch immer, sie waren vorerst gerettet.
Emilias Schläfen begannen wie rasend zu schmerzen, ihr Kopf schien noch betäubt von der unerwarteten Schrecksituation und nur langsam ordneten sich ihre Gedanken. Nach der überstandenen Gefahr, nach allen Ängsten, den durchwachten Nächten war die Vorstellung erschreckend, dass sie um ein Haar die Verantwortung von sich geworfen, dass sie ihrem Leben beinahe voreilig ein Ende gemacht hätte. Doch sie war noch einmal davongekommen, wie schon so oft und wie durch ein Wunder. Sie durfte nicht aufgeben!
Sorgsam band sie die hervorgeholte Schürze wieder um die Taille und setzte das Häubchen auf, das unter dem Holz ein paar schwarze Flecken bekommen hatte. Mit bebenden Fingern suchte sie unter all den verschiedenen Packungen nach den Schmerztabletten. Sie würden den Druck in ihrem Kopf auflösen, die lähmende Angst betäuben, sie wieder frisch machen und ihr neuen Mut verleihen. Gleich drei Stück klaubte sie aus der angebrochenen Packung. Wieder sah sie das vorwurfsvolle Gesicht ihrer Mutter vor sich. Du nimmst zu viel davon, schien ihre anklagende Miene zu sagen. Sie zuckte die Schultern. Wie soll ich sonst das alles ertragen, Mama? Ich bin doch da, um den anderen Kraft zu geben. Wo soll ich sie denn hernehmen? Mit einem Schluck Wasser aus einer Feldflasche spülte sie energisch den bitteren Geschmack hinunter. Sie durfte jetzt nicht die Nerven verlieren! Alles würde gut werden.
Die Schwesterntracht unter dem Mantel, nur durch das Häubchen als Mitglied des Roten Kreuzes kenntlich, verließ die junge Frau mit der schweren Umhängetasche und dem kleinen, abgeschabten Koffer nach einer ihr unendlich lang scheinenden, aber ohne weitere Störungen verlaufenen Fahrt in Kulm den Zug. Der Bahnhof war umlagert von Menschen mit traurigen Gesichtern, die hofften, noch einen der Züge zu erwischen. Die Stadt schien verlassen und abgebrannt; Rauchwölkchen stiegen aus erloschenen Ruinen. Tränen drängten ihr in die Kehle beim Anblick des ehemals schönen, blühenden Ortes, in dem sie einige Jahre verbracht hatte, in der Hoffnung auf den Sieg der deutschen Streitkräfte, auf den großen Führer. Wie würde es in Waltersdorf aussehen? Wahrscheinlich nicht anders als hier. Sicherlich hatten die Eltern diese öde, trübselige Stätte schon verlassen; es schien undenkbar, dass sie in einem solchen Chaos noch geblieben waren.
Emilia trat wieder auf den Bahnsteig. Jeden der unruhig an ihr Vorbeieilenden, die sich hastig in den Zug drängen wollten, fragte sie nach dem kleinen Ort, nach der Familie Reich. „Waltersdorf?“, antwortete einer der abgehärmt aussehenden Fahrgäste und lachte bitter auf. „Das können Sie vergessen. Dort ist keine Seele mehr. Der Russe hat alles in Brand gesetzt und wir haben nur noch Angst, dass er uns einholt.“
Emilia senkte den Kopf. Wo sollte sie suchen? Es hatte wohl keinen Sinn, nach Waltersdorf zu fahren. Zweifellos waren sie wie alle anderen unterwegs in den Westen. Sie konnte nur noch hoffen, dass ihnen nichts geschehen war, dass sie in Sicherheit waren. Hatten sie im Kloster eine Nachricht für sie hinterlassen? Sie musste auf schnellstem Wege dorthin, um wie versprochen den neuen Transport zu übernehmen. Möglicherweise würde sie irgendwo unterwegs ihrer Familie begegnen. Alle Flüchtlinge mussten ja den gleichen Weg nehmen.
Ein Bahnbeamter erschien und schob sich durch die Menge. „Zurück! Alle raus! Die Linie ist unterbrochen, der Zug fährt nicht mehr!“
Also doch! Wie die Oberschwester es vorausgesagt hatte. Jetzt stand sie da.
Enttäuscht verließen die Leute mit ihren Bündeln und Koffern den Zug, ratlos, wohin sie sich nun wenden sollten. Emilia stieg mit schleppenden Schritten die Stufen des Bahnhofsgebäudes hinunter. Auf der Straße begegnete ihr der Zug unzähliger Wagen eines schier unüberschaubaren Trecks, in dem das ganze Hab und Gut und das Leben vieler Menschen transportiert werden sollte. Alles war in fieberhafter Eile, hastig wurden die Pferde angetrieben, man drängte sich vor, wollte unter den Ersten sein. Die Gesichter waren in der Anspannung ernst, angstvoll und verzerrt.
Nach ein paar vergeblichen Versuchen, doch noch nach Waltersdorf zu kommen, gab Emilia endlich auf. Niemand wollte sie dorthin fahren, alle strebten in die entgegengesetzte Richtung. „Dort ist alles ausgeräumt, Mädchen, glaub es doch!“, rief ihr einer zu und schüttelte den Kopf über ihre Hartnäckigkeit. Mit Tränen in den Augen stellte sie sich an die Straße. Ein Bauer mit versteinertem Gesicht, in dem Hoffnungslosigkeit und Trauer standen, nahm sie mit, nachdem sie ihm ein Zeichen gemacht hatte; der Weg führte auf jeden Fall am Kloster vorbei, in dessen Lazarett mancher die kranken und alten Angehörigen abgab.
Als das düstere Gebäude mit seinen ungenutzten Türmen vor ihren Augen auftauchte, überfielen sie all die Erinnerungen, die sie mit diesem Anblick verband. Drei harte Jahre hatte Emilia in diesen Mauern verbracht, in der ihr vom Roten Kreuz vermittelten Arbeitsstätte, immer hin- und herpendelnd zwischen dem Kloster und dem Ort Waltersdorf, wo ihre Familie nach der Flucht angesiedelt worden war. Sie alle glaubten, dort sicher zu sein; die Nähe der Schule für Heeresmotorisierung, die Überzeugung vom baldigen Sieg hatten sie darin bestärkt. Wer hätte gedacht, dass sie auch von dort wieder verjagt werden sollten? Wer konnte wissen, dass der Russe so bald vor den Toren stehen und der endlos lange Treck sich wieder in Gang setzen würde, mit dem sie schon einmal unter anderen Umständen fortgezogen war?
Doch es half nichts, weiter darüber nachzudenken. Man musste weg, bevor die Schlammperiode einsetzte, die alle Wege in matschige Sümpfe verwandelte, musste die Chance nützen, so schnell wie möglich und vor Einsetzen des Tauwetters die noch zugefrorene Weichsel zu erreichen. Jeden Tag konnte das Eis schwächer werden; die Fliehenden waren sich dieser Tatsache wohl bewusst. An die meisten Wagen hatte man noch schnell zusammengezimmerte Schlitten gebunden, auf die Lasten verteilt wurden und die Personen aufnehmen konnten.
Als Emilia durch das vertraute Portal in den Krankensaal des Klosters trat, schlug ihr sogleich der dumpfe, pestilenzartige Gestank von Blut und Wunden, von tagelang ungewaschenen Kranken entgegen. Der Saal war wieder voll mit stöhnenden oder apathisch daliegenden Soldaten, für die man nicht einmal mehr Hemden oder Bettwäsche hatte. Die Fenster blieben geschlossen, alle Ritzen waren verstopft, damit die Kälte nicht eindrang, und ein neuer Arzt, den sie nicht kannte, ging mit bleichem, übernächtigtem Gesicht von Bett zu Bett.
Wie sollte man all diese Menschen verladen, ohne dass sie bei einer solchen Fahrt krepierten? Doch niemand wollte dableiben – die Geschichten von den Grausamkeiten der Russen, die die Verwundeten kurzerhand aus den Fenstern der Lazarette warfen, jagten selbst den Todkranken heillose Angst ein und jeder fürchtete sich davor, zurückzubleiben.
Erleichtert und erstaunt reichte der Arzt mit den streng nach hinten gescheitelten dunklen Haaren der Krankenschwester die Hand. Er war mittelgroß, etwa 38 Jahre alt und sah sie mit seinen lebhaften grauen Augen freundlich an. „Doktor Michelsen. Ich hätte nicht mehr mit einer Verstärkung gerechnet. Und dazu noch eine so junge Frau wie Sie! Was führt Sie hierher?“
Emilia versuchte ein Lächeln, während der Gestank Ekel in ihr aufsteigen ließ und ihr die Kehle zuschnürte. „Ich bin Schwester Emmi und soll die Leitung eines der Krankentransporte übernehmen. Doch ich habe gerade gehört, dass die Zugverbindung zurück nach Stolp unterbrochen ist. Aber eigentlich bin ich auch deswegen hier, um meine Eltern zu suchen – Familie Reich aus Waltersdorf. Ich dachte, dass sie vielleicht im Kloster eine Nachricht für mich hinterlassen haben. Sie sind nicht in Stolp angekommen und ich hoffe, dass ihnen nichts passiert ist und sie noch rechtzeitig flüchten konnten. Ich mache mir große Sorgen. Sie haben sie nicht zufällig gesehen oder von ihnen gehört? Meine Mutter ist Hebamme und wahrscheinlich mit meiner kleinen Schwester und unserem Knecht Franz unterwegs.“
Der Arzt schüttelte nach einigem Nachdenken den Kopf. „Ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Das Kloster war leer, aber jetzt ... Die vielen Transporte, die unaufhörlich eintreffenden Verwundeten – wir mussten die Leute ja irgendwo unterbringen – ich habe niemanden so richtig angesehen.“ Ein kurzes, betretenes Schweigen entstand.
„Lassen Sie mich Ihnen helfen!“, fuhr Emilia plötzlich mit einem entschlossenen Blick auf das Elend um sie herum fort. „Sagen Sie mir, was ich tun soll. Und wenn ich nur Mullbinden aufwickle. Aber wenn Sie vielleicht vorher etwas zu essen hätten – ich habe während der ganzen Fahrt kaum einen Bissen zu mir genommen.“
Die müden, erschöpften Züge des Arztes überflog ein mattes Lächeln, das ihn sehr sympathisch wirken ließ. „Natürlich, gerne. Nehmen Sie sich, was Sie in der Küche finden. Sie schickt mir der Himmel! Aber dann müssen Sie sich erst einmal ausruhen. Legen Sie sich ein wenig hin. Bis dahin haben wir ein paar Schlitten an die Wagen gebunden, die die Verletzten mitnehmen sollen.“
Emilia wehrte ab. „Nein, nein, ich habe im Zug versucht, mich auszuruhen. Wir sollten keine Zeit verlieren. Der Zug wurde unterwegs von russischen Panzertruppen angegriffen. Ich glaube, sie haben nur von uns abgelassen, weil sie von einem deutschen Kommando zurückgetrieben wurden. Wir müssen unbedingt hier weg, bevor es zu spät ist!“
Dr. Michelsen antwortete nicht; ein Schwerverletzter, der gerade eingeliefert wurde, erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. Mit einem Blick überflog Emilia die Menge der herandrängenden, überladenen Wagen, von ungeduldig aufwiehernden Pferden gezogen, die sich einer hinter dem anderen langsam und unablässig auf dem vereisten Weg vorwärts bewegten und voranrollten. Stumpfe, ängstliche Gesichter zwischen Paketen, Bündeln, sogar Möbeln, die man aufgeladen hatte, starrten ihr entgegen, in denen das Entsetzen geschrieben stand, sich so plötzlich von Heimat, Besitz und Land trennen zu müssen. Die Alten und die Kinder waren in der eisigen Kälte unter den Strapazen des anstrengenden Trecks wie immer die Leidtragenden. Einige freiwillige Soldaten, unter denen sie vergeblich das Gesicht desjenigen suchte, dem sie nicht einmal hatte Adieu sagen können, versuchten die Wagenbesitzer zu überreden, sich von einem Teil des Gepäcks zu trennen, Verletzte aufzunehmen und zuzulassen, dass man Schlitten an die Wagen band, auf die man diejenigen gelegt hatte, die nicht mehr laufen konnten. Nicht alle waren damit einverstanden, ihre Sachen abzuladen und jemanden mitzunehmen, und viele mussten zu diesem Akt der Menschlichkeit mit der Waffe in der Hand gezwungen werden. Aber in aller Augen stand die Angst, bleiben zu müssen, dem herandrängenden Feind hilflos ausgeliefert zu sein. Nur wenige, meist alte Leute waren in ihren Dörfern geblieben, komme, was da wolle, bereit eher zum Tod als zum Verlassen ihres Lebenskreises und der Flucht in eine ungewisse Zukunft.
Mühsam versuchte Emilia die Gesichter der Vorüberfahrenden zu erkennen; sie drängte sich durch die Soldaten und stellte immer wieder die gleiche Frage: „Familie Reich aus Waltersdorf?“ Ein müdes Kopfschütteln, ein verständnisloser Blick antworteten ihr. Erschöpft wandte sie sich ab. Sie konnte nicht hier bleiben und unablässig diese einzige Frage stellen. Von überall wurde sie gerufen, wenn man ihre Rote-Kreuz-Tracht erblickte. „Schwester, Schwester“, schallte es von allen Seiten, „zu mir, kommen Sie zu uns! Meinem Vater geht es so schlecht – meine Zehen sind erfroren – mein Kind hat Fieber!“ Einer der Männer, die die Schlitten mit den Verwundeten an den Wagen festzurrten, ein Sanitäter, wandte sich ihr mitleidig zu. „Sie sind ja ganz blass, Schwester! Sie müssen sich ein wenig ausruhen. Ich verspreche Ihnen, ich frage jeden, der mir begegnet, nach Ihren Eltern, der Familie Reich. Wir werden Sie hier noch dringend brauchen, und wenn Sie selbst krank werden, dann kann den Leuten niemand mehr helfen.“
Emilia wusste, dass er Recht hatte. Sie senkte den Kopf; die aufputschende Wirkung der Tabletten ließ langsam nach. Schwerfällig stieg sie die Treppen in ihr altes Zimmer hinauf, in das winzige, leer geräumte Dachstübchen.
Alles schien so, wie sie es verlassen hatte, doch die eisige Kälte war auch in diese Dachkammer gekrochen. Auf dem kleinen, wackligen Tisch leuchtete ihr das helle Blau eines Briefumschlags entgegen, der an der bauchigen Vase mit dem Sprung lehnte. In schönen, schrägen Buchstaben stand ihr Name darauf: Fräulein Emilia Reich.
Sie stutzte, drehte und wendete den Umschlag in den Händen, ihr Herz begann rasend zu klopfen, während zugleich glühende Hitze in ihre Wangen stieg. Das war doch ... Waren das wirklich die Schriftzüge Connys, des Soldaten, der sie nach dem Bratkartoffel-Erlebnis bei Pelzer nicht mehr aus den Augen gelassen hatte? Sie sank auf den einfachen Stuhl und stützte träumerisch den Kopf in die Hand, während sie auf den Brief starrte. Wie konnte er wissen, dass sie noch einmal hierher zurückkam? Fast hatte sie sich damit abgefunden, dass sie ihn nie mehr wieder sehen würde. Aber das Schicksal hatte sie wirklich wieder hierher geführt. War das nicht ein seltsames Zeichen?
Vorsichtig riss sie den Umschlag auf: anrührende Sätze, die ihr die Tränen in die Augen trieben – eine Adresse in Düsseldorf. „Ich kann Dich nicht vergessen. Willst Du mich heiraten, wenn der Krieg aus ist und wenn wir beide das alles überleben? Mit Dir möchte ich ein neues Leben anfangen ...“
Sie murmelte die Worte mit einem Lächeln vor sich hin und schüttelte den Kopf. Wenn er wüsste, dass sie eigentlich schon verlobt war! Es war ja gar nichts zwischen ihnen geschehen – und doch so viel – der nächtliche Spaziergang an der Weichsel, als unter ihren Füßen der Schnee knirschte und der Mond mit seinem blassen Licht das Eis in tausende glitzernder Kristalle verwandelte; eine magische Nacht, die die Augen leuchten ließ und deren beißende Kälte die Wangen blutrot färbte, als sie sich beim Abschied zärtlich küssten. Schweigend waren sie eine Zeit lang in stillem Einverständnis nebeneinander hergegangen, dann wieder erzählten sie sich ihre Geschichte, kleine Episoden aus ihrem Leben, und ihnen war, als kannten sie sich schon lange. Die Kirche in Kulm – stumme Blicke, wie ein uneingestandenes Gelöbnis – er hielt ihre Hand und sah ihr nur tief in die Augen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an wusste sie, dass sie sich verliebt hatte.
Doch sie wollte gegen ihre Gefühle kämpfen. Das alles brachte doch nichts! Als er das erste Mal hier oben in ihrem Zimmer gewesen war, um sie abzuholen, war ihm gleich die Fotografie ihres Verlobten aufgefallen, die in einem Silberrahmen neben ihrem Bett stand. Warum hatte sie, als er fragte, wen das Bild darstellte, gelogen und so gleichmütig wie möglich geantwortet: „Das ist mein Bruder.“ Gleich darauf bereute sie die kleine Schwindelei. Warum sagte sie nicht die Wahrheit, warum schwatzte sie so dummes Zeug daher? Tief in ihrem Herzen zweifelte sie eben. Sie glaubte Conny einfach nicht. Diese treuen braunen Augen, die sie so faszinierten, sprachen vielleicht nicht die Wahrheit.
Sie stand auf, den Brief in der Hand, ein traumverlorenes Lächeln trat auf ihre Lippen. Ohne es zu merken, ließ Emilia sich seufzend auf die harte Sprungfedermatratze des schmalen Bettkastens niedersinken, den Kopf gedankenvoll gegen das harte Brett lehnend. Magische Worte – willst du mich heiraten? War das wirklich ernst gemeint? Wahrscheinlich konnte er an jedem Finger eine andere haben. Sie hatte es ja selbst gesehen. Er war vielleicht nichts weiter als ein gewöhnlicher Casanova, der die Frauen wechselte wie die Hemden. Sie durfte ihm nicht trauen. Emilias Gedanken schweiften zurück. Jedes Mal musste sie sich ärgern, wenn sie ihm durch Zufall begegnete – immer hatte er eine andere Frau dabei. Und jetzt war wohl sie an der Reihe. Aber nicht mit ihr!
Obwohl sie stolz alle seine Einladungen ablehnte, gab er nicht auf. Das Fest bei der Offizierswitwe war dann der Gipfel gewesen. Das war ihr erstes, ganz zufälliges Wiedersehen. Noch jetzt ließ die Erinnerung ihre Empörung aufflammen.
Ein Essen, eine kleine Feier – denn irgendwie gab es immer noch Reserven –, und die ausgehungerten, wenig verwöhnten Soldaten ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie hatte eigentlich gar nicht mitgehen wollen – die Prüfung für das Schwesterndiplom stand an und sie zog es vor, in ihrem Zimmer zu lernen. Doch ihre Zugehfrau, die kleine Martha, ließ nicht locker und bat, sie solle doch auch etwas Abwechslung suchen – und das gute Essen, das gebe ihr genügend Kraft für die Prüfung! Schließlich ließ sie sich überreden, trödelte jedoch so lange mit dem Umziehen, bis Martha ungeduldig im Zimmer erschien. „Hören Sie, ich bin verabredet und der Soldat wartet jetzt schon eine Viertelstunde auf der Straße. Sind Sie denn noch nicht fertig?“
Aus ihren Büchern, in die sie sich vertieft hatte, fuhr Emilia hoch. „Doch, doch, ich komme gleich!“ Sie zog sich eilig ein Kleid über und bürstete ihre Haare, die sie in der Hast nur an der Stirn mit einem Kamm zurücksteckte und offen über die Schultern fallen ließ.
Als die beiden Frauen auf die Straße traten, fiel die hübsche Martha, ein schwarzhaariges, üppiges Temperamentbündel, dem Wartenden um den Hals. Emilia blieb diskret stehen und schaute zur Seite. Wäre sie doch gar nicht mitgegangen, so als drittes Rad am Wagen bei einem Liebespaar! Als der Soldat sich lächelnd umwandte und sie hochsah, erstarrten beide.
Seit der Bratkartoffel-Episode hatten sie sich nur noch von weitem gesehen. Emilia fühlte unangebrachte Wut in sich aufsteigen. Schon wieder dieser Kerl! Er wechselte die Frauen wohl ständig und jetzt war es auch noch Martha! Wie peinlich! Musste er ihr denn überall über den Weg laufen?
Der Soldat reichte ihr mit eingefrorenem Lächeln die Hand und unterbrach Martha, die ihn vorstellen wollte, mit den Worten: „Ich glaube, wir kennen uns schon.“
Die junge Schwester warf hochmütig den Kopf in den Nacken und sah ihn mit eisiger Miene von oben bis unten an. „Nicht dass ich wüsste“, betonte sie nachdrücklich.
Eine unangenehme Pause entstand, die die lebhafte und ahnungslose Martha mit einem lustigen Auflachen überbrückte. „Unsere Emilia ist so abweisend, wie sie schön ist. Sie lässt alle Verehrer auflaufen – und ist nur ihrem Verlobten treu. Es war ein schweres Stück Arbeit, sie zum Mitkommen zu überreden.“ Von den Erinnerungen überwältigt, ließ Emilia den Brief sinken und fröstelte in der kalten Stube. Und jetzt – jetzt wollte derselbe Mann sie heiraten!
Laute Schreie draußen im Hof ließen sie zusammenzucken und rissen sie aus ihren Gedanken. „Die Russen, o Gott, sie kommen! Sie haben alle umgebracht, meine ganze Familie, das Haus angezündet ... Ich bin weggelaufen!“
Mit dem Brief in der Hand ging Emilia zum Fenster, öffnete es und schaute hinaus. Eine Verrückte, durchgedreht. Kein Wunder, das passierte oft. Bleierne Müdigkeit lähmte ihre Hand, als sie das Fenster wieder schloss. Was auch kam, was auch immer geschah, sie brauchte ein wenig Schlaf, es war unmöglich, sich weiter aufrecht zu halten. Draußen schoben sich die Trecks unablässig voran, es war kein Ende in Sicht. Aber sie musste auf jeden Fall bleiben und abwarten, bis auch die letzten Schlitten mit Verletzten an die Wagen gebunden waren. Bei dieser schweren Arbeit konnte man sie sowieso nicht brauchen. Ihre Zeit würde kommen, bei der Begleitung des Trecks, und dafür musste sie Kräfte schöpfen. Nur ein paar Minuten, ein wenig Ruhe – mit diesem Vorsatz warf sie sich – angezogen, wie sie war, und nachdem sie den Brief unter ihre Bluse geschoben hatte – auf das Bett und sank im nächsten Moment in den tiefen Schlaf völliger Erschöpfung.