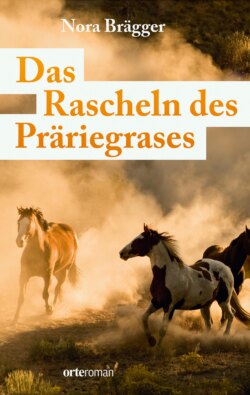Читать книгу Das Rascheln des Präriegrases - Nora-Lena Brägger - Страница 11
ОглавлениеEin Auto fuhr auf den Hof. Man hörte die Reifen über den steinigen Boden rutschen, als der Wagen hielt. Ich lief zum Fenster. Liam stieg aus dem Pick-up, schlug die Wagentüre zu und kam aufs Haus zu.
Ich lehnte mich aus dem Fenster, winkte und rief: «Hey, ich komme gleich!»
Liam winkte zurück. Ich schwang mir meine Tasche über die Schulter und ging aus dem Zimmer. Zwei Treppenstufen auf einmal nehmend, rannte ich nach unten, rief Tschüss in Juls Arbeitszimmer und trat auf die Veranda hinaus. Liam redete mit Ron, der unter dem Baum neben dem Haus spielte und wendete sich mir zu, als er mich kommen sah.
Mir stockte der Atem. Ihre Haare wehten im Wind, ihre Augen funkelten freudig und gespannt, sie war noch brauner geworden seit gestern, und in ihren kurzen Shorts sah sie echt heiss aus. Ich lief auf sie zu und wusste nicht recht, wie ich sie begrüssen sollte. Diese Entscheidung nahm sie mir ab, indem sie mich kurz umarmte. Ihr Duft haute mich um, und ich brachte nur ein kurzes «Hi» heraus. Sie duftete blumig und fruchtig, leicht, aber trotzdem intensiv. Ich konnte es nicht einordnen, so etwas hatte ich noch nie gerochen. Ich hatte sie wohl ein bisschen zu lange angeschaut, denn nun musterte sie mich und hatte einen fragenden Gesichtsausdruck. «Heey Liam! Geht’s dir gut?», fragte sie mich stirnrunzelnd. Ich musste zuerst meine Gedanken ordnen, dann erwiderte ich: «Du siehst toll aus und duftest unglaublich gut.» Damit hatte sie nicht gerechnet und schaute mich überrascht an.
«Danke. Soll ich dir mal mein Parfum ausleihen?», neckte ich.
Liam schmunzelte und ging zum Wagen.
Nach eineinhalb Stunden Autofahrt, Liam hatte immer mehr Leute aufgegabelt, parkierte er den Pick-up am Ende eines Feldweges zwischen ein paar Sträuchern. Wir waren zu sechst: Puck, Rian, Jenna, Thalia, Liam und ich. Es waren alles gute Freunde von Liam, und sie schienen nett und offen zu sein. Ich wusste nicht, dass hier jeder jeden kannte, und für Liam alles «Brüder und Schwestern» waren. Er hatte ein paar wirklich gute Freunde, wie er sagte, aber das Zusammengehörigkeitsgefühl des Tribes sei in den meisten Indianern noch stark verwurzelt und der Grund dafür, nicht aus dem Reservat wegzugehen.
Liam hatte an alles gedacht: Auf der Ladefläche des Pick-ups hatte es Feuerholz, Kühlboxen mit Getränken, Fleisch, Brot, Chips, … jeder nahm sich etwas. Wir gingen einige Minuten, bis wir eine Feuerstelle erreichten. Es lagen Holzstämme herum, auf denen man sitzen konnte, und man hatte einen tollen Ausblick in das weite Land. Die Sonne ging langsam unter, und Puck entfachte das Feuer. Rian und Liam diskutierten aufgeregt. Ich verstand kein Wort, denn sie redeten Lakota, ihre Muttersprache.
Wir Mädels sassen auf dem Baumstamm und unterhielten uns. Thalia war eine ruhige Person, ganz im Gegensatz zu Jenna, die ein richtiges Energiebündel war. Thalia studierte seit einem Jahr in Rapid City Kunst und Musik und sei wirklich talentiert, wie Jenna mehrmals betonte; Thalia winkte verlegen ab.
«Wie hättest du sonst ein Stipendium bekommen?», fragte Jenna Thalia herausfordernd.
«Ein Stipendium?», fragte ich. «Dann musst du wirklich gut sein!»
«Ja, ist sie auch. Sie ist wirklich gut! Du solltest mal ihre Zeichnungen und Bilder sehen. Die werden dich umhauen!»
«Oh ja, das würde ich gerne.»
Thalia fragte mich: «Zeichnest du auch gerne?»
«Es geht. Fotografieren ist eher mein Ding.»
«Oh! Hast du Fotos von dir dabei?»
«Nicht direkt. Aber die Kamera. Ich könnte euch darauf Fotos zeigen, die ich hier gemacht habe, aber natürlich nur wenn ihr wollt?»
«Das würden wir gerne!», sagte Jenna und Thalia nickte.
Ich nahm meine Kamera aus der Tasche und klickte die Fotos durch. Als wir zu den Fotos von Kyle gelangten, sagte Jenna: «Hier arbeite ich!»
«An der Tankstelle?»
«Ja. Es ist kein besonders guter Job, doch hier nimmt man, was man kriegt!»
Ich hätte sie beinahe gefragt, ob das ein Ferienjob sei, da wurde mir bewusst, das war ihre Festanstellung. Dies war für mich schwierig zu verstehen.
Nachdem ich die Fotos gezeigt hatte, wollte Jenna alles von mir wissen. Was meine Hobbies seien, wie es dort sei, wo ich lebte, ob ich einen Freund hätte und und und … Ich mochte sie, aber ich hatte keinen Bock über mein Leben in der Schweiz zu reden, und so gab ich nur spärlich Auskunft. Es fiel mir heute besonders schwer, an zu Hause zu denken. Die Runde hier am Feuer erinnerte mich an meine Freunde. Wir hatten uns oft getroffen, waren zusammen um ein Feuer gesessen, hatten geredet, getrunken, im Sommer grilliert, und oft hatte jemand eine Gitarre dabei. Ich vermisste diese Zeiten, als alles noch einfach und schön war.
Jennas Neugierde kannte keine Grenzen, sie merkte nicht, oder wollte es nicht merken, dass ich nicht darüber reden mochte, und ich war langsam am Verzweifeln. Schliesslich stand ich auf: «Jenna, ich möchte im Moment nicht darüber reden, okay! Ich kenn dich praktisch nicht, und ich möchte nicht gleich meine ganze Lebensgeschichte vor dir auf den Tisch legen.»
Sie schaute mich etwas perplex an, doch ich wartete ihre Antwort nicht ab, drehte mich um und lief zu Puck. Er sass in der Hocke neben dem Feuer und versuchte den Grillrost aufzustellen.
«Kann ich dir helfen?», fragte ich, und er nickte.
«Keine Sorge, sie ist so. Es tut ihr gut, wenn jemand ihr mal sagt, sie soll ihr Tempo drosseln», sagte Puck grinsend.
Ich lachte etwas zerknirscht: «Ich hoffe, sie hasst mich jetzt nicht.»
«Nein, nein, du wirst schon sehen, spätestens in einer halben Stunde hat sie es vergessen.»
Ich beobachtete, wie Puck das Feuer hütete, während ich mir eine Zigarette anzündete. Er trug seine rabenschwarzen Haare schulterlang wie Liam, doch auf der einen Seite hatte er sie millimeterkurz abgeschoren zu einem Sidecut. Es sah cool aus. Er war kräftig und seine Arme schienen fast schwarz von all seinen Tattoos. Ein Gewirr von Tierköpfen, Symbolen und Schriftzeichen, die ineinander verliefen und sich verschlangen, schmückten seine Arme. Es sah unglaublich aus, und ich bestaunte seine Tattoos fasziniert. Auf den Wangen hatte er viele Narben, die vermutlich von starker Akne verursacht wurden. Das war mir hier bereits aufgefallen: Viele junge Menschen hatten starke Akne. Jul sagte mir, dass es oft am ungesunden und fettigen Essen liege und die meisten Indianer Alkohol nicht gut vertrügen. Die Ernährung war im Reservat ein grosses Problem. Das Angebot bestand praktisch nur aus Fast Food, und das wenige Gemüse, das es gab, war so teuer, dass es die meisten nicht kaufen konnten. Als Jul mir davon erzählte, wurde sie richtig wütend und zeterte über die amerikanische Regierung. Ich habe ihre Worte noch genau im Kopf: «Wir leben im 21. Jahrhundert, und es gibt kaum Verbesserungen im Umgang mit den Natives gegenüber vor hundert Jahren. Die Eingeborenen dieses Landes werden wie der letzte Dreck behandelt, während die weissen Eroberer nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Dass der weisse Mann Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen hat, wird ausgeblendet und heruntergespielt.»
Puck strahlte ein Bad-Boy-Image aus, und ich wusste nicht warum, aber ich fühlte mich zu ihm hingezogen. Er blickte auf und schaute mir in die Augen. Ich hielt seinem Blick stand und wartete ab. Schliesslich wandte er die Augen ab und setzte sich zu mir auf den Stamm.
«Du hast krasse Augen, Liam hat nicht übertrieben!», sagte er und grinste mich schief an.
«Woran denkst du jetzt?», fragte ich. «Nicht etwa an diese Frau, die im tiefen Wald lebt und die Männer mit ihrem Blick zu Tode gestarrt hatte!»
«Was?», fragte er verdutzt, und ich erzählte ihm die Geschichte. Er fand sie ungeheuer lustig. Alle kamen neugierig zum Feuer, und ich musste sie allen nochmals erzählen. Super: Wieder einmal mehr war meine Augenfarbe das Gesprächsthema! Wieso konnte ich nicht ganz normale braune Augen haben, wie neunzig Prozent der Menschen weltweit. Nein, ich gehörte zu den drei Prozent, die die seltenste aller Augenfarben, nämlich grün, hatte. Ich könnte das als eine besondere Ehre ansehen. Doch wenn ich etwas wirklich nicht leiden konnte, waren es Menschen, die sich für etwas Besonderes, etwas Besseres als andere hielten. Ich wollte einfach normal sein.
Die ersten begannen, ihre Steaks zu braten, und alle plauderten durcheinander. Es herrschte eine gute Stimmung, und ich hatte mich entspannt. Ich fragte Puck nach den Tätowierungen auf seinen Armen. Er nickte eifrig und begann mir seine Tattoos zu erklären. Mir entging nicht, wie er seine Muskeln spielen liess, und ich musste mir ein Grinsen verkneifen. Er wusste ganz genau, welche Wirkung er auf Frauen hatte, und verstand, seinen Charme und seinen Körper bewusst einzusetzen. Ich dachte mir, dass die Tattoos eine gewisse Wichtigkeit hatten, aber nicht, dass sie von so grosser Bedeutung waren. Er hatte zu jedem Tier und Symbol eine Geschichte, die Wurzeln in der indianischen Kultur hatte. Auch die Schriften und Zahlen hatten einen Sinn. Er begann geduldig zu erklären, denn ich wusste so gut wie nichts über die Geschichte der Lakota-Indianer. Klar, ich wusste ungefähr Bescheid über die Eroberung Amerikas und die damit verbundene Unterdrückung und Ausrottung der Indianer. Es gab Hunderte von Indianerstämmen, aber wie es den Lakota-Indianern ergangen war, wusste ich nicht. Puck erklärte mir, die Lakota würden in Untergruppen eingeteilt und er gehöre zu den Oglala-Lakota. Neben den Lakota gebe es die Dakota und Nakota, die wiederum in Untergruppen unterteilt würden.
«Meine Wurzeln sind mir heilig. Ich will unsere indianischen Traditionen weiterleben, aber nicht engstirnig. Ich bin bereit, Altes und Neues zu vereinen. Daher habe ich einen Sidecut im Gegensatz zu den traditionellen Lakotas, die ihre Haare lang trugen. Unsere Vergangenheit ist ein Teil von uns. Das wird sie immer sein.»
Die Vorstellung, mein Leben wäre so stark von der Vergangenheit geprägt und ich wäre darin gefangen, war mir unheimlich. Ich fragte Puck, ob er weggehen wolle. Genau wie Liam verneinte er vehement: «Ich kann nicht weggehen, hier sind meine Wurzeln, meine Familie. Weggehen würde nichts ändern.»
«Es würde für diejenigen, welche hier im Reservat blieben, nichts ändern. Für dich würde sich alles ändern.»
«Das stimmt. Doch ich will nicht vergessen. Ich will die Lage im Res nicht akzeptieren, ich will für ein besseres Leben kämpfen, und Weggehen – meine Leute im Stich lassen – das kommt nicht in Frage!»
«Dann willst du also wie Liam ein Freiheitsheld werden?», fragte ich schmunzelnd.
«Ich will kein Held werden. Ich will etwas nachhaltig verändern, damit unser Leben leichter wird. Und die Ehre! Die Ehre will ich meinem Volk zurückgeben.»
«Dann hast du noch einiges vor.»
«Ja. Das ist auch gut so.»
Für mich war das alles schwer zu verstehen. Es machte mich traurig, und ich fühlte mich hilflos. Die Frage war, wie man damit umging. Die eine Art war, wie Puck und Liam für eine bessere Zukunft zu kämpfen und dabei den Mut nicht zu verlieren. Doch manche zerbrachen an der Hoffnungslosigkeit und fanden keinen anderen Weg, als sich mit Alkohol oder Drogen wegzudröhnen. Zu viele setzten auf die zweite Variante, schien mir. Es brauchte Leute wie Liam und Puck, die kämpfen wollten, die sich wehrten und nicht ihrem eigenen Untergang zusahen.
Als ich mit Bill durch das Reservat gefahren war, hatte ich ein paar trostlose Gestalten gesehen. Ich fühlte mit ihnen. Ich wusste, wie es war, wenn man dachte, man hätte alles verloren und es lohne sich nicht, für etwas zu kämpfen, weil sich nichts änderte. Doch ihre Situation mit meiner zu vergleichen, wäre überheblich.
Puck holte mich aus meiner Grübelei, indem er auf meinen Arm zeigte. Ich drehte ihn etwas zur Seite, damit er im Schein des Feuers mein Tattoo besser sehen konnte. Ich hatte insgesamt neun Tattoos. Ich hatte sie mir alle letztes und dieses Jahr stechen lassen, natürlich ohne die Erlaubnis meiner Eltern. Mit den richtigen Kontakten war das ganz leicht. Ich weiss, neun sind ganz schön viel für zwei Jahre, aber ich liebte diesen Kick. Als meine Eltern die Tattoos sahen, waren sie schockiert. Aber was wollten sie machen? Von mir erfuhren sie keine Namen und konnten den Künstler nicht anzeigen.
»Zeig mal her!», sagte Puck, und ich streckte ihm den Arm entgegen.
Puck stellte sich ungeschickt an, er tat, als müsse er Hieroglyphen entziffern.
«Was heisst das?»
«It always seems impossible until it’s done. – Nelson Mandela.»
Puck nickte anerkennend, und ich fragte ihn: «Du kennst doch Nelson Mandela?»
Er schüttelte den Kopf, und ich schaute ihn ungläubig an: «Hast du noch nie von der Apartheid in Südafrika gehört? Von der Rassentrennung?»
Puck lachte: «Natürlich kenne ich Nelson Mandela. Ich wollte nur wissen, ob du es mir glaubst.»
«Das wäre der endgültige Beweis gewesen, dass ich hier hinter dem Mond gelandet bin!»
«Hier gibt es genau wie bei dir zu Hause Internet, und abgesehen davon hatte ich einen hervorragenden Geschichtslehrer. Nelson Mandela kämpfte für die Freiheit, gegen die Rassentrennung, Unterdrückung und für die Gleichberechtigung der Schwarzen in Südafrika. Er war 27 Jahre im Gefängnis als politischer Häftling und wurde dann der erste schwarze Präsident seines Landes. Er bekam den Friedensnobelpreis und gilt als einer der weisesten und bedeutendsten Männer der Geschichte. Er ist vor Kurzem gestorben. Ein beeindruckender Mann.»
«Ja! Sehr! Ich finde dieses Zitat entspricht der Realität. Es ist für mich eine Art Lebenseinstellung. So trage ich ein Stück seiner Gedanken weiter und ehre ihn damit.»
Puck schaute mich an: «Man sollte nie aufgeben, auch wenn es schwierig wird. Wenn man wirklich etwas erreichen will, geht es darum, die härtesten Dinge zu bewältigen.»
Da sagte Liam, der zugehört hatte: «Ich habe auch von diesem Mann gehört. Er war sehr klug und hatte viel für sein Volk geopfert und geleistet. Dieses Zitat gefällt mir sehr. Man soll nie aufgeben! Nie! Auch wenn es unmöglich scheint, man muss daran glauben, dass es möglich ist. Egal, wie schwierig und unerreichbar es scheint. Es zählt der Glaube daran, dass man es erreichen kann.»
Puck stand auf, und hob seine Bierflasche: «Auf Nelson Mandela, er war ein grosser Krieger!»
Ich erhob mich ebenfalls, und alle folgten unserem Beispiel. Wir stiessen auf ihn an. «Cheers!»
Die Tattoos waren vergessen, wir begannen zu essen und redeten über dies und das. Es war schön, am Feuer zu sitzen und ihren Geschichten und Witzen zu lauschen und mehr von ihrem Leben zu erfahren. Auch ich erzählte aus meinem Leben. Nicht bis ins kleinste Detail, aber von der Schweiz, von der Landschaft, von den Städten …
Schliesslich stellte Thalia die Frage, vor der ich mich gefürchtet hatte: «Und du, Samira? Was machst du so? Du hast uns viel erzählt, von deinem Land, aber von dir wissen wir fast nichts.»
Alle nickten und schauten mich gespannt an.
Liam wollte schon intervenieren, dass sie mich in Ruhe lassen sollten, doch ich legte meine Hand auf seinen Arm und sagte: «Ist okay.» Dann wandte ich mich den anderen zu und fragte: «Was wollt ihr wissen?»
«Alles!», schoss es aus Jennas Mund, und alle lachten.
«Nein, ernsthaft, wie wäre es mit: Familie, Freunde, Hobbies?», fragte Jenna und nickte mir aufmunternd zu. Sie hatte schon vergessen, dass ich sie vorher angefahren hatte, und ich war ihr dankbar, nicht nachtragend zu sein.
«Was wisst ihr schon über mich? Wie ich hörte, verbreiten sich Neuigkeiten im Res wie ein Lauffeuer», fragte ich herausfordernd.
«Nicht viel. Du hattest Schwierigkeiten zu Hause und darum wurdest du zu deiner Tante geschickt», sagte Jenna vorsichtig.
Ich wollte nicht über mein Leben in der Schweiz reden, es schmerzte zu sehr, darüber nachzudenken. Ich zündete mir eine Zigarette an. Die fünfte heute. Der Stress mit der Familie, der Schule und Marc. Ich wollte nicht zurückdenken, ich wollte alles vergessen. Lejla, Marie und Shona sind meine engsten Freundinnen, doch über Marc hatte ich bisher mit niemandem gesprochen.
«Was hast du angestellt, dass deine Eltern dich hierhergeschickt haben?», fragte Puck grinsend.
Ich zuckte mit den Schultern: «Was weiss ich. Alles, was ich machte, war falsch. Ich konnte nie etwas richtig machen. Ich hatte in ihren Augen total versagt.» Leise fügte ich hinzu: «Und so ganz Unrecht haben sie damit nicht.» Ich nahm einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche und warf die Zigarette ins Feuer. «Ihr habt bestimmt nicht eine solch bekloppte Familie!»
Jenna schnaubte empört auf: «Da liegst du komplett daneben. Du kannst froh sein, überhaupt eine Familie zu haben. Hier im Reservat gibt es alles, ausser ganze Familien.» Jenna zögerte kaum merkbar, dann fuhr sie traurig fort: «Mein Vater hat sich erhängt, als ich zehn Jahre alt war. Meine Mutter arbeitet den ganzen Tag, und meine neunzehnjährige Schwester hat einen kleinen Sohn. Der Vater des Jungen ist abgehauen. Die Sozialhilfe und die Witwenrente reichen uns knapp zum Überleben. Ich jobbe, wann immer ich kann, und meine Schwester arbeitet als Kellnerin, während unsere Grandma auf den Kleinen aufpasst. Frag mal die anderen! Bei denen sieht’s nicht besser aus!»
Thalia sagte: «Mach mal halblang, Jenna.»
«Hör auf, Thalia. Samira soll ruhig die Wahrheit wissen.»
Thalia erwiderte nichts, und Jenna fuhr fort: «Thalias Mutter ist vor einem Jahr bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ihr Vater arbeitet hart, um sie und die beiden jüngeren Brüder über die Runden zu bringen.»
Puck unterbrach Jenna abrupt, als sie weitererzählen wollte, und eine unangenehme Stille breitete sich aus. Ich war geschockt und zutiefst betroffen. Beschämt schaute ich zu Boden. Ich war so naiv mit meinen ein, zwei Problemen. Aber wie gut ging es mir im Vergleich zu ihnen! «Es tut mir leid. Ich bin ein Idiot.» Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und hatte das Gefühl, jedes Wort mache alles nur noch schlimmer.
Puck boxte mich freundschaftlich in den Oberarm: «Schon okay. Genug vom Res! Jenna hat dir etwas unsanft auf die Sprünge geholfen.»
Ich schaute ihn zerknirscht an und fragte: «Aber warum könnt ihr noch lachen? Warum seid ihr so glücklich, wenn ihr nichts zu lachen habt?»
Jenna antwortete: «Es ist unsere einzige Waffe. Wenn wir nicht mehr lachen, haben wir alles verloren. Solange wir lachen, gibt es Hoffnung.»
Ich war beeindruckt, und gleichzeitig fragte ich mich, woher sie diese Kraft hatten. Woher bloss? Ich hatte meine irgendwo verloren.
Thalia entgegnete: «Jenna hat Recht. Wir müssen nach vorne schauen, das Leben geht weiter. Wir dürfen uns nicht an der schmerzhaften Vergangenheit festklammern. Unsere Geschichte hat mit der Eroberung durch die Weissen eine dramatische Wende genommen. Wir können es nicht ändern. Aber wir sind nicht alleine, wir halten alle zusammen. Und zusammen können wir für eine bessere Zukunft kämpfen.»
Ich hatte einen dicken Kloss im Hals. Ich spürte den Schmerz und die Trauer, die sich in ihren Herzen verbargen. Ich fühlte mich schwach und unbedeutend. Die Einsamkeit umschloss mich, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als zu Hause bei meinen Freundinnen zu sein.
Da stand Thalia auf: «Ich gehe Holz holen, kommst du mit, Samira?»
Ich nickte gedankenverloren und folgte ihr in die dunkle Nacht. Wir gingen schweigend. Die Sterne leuchteten hell, und wir folgten einem kleinen Weg. Beim Pick-up angekommen, wollte ich die Kiste voller Holzscheiter von der Ladefläche heben, doch Thalia legte ihre Hand auf meine und sagte: «Lass uns eine Weile hier sitzen und die Sterne betrachten.» Sie setzte sich auf die Ladefläche des Pick-ups. Ich setzte mich neben sie und schaute in den Himmel. Die Sterne leuchteten, und der Wind wehte durch mein Haar. Ich versuchte, meine trüben Gedanken zu verdrängen, indem ich nach Sternbildern suchte.
«Ich weiss, wir kennen uns kaum, aber ich mag dich. Wenn du reden willst: Ich bin eine gute Zuhörerin. Ich spüre, dich bedrückt etwas.»
Wie erstarrt sass ich neben ihr und sagte kein Wort.
«Ich will dich nicht bedrängen, ich möchte nur, dass du weisst, du bist nicht allein.»
Woher wusste sie, dass mich etwas bedrückte? Ich war gerührt, aber es machte mir auch Angst. Ich spürte die tiefe innere Ruhe, die Thalia ausstrahlte. Mein Körper entspannte sich langsam. Ich war dankbar, mit ihr hier zu sitzen, und vergass für einen Moment allen Kummer. «Danke, Thalia. Ich weiss das zu schätzen. Irgendwann werde ich vielleicht darauf zurückkommen.»
Ich wollte sie nicht kränken, und darum sagte ich nicht: Ich werde nie mit dir darüber reden können, wenn ich nicht einmal mit meinen besten Freundinnen darüber sprechen kann.
«Weisst du, Samira, meine Mutter hatte immer gesagt: Die Sterne sind unsere Wegweiser. Aber manchmal braucht es die Dunkelheit, um die Sterne wieder sehen zu können.»
Ich dachte über Thalias Worte nach. «Ich hoffe, deine Mutter behält Recht.»
Thalia drückte meine Hand: «Glaub mir, meine Mutter hat immer Recht gehabt.»
Wir schauten noch eine Weile in den Himmel, dann hievten wir die Kiste mit den Holzscheitern vom Pick-up und schleppten sie zum Feuer.