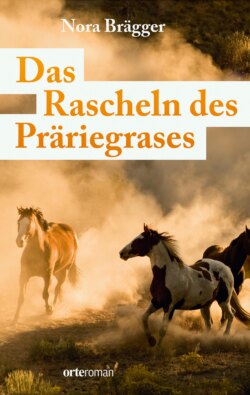Читать книгу Das Rascheln des Präriegrases - Nora-Lena Brägger - Страница 9
ОглавлениеAm nächsten Morgen um Viertel nach sechs klingelte mein Wecker. Ich drehte mich auf die andere Seite, drückte das Kopfkissen an meine Ohren und wünschte mir, dass es nicht schon Morgen wäre. Ich überwand mich, schlug die Bettdecke zurück, setzte mich auf, stellte den Wecker mürrisch ab und zog mich an. In den Socken, mit den Schuhen in der Hand, schlich ich leise nach unten, um die Kinder nicht zu wecken. Jul stand bereits in der Küche und kochte Kaffee, es duftete herrlich. Nichts ging über einen guten Kaffee und danach eine Zigarette. Ich trank meinen Kaffee, Schluck für Schluck, und ging dann nach draussen, um eine zu rauchen. Erstaunlicherweise hatte Jul nichts gegen das Rauchen gesagt, oder vielleicht noch nicht?! Ich setzte mich auf die Bank auf der Veranda und schaute zu, wie die Sonne am Horizont erschien und immer grösser wurde. Dann gingen wir in den Garten.
Eineinhalb Stunden lang befreiten wir die Beete von Unkraut, gossen die Pflanzen und flickten den Gartenzaun. Dann standen die Kinder auf, und Jul schickte mich ins Haus, um mit ihnen zu frühstücken. Naomi zeigte mir, wie man Pancakes zubereitete. Die Pancakes, die ich am Tag zuvor gemacht hatte, waren nicht halb so gut wie ihre. Naja, was soll’s! Ich ass mit den Kindern, räumte die Küche auf und ging anschliessend mit ihnen nach draussen, um zu spielen. Ich mochte die Kinder sehr. Sie waren überhaupt nicht scheu und fragten und erzählten, wie es nur Kinder machen. Diese offene und direkte Art, ihre unverblümte Neugierde und ihre Phantasien – genau das vermisste ich bei den Erwachsenen. Es ging irgendwann zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsenwerden verloren.
Wir spielten mit den Holzfigürchen, hatten Spass am Verstecken und Fangen. Anschliessend kramten Ron und Leon ihre Spielzeugautos hervor, und ich frisierte mit Naomi ihre Puppen. Nach dem Mittagessen brauchte ich meine Ruhe und zog mich in mein Zimmer zurück.
Meine gute Laune war verflogen. Ich brauchte eine Pause von den Kindern, doch was sollte ich nun tun? Ich hatte keine Idee. Ich versuchte mir vorzustellen, was ich zu Hause machen würde. Das nützte mir nichts. Denn alles, was mir in den Sinn kam, konnte ich hier nicht machen. Ich ärgerte mich immer mehr. Ich hasste es, herumzuhängen und mich zu langweilen. Je länger ich darüber nachdachte, was ich machen könnte, desto wütender wurde ich. Da klopfte es an meiner Zimmertüre, und Bills raue Stimme ertönte: «Samira? Ich muss nach Kyle fahren, um ein paar Dinge zu erledigen … wenn du willst, kannst du mitkommen. Dann siehst du etwas vom Reservat.»
Schon war ich aus dem Bett gesprungen, schnappte meine Tasche und riss die Zimmertür auf: «Bin bereit, es kann losgehen!» Bill schaute mich verblüfft an: «Na, dann lass uns gehen.»
Jul und Bill hatten zwei Autos, einen Jeep und einen Pick-up mit einer grossen Ladefläche, auf den wir zusteuerten. Ich nahm an, Bill brauchte ihn für seine Arbeit, um Material zu transportieren.
Neugierig schaute ich aus dem Fenster und betrachtete die Landschaft. Jul wohnte mit ihrer Familie in einem kleinen Tal an den Ausläufern eines Hügels. Als wir um den Hügel herumbogen, konnte ich mehrere Häuser oder, besser gesagt, Fertighäuser aus Plastik sehen. Die sogenannten Trailers standen verstreut, wie kleine Bauklötzchen, die irgendwo hingeworfen worden waren, in der Landschaft. Wir fuhren an dem ersten Trailer vorbei: Er sah sehr heruntergekommen und schmuddelig aus. Nach weiteren zehn Minuten bogen wir auf eine Schotterstrasse ein. Die Landschaft um uns herum war karg und trocken. Vereinzelte Grasbüschel und sonst nichts. Trostlos. Wir fuhren eine halbe Stunde oder mehr. Es kam mir endlos vor.
Inzwischen fuhren wir auf einer Asphaltstrasse. Plötzlich tauchten links und rechts von der Strasse Häuser auf, und kurz darauf waren wir in Kyle. Bill erzählte mir, Kyle sei die nächste grössere Stadt. Es gab zwei Tankstellen, eine davon hatte einen Lebensmittelladen, ein Kulturzentrum mit dem Kyle Food Stop Café, eine Kirche, die Little Wound School, was so viel wie Büffelkopfschule bedeutet, und eine Menge ziemlich heruntergekommener Wohnhäuser. Überall an den Strassenrändern und neben den Häusern stapelten sich Müll, Autowracks und einfach alles, was die Leute nicht mehr brauchten. Wie konnte man zwischen all diesem Schrott leben? Einmal mehr schien es mir, als könnte Bill meine Gedanken lesen: «Für uns Indianer haben Dinge wie Autos, Möbel oder elektronische Geräte keinen Wert. Besitz hat keinen Wert und das hat zur Folge, dass viele den Sachen keine Sorge tragen.»
«Das kann ich ja einigermassen verstehen. Aber es kann doch nicht sein, dass man alles liegen lässt. Ich dachte immer, für euch Indianer sei die Natur euer Ein und Alles!»
«Das stimmt. Die Mutter Erde ist uns heilig.»
«Warum verschmutzt ihr sie denn, wenn sie euch heilig ist?»
«Ich weiss es nicht. Ich gebe mir alle Mühe, es nicht zu tun. Die Zeiten haben sich geändert. Viele haben die alten Werte vergessen und leben ganz nach dem Motto Nummer eins in den USA: verbrauchen. Und auf der anderen Seite hat sich hier im Reservat in den letzten Jahren nicht viel getan. Die Entsorgung ist zum Beispiel sehr schlecht organisiert oder existiert gar nicht.»
«Wovon leben die Menschen hier? Gibt es Jobs?»
«Das ist das grosse Problem! Die Arbeitslosenquote liegt bei fünfundachtzig Prozent!»
«Fünfundachtzig Prozent?»
«Ja! Das ist eine unglaubliche Zahl.»
Ich schluckte leer. Das war mir unvorstellbar.
«Es gibt hier keine Arbeit, es gibt keine Industrie, das Land ist unfruchtbar und zum Teil durch Chemikalienentsorgungen der Regierung verseucht. Wer Land besitzt, verpachtet es an Grossunternehmen der weissen Farmer.»
«Gibt es so etwas wie Sozialhilfe?»
«Ja. Dazu kommen Lebensmittelmarken für Kinder.»
«Dann gehört ihr, also du und Jul, sozusagen zu den Wohlhabenden?»
«Wenn du es so formulieren willst.»
«Wie würdest du es sagen?»
«Auch wenn es hier viele Steine im Weg hat, würde ich behaupten, man kann es auch hier zu etwas bringen. Mit viel Geduld und dem Glauben, dass man etwas erreichen kann. Viele haben die Hoffnung auf Verbesserung unserer Lebensumstände aufgegeben, aber von alleine wird sich nichts ändern.»
«Hmm … die Energie, die man ausstrahlt, kommt zurück, sei es negativ oder positiv!»
«So ist es.»
Wir hielten an der Tankstelle, und Bill tankte den Wagen. Etwas ausserhalb der Stadt bogen wir auf einen Feldweg ein, der zu einer kleinen Siedlung auf einer Anhöhe führte. Bill hielt den Pick-up vor einem kleinen Haus an, das mit einem Gerüst umstellt war. Zwei junge Männer waren dabei, das Gerüst zu demontieren und auf einen alten Truck zu laden. Bill stieg aus und winkte mir. Ich folgte ihm. Er grüsste die zwei Männern und ging die Holztreppe zur Veranda hinauf. Die beiden musterten mich. Sie sagten etwas in einer mir fremden Sprache und lachten. Es musste Lakota sein, die Sprache der Lakotaindianer. Ich hob die Augenbrauen und schaute sie fragend an.
Sie lachten noch mehr, und so sprang ich die Treppe hinauf zu Bill, der vor der Haustüre stand.
«Was haben die gesagt? Was war so unglaublich lustig?», wollte ich von Bill wissen, doch er schüttelte den Kopf: «Mach dir nichts draus.»
«Ich will es aber wissen.»
«Na gut. Es gibt da eine alte Geschichte über eine Frau, die überirdisch schön war und in den Tiefen des Waldes im Norden lebte. Höchstselten wurde sie gesehen, denn sie war sehr geschickt und schnell. Viele junge Männer versuchten, sie zu finden und um ihre Liebe zu kämpfen. Aber sie hatte ein kaltes Herz und brachte alle um. Ein Blick mit ihren tief grünen Augen genügte, und die Männer starben unter höllischen Schmerzen und zerfielen in Tausende von Blättern, die der Wind davon trug.»
«Okay, und an das glaubt ihr? Das ist nicht dein Ernst?»
«Es ist eine alte Geschichte, die man sich gerne erzählt.»
«Suuper, und jetzt haben alle das Gefühl, ich sei diese grausame, wilde Frau, nur weil ich grüne Augen habe?»
Er lachte: «Nein, natürlich nicht. Mach dir nichts aus diesen zwei Witzbolden.»
Ich verzog den Mund und drehte mich überrascht um, als plötzlich eine ältere Frau die Türe öffnete. Sie begrüsste Bill, und schaute mich freudig überrascht an und meinte: «Oh, hallo meine Liebe, du bist wohl die Nichte aus der Schweiz.»
Ich schaute sie ebenfalls überrascht an und sagte: «Ja, die bin ich. Woher wissen Sie das, Mam?»
Sie und Bill lachten. «Kindchen, hier wissen immer alle sofort den neusten Klatsch.»
Na toll, dachte ich, was wussten sie wohl alles über mich?
Sie führte uns in die Küche. Wir setzten uns an den Küchentisch. Sie schenkte uns Kaffee ein und setzte sich zu uns. Ich schaute sie fragend an, und sie meinte: «Wenn hier mal etwas Spannendes passiert, wissen es sofort alle, darauf kannst du zählen! Und übrigens, Samira, du kannst mich Aaliyah nennen! Ich bin die Mutter von Bill.»
Jetzt, wo sie es sagte, erkannte ich die Ähnlichkeit: Sie hatten dieselben Augen. Wieso war ich nicht vorher draufgekommen?
Bill und Aaliyah besprachen ein paar Dinge, dann verabschiedeten wir uns und fuhren zurück auf die Asphaltstrasse. Wir fuhren etwa zwei Meilen Richtung Norden, bevor wir wieder auf einen kleinen Feldweg einbogen. Nach kurzer Zeit erreichten wir einen alten Schuppen. Zwei Trucks standen davor, und Bill parkte daneben. Dieses Mal blieb ich im Wagen und kramte meine Headphones aus meiner Tasche. Nach einer halben Stunde kam Bill zurück. Er hatte die Ladefläche des Trucks mit Holzlatten und anderen Baumaterialien beladen.
Ich bereute es langsam, mitgegangen zu sein, denn ich fragte mich, was ich hier sollte. Zusehen, wie er mit seiner Mutter Kaffee trinkt und wie er Holzlatten auflädt? Und was nützte es mir, wenn ich wusste, Kyle ist die nächste grössere Stadt, wenn es dort nicht einmal ein Kino, ein Shoppingcenter oder sonstige Freizeitangebote gab? Bill hatte bemerkt, dass ich mich langweilte, und sagte: «Sorry, das hat etwas länger gedauert, als ich dachte. Aber jetzt fahren wir zu meinem Bruder Jim, Liam ist sein Sohn.»
«Oh, okay.» Mein Interesse war geweckt. Liam war also der Cousin von Naomi, Ron und Leon. Das hatte er mir nicht erzählt. Dann war er auch irgendwie mein Cousin, oder etwa nicht? Auf jeden Fall freute ich mich auf ein Wiedersehen mit Liam. Ich mochte ihn sehr und hoffte, er würde mir die Zeit hier etwas erträglicher machen.
Ich schaute aus dem Fenster. Überall entlang der Strasse lagen Dosen und zersplitterte Glasflaschen. Da fiel mir ein farbiger Fleck nahe der Fahrbahn auf, und ich kniff die Augen zusammen, um ihn besser zu sehen. Als wir schon fast vorbeigefahren waren, erkannte ich, was es war: ein geschmücktes kleines Kreuz. Während unserer kurzen Fahrt auf dem Highway sah ich noch zwei weitere Kreuze.
«Bill?»
«Ja?»
«Hier gibt es wohl viele Unfälle?»
«Meinst du wegen den Kreuzen am Wegrand?»
«Ja.»
«Hmm … Hast du auch die vielen Flaschen bemerkt?»
«Ja.»
«Der Alkoholkonsum ist ein grosses Problem, dazu kommt die hohe Selbstmordrate, gerade unter Jugendlichen.»
Mir lief ein Schauer über den Rücken, und ich versuchte, die Bilder in meinem Kopf zu vertreiben. Schweigend fuhren wir weiter. Irgendwann erreichten wir eine Schotterstrasse. Bill hielt den Pick-up an und stieg aus. Ich schaute zu, wie er um das Auto herumging und die Beifahrertür öffnete: «Rutsch rüber! Du kannst jetzt weiterfahren.»
Ich schaute ihn wohl ziemlich verdattert an, denn er lachte. «Du weisst schon, dass ich nicht Autofahren kann?», erwiderte ich stirnrunzelnd.
«Ja klar, darum sollst du es nun lernen, denn ohne Auto ist man hier aufgeschmissen.»
Aufgeregt rutschte ich auf den Fahrersitz. Bill erklärte mir, wie ich den Pick-up zu handhaben hatte, dann lehnte er sich zurück und wartete gespannt, dass ich losfuhr. Ich startete den Motor, hob den Fuss von der Bremse und der Wagen rollte los. Ich war unsicher am Anfang, doch mit der Zeit ging es immer besser, und es machte richtig Spass. Ich war noch nie am Steuer eines Autos gesessen. Ich fuhr einen Pick-up durch die Prärie. Ich schmunzelte. Das war cool.
Wir hielten vor einem neuen Holzhaus, in dem Liam mit seiner Familie wohnte. Ich erkannte dahinter eine Koppel mit Pferden und einen Schuppen. Wir stiegen aus, und ein Hund kam schwanzwedelnd unter der Veranda hervor. Er kläffte mich kurz an, hörte aber auf, als ich in die Hocke ging und ihn meine Hände beschnuppern liess.
Da ging auch schon die Tür auf und eine kräftige Frau um die Vierzig kam heraus. Sie hiess Amelie und war Bills Schwägerin. Sie begrüsste mich herzlich und führte uns ins Haus. Im Wohnzimmer waren zwei Mädchen dabei, zwei helle Hemden mit Perlen zu besticken. Als sie uns sahen, blickten sie neugierig auf und stellten sich als Eboney und Ayana vor. Sie waren Liams jüngere Schwestern. Bill ging mit Amelie in die Küche, und ich setzte mich zu den Mädchen.
Eboney fragte mich: «Weisst du, was ein Powwow ist? Wahrscheinlich nicht, oder?»
«Ich habe schon davon gehört. Ist das ein Tanzfest?»
«Ja. Ein Powwow ist ein Musik- und Tanzfest der Indianer. Für die Weissen sind die Powwows heute in erster Linie ein Abbild der traditionellen Lebensweise der Ureinwohner, der nordamerikanischen Indianer. Für uns bedeuten die Powwows viel mehr. Die Zeremonie des Einzugs in die Tanzarena ist heilig, und beim anschliessenden Tanzen ehrt man die verstorbenen Krieger und Führer unseres Volkes. Solche Feste sind wichtig für uns Indianer. Wir können so unsere Traditionen weiterleben und sie stärken.»
Ayana nickte und hob ihr Hemd hoch: «Schau, wir sind seit Monaten daran, unsere Kleider zu nähen, mit Perlen zu besticken und mit Federn zu verzieren!»
Ich war beeindruckt von diesen wunderschönen Kleidern, die sie selbst genäht hatten. «Eure Kleider sind wunderschön! Vielleicht kann ich ja auch kommen zu diesem Powwow … Jul und Bill gehen bestimmt.»
«Ja klar, sie kommen auch. Bill wird als Tänzer teilnehmen wie jedes Jahr.»
«Genauso wie ich!», sagte plötzlich eine Stimme hinter mir, und ich drehte mich um. Liam lehnte im Türrahmen und grinste mich an. Ich lachte freudig zurück. Sein Grinsen war der Hammer: Er sah aus wie ein zu gross geratener Kobold.
Liam fragte: «Willst du mein Kleid sehen?»
«Ja, gern.»
«Na, dann komm!»
Ich folgte Liam, der am Ende des Gangs eine Tür öffnete. Wir traten in ein kleines Zimmer. Es hatte ein Fenster, davor stand ein Schreibtisch mit einem Stuhl, an der Wand neben der Türe ein Bett, daneben ein Regal, das mit Büchern vollgestopft war. Auf der anderen Seite war ein Kleiderschrank.
«Ist das dein Zimmer?», fragte ich überflüssigerweise, und er nickte.
Er öffnete den Kleiderschrank und nahm vorsichtig ein wunderschön verziertes Hemd hervor. Es war anders als die Kleider seiner Schwestern. Es war sehr bunt mit vielen farbigen Zotteln und Fäden verziert.
«Gefällt es dir? Ich habe den ganzen Winter dran gearbeitet.»
«Es sieht verrückt aus», sagte ich fasziniert.
Er schaute mich etwas enttäuscht an, und ich fügte schnell hinzu: «Verrückt im Sinn von unglaublich, es ist der Hammer! Du wirst bestimmt toll darin aussehen und erst recht, wenn du tanzt.»
Er strahlte mich mit seinem typischen Grinsen an: «Tja, dann musst du wohl kommen und mir zusehen!»
«Ja, das muss ich wohl machen. Schliesslich bist du mein FastCousin.»
«Ja, könnte man so sagen. Fast-Cousine … das tönt ziemlich cool!»
«Nein, sind wir ehrlich, es tönt absolut beschissen! Lassen wir das lieber!»
«Okay.»
Ich setzte mich auf seinen Stuhl und sah mich etwas genauer im Zimmer um. «Du liest viel.»
«Meine Hauptbeschäftigung im Winter.»
«Ist es sehr kalt im Winter?»
«Ja. Wenn man ein Haus hat, das gut isoliert ist und genügend Brennholz für den Ofen hat, ist es kein Problem. Aber es gibt jedes Jahr Leute, die es nicht über den Winter schaffen.»
Ich konnte mir das nicht vorstellen. In der Schweiz starb man, wenn man eine unheilbare Krankheit wie Krebs oder einen Unfall hatte. Hier starben Menschen, weil sie nicht genügend Geld für Brennholz hatten und deshalb erfroren. Das war krass. Ich wollte nicht länger darüber nachdenken, und fragte Liam, was ich ihn schon lange fragen wollte: «Was machst du den ganzen Tag? Du hast jetzt Ferien, oder?»
«Ja, so könnte man es nennen.»
«Was kann man hier überhaupt machen? Gibt es hier irgendwelche Clubs oder Bars? Wie weit weg ist die nächste grössere Stadt? Also ich meine grösser als Kyle, ich meine eine richtige Stadt …»
Er sass auf seinem Bett und schaute mich stirnrunzelnd an. «Naja, man kann eine Menge machen: reiten, baden, campen, grillieren, lesen … im Reservat bestand bis vor einem Jahr Alkoholverbot, darum gibt es keine Clubs oder Bars.»
«Moment einmal! Ihr hattet hier ein Gesetz, das den Alkoholkonsum verbot?»
«Genau. Aber wirklich viel hat es nicht genützt. Denn es gab viele Möglichkeiten, trotzdem an Alkohol zu kommen. Leider.»
«Und wieso wurde es aufgehoben?»
«Frag mich nicht! Die Aufhebung hat das Alkoholproblem auch nicht gelöst. Jetzt ist es legal, und wieso sollte man nun aufhören, zu trinken? Es gibt viele, die ihre Sozialhilfebeiträge versaufen und total abhängig werden vom Alkohol. Obwohl ihre Familien zu Hause kaum etwas zu essen haben, geschweige denn Feuerholz für den Winter, warme Kleider, Spielsachen oder Geschenke für die Kinder. Der Alkohol zerstört die Chance für eine Zukunft, für ein einigermassen normales Leben. Viele Weisse sehen deswegen in uns Indianern nur ein faules, versoffenes Pack.»
Er war immer wütender geworden. Ich hatte offensichtlich einen wunden Punkt getroffen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich kam mir total unwissend vor. Eigentlich dachte ich, dass ich mit Liam gut auskam. Nun war ich mir nicht mehr so sicher. Wir kamen aus zwei völlig verschiedenen Welten und hatten womöglich keinerlei Verständnis für diejenige des anderen. Ich hatte keine Ahnung vom Leben im Reservat. Ich wollte nicht hier sein. Ich wollte zurück in die Schweiz. Verdammt.
«Ich hatte keine Ahnung. Ich weiss nicht, wie das Leben hier ist. Ich wollte nur wissen … ich dachte … ach, vergiss es einfach!» Ich stand auf und ging aus dem Zimmer, ich hörte wie Liam aufsprang und meinen Namen rief. Doch ich wollte nur noch raus. Ich sprang die Treppe von der Veranda hinunter und schaute mich um. Wo sollte ich hin? Den Weg nach Hause kannte ich nicht. Auf gut Glück drauflos laufen war keine Option. Ich hatte Angst mich zu verlaufen, und wer wusste schon wie Indianer auf ein junges weisses Mädchen reagierten, das alleine durch die Gegend irrte?
Schliesslich ging ich zur Pferdekoppel. Dort standen vier Pferde und hoben neugierig ihre Köpfe, als ich mich an den Zaun lehnte. Sie kamen alle und beschnupperten mich. Ich strich über ihr weiches Fell und schlüpfte schliesslich zwischen den Holzlatten hindurch, um sie besser kraulen und streicheln zu können. Zwei Stuten hatten einen kugelrunden Bauch, und ich nahm an, sie seien trächtig. Ich setzte mich auf den harten Boden und sah den Pferden zu, wie sie an dem vertrockneten Gras herumknabberten oder einfach da standen und die letzten Sonnenstrahlen genossen. Der grössere Schecke hatte das Sagen über die kleine Herde. Denn er blickte immer wieder wachsam in die Gegend. Als die Pferde kurz den Kopf hoben, um dann ruhig weiterzugrasen, drehte ich mich um. Liam kam auf mich zu. Ich hatte ihn nicht bemerkt und staunte über das Gehör der Pferde. Liam schwang sich mit einem geschmeidigen Sprung über den Zaun und liess sich im Schneidersitz neben mir zu Boden.
«Samira, es tut mir leid. Ich weiss, du wolltest nur wissen, was im Res so läuft. Beim Thema Alkohol drehe ich immer ein wenig durch. Ich wollte dich nicht belehren. Du kommst aus der Schweiz, du kennst das Leben hier nicht. Ich habe meine Wurzeln hier im Res, und ich kenne dein Leben nicht.»
«Ist schon okay. Du musst dich nicht entschuldigen. Weisst du, ich fühle mich einfach allein und verloren. Ich kenne niemanden, und ich habe keinen blassen Schimmer, wie das Leben hier ist. Ich vermisse mein Leben, das ich kannte und liebte!»
Er dachte eine Weile nach, dann sagt er: «Weisst du was, ich werde ein paar Freunde zusammentrommeln, und dann werden wir morgen Abend zusammen ein Feuer machen. Ich werde sie dir vorstellen, dann wirst du bald ein paar Leute mehr kennen. Das Leben hier ist anders als deines in der Schweiz, aber es ist nicht alles schlecht. Ich werde es dir zeigen, wenn du willst.»
«Das wäre toll! Ich würde gerne deine Freunde kennenlernen, und ja, ich würde gerne dein Leben kennenlernen. Ich will einfach nicht herumhängen und mich zu Tode langweilen. Ich will das Beste aus meiner Zeit hier machen.»
«Los, komm, ich bringe dich nach Hause!», sagte Liam und sprang auf die Füsse. Ich streckte ihm meine Hände hin, und er zog mich hoch.
«Hol deine Tasche und sag Bill Bescheid, ich werde bis dann bereit sein.»
Ich lief zum Haus zurück, und als ich wieder auf die Veranda hinaustrat, blieb ich überrascht stehen. Ich weiss auch nicht, was ich gedacht hatte. Aber sicher nicht an das, was mich vor dem Haus erwartete: Liam sass auf dem grossen Schecken und grinste mich amüsiert an, als er mein verwundertes Gesicht sah.
«Das ist jetzt nicht dein Ernst? Ich kann nicht reiten! Ich bin noch nie geritten!»
«Na los, nur keine Angst! Ich kann reiten, ich werde dich halten, und du musst nur die Bewegungen von Heyoka mitmachen», sagte Liam seelenruhig und zwinkerte mir zu.
Ich lachte: «Denkst du etwa ich habe Angst?» Ich lief zu ihm, er schwang sich vom Pferd, verschränkte die Hände zu einer Räuberleiter und eins, zwei, drei, schon sass ich auf dem Pferderücken. Mit einem Satz schwang sich Liam vom Boden auf das Pferd und sass hinter mir. Er nahm die Zügel in die Hand und schloss gleichzeitig seine Arme um meine Taille. Ob mir das recht war, konnte ich mich nicht fragen, denn schon ging es los.
Wir ritten querfeldein. Liam gab mir immer wieder kleine Tipps, und so ging es ganz gut, zumindest, solange wir im Schritt blieben. Ich konnte es kaum glauben: Ich ritt auf einem Pferd ohne Sattel durch die Weiten der Prärie, hinter mir auf dem Pferd ein waschechter Indianer. Es war ein tolles Gefühl auf dem Pferd durch die Gegend zu reiten, Hügel hinauf und hinab, durch kleine Täler, vorbei an Trailern und quer über Strassen. Es sah alles ganz anders aus als aus dem Auto. Ich nahm die Umgebung anders war. Intensiver.
Als wir einen weiteren Hügel erklommen und ich im Tal Juls Farm sah, ging die Sonne am Horizont langsam unter. Der Himmel hatte die knalligsten Farben, und es sah richtig kitschig, aber wunderschön aus. Ich war glücklich.
Wir ritten ins Tal hinunter auf einem kleinen Trampelweg, der zum Haus führte. Vor der Veranda hielt Liam das Pferd mit einem tiefen Hohw an und schwang sich hinab. Dann nickte er mir zu, auch abzusteigen. Meine Pobacken und Oberschenkel schmerzten höllisch, und als ich mich bewegen wollte, leisteten sie gehörig Widerstand. Ich stöhnte, und Liam sagte lachend: «Muskelkater ist ganz normal, mit der Zeit wird er vergehen. Los, schwing dein Bein über den Rücken und lass dich dann langsam hinuntergleiten. Ich werde dich auffangen.»
Ich folgte seinen Anweisungen und schwang mein Bein über Heyokas Rücken. Aber ich hatte zu viel Schwung und landete auf allen Vieren auf dem Boden. Liam konnte sich kaum halten vor Lachen, und Heyoka schaute mich verwundert an. Es kam mir vor, als würde sogar das Pferd über mich schmunzeln. Ich stand auf und klopfte mir den Staub von den Shorts. Ich boxte Liam in die Rippen und erwiderte: «Hey, ich dachte du fängst mich auf!»
«Entschuldige! Darauf war ich nicht gefasst. Es sah zu komisch aus.»
Wir lachten erneut.
Schliesslich kam Bill mit dem Truck um den Hügel gefahren, und Liam verabschiedete sich von mir. Er ging zu seinem Pferd, das vor dem Haus graste, schwang sich darauf und galoppierte den Hügel hinauf. Ich schaute ihnen nach, bis sie verschwunden waren.
Bill kam auf mich zu, klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter und fragte: «Und wie war es?»
«Es war toll! Ich will unbedingt reiten lernen! Kann ich eure Pferde reiten? Wirst du mir zeigen, wie es geht?», sprudelte es aus mir heraus. Ich klang und fühlte mich, wie ein zehnjähriges Mädchen, doch das war mir egal. Ich war voller Elan und spürte seit Langem endlich wieder Freude und Begeisterung.
Bill lachte. «Ganz langsam, Samira. Wir gehen jetzt ins Haus und essen zuerst. Ich bin am Verhungern.»
Meinen Hunger hatte ich nicht bemerkt. Jetzt spürte ich meinen Bauch deutlich reklamieren, und man hörte ein Knurren. Bill und ich lachten und traten in die Küche, wo Jul gerade mit dem Kochen des Abendessens fertig war.