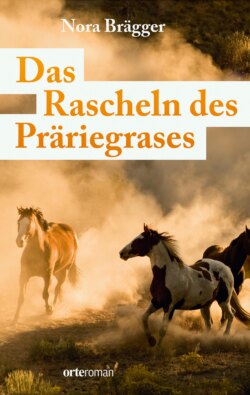Читать книгу Das Rascheln des Präriegrases - Nora-Lena Brägger - Страница 7
ОглавлениеIch erwachte von den Sonnenstrahlen, die auf meinen Wangen tanzten. Für einen kurzen Moment schien alles vergessen zu sein, alle meine Sorgen und Ängste wie in Luft aufgelöst. Ich betrachtete die kleinen Staubteilchen, die im Sonnenlicht auf und ab schwebten. Dann sah ich mich ratlos in einem fremden Zimmer um. Ich fragte mich, wo ich war. Ich stand verwirrt auf und setzte mich erschöpft auf das Bett zurück, als die Erinnerungen wie ein Gewitter über mich hereinbrachen. Die Ruhe und Zufriedenheit, die ich zuerst verspürt hatte, waren urplötzlich verschwunden. Ich war nicht zu Hause in der Schweiz, ich würde nicht aufstehen und mit meinen Freundinnen nach Spanien in den Urlaub fahren, nein, nichts war normal. Ich war in Pine Ridge, in der Verbannung. Ich ging zum Fenster, zog die schweren, dunklen Vorhänge zu und kroch ins Bett zurück.
Ich musste wohl eingeschlafen sein. Als ich wieder aufwachte und auf die Uhr schaute, war es Nachmittag um halb drei. Nun hatte ich mehr als genug geschlafen, und ich spürte meinen Bauch knurren, ich hatte tierischen Hunger. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wann und was ich zuletzt gegessen hatte. Hastig stand ich auf und zog die Vorhänge beiseite. Ich fühlte mich jetzt deutlich besser als am Morgen, und meine Lebensgeister waren wieder wach. Ich öffnete das Fenster, und eine drückende Hitze kam mir entgegen. Die Luft war stickig und schwer, trotzdem lehnte ich mich aus dem Fenster und schaute mich um. Die Landschaft war trocken, karg und eintönig. Kein Baum, kein grünes Gras. Weit und breit nur Hügel mit vertrocknetem, beige-gelblichem Gras. Das war also die Prärie?! Irgendwie gefiel mir diese Trostlosigkeit. Es passte ganz gut zu meiner momentanen Stimmung. Ich schloss das Fenster und zog meine Kleider aus. Ich fühlte mich schmutzig von der langen Reise, und ging unter die Dusche. Es war herrlich, das warme Wasser über die Schultern prasseln zu lassen, und die steifen Glieder zu dehnen und zu lockern.
Anschliessend schlüpfte ich in Shorts und T-Shirt. Meine nassen Haare band ich zu einem Pferdeschwanz zusammen, etwas Mascara auftragen, die All Stars binden und es konnte losgehen. Ich lief die Treppe hinunter, hielt aber inne, als ich die vielen Bilder an der Wand sah. Ich ging die Stufen neugierig zurück und betrachtete jedes Bild Schritt für Schritt, bis ich im Erdgeschoss angelangt war. Es waren Familienbilder: von den Kindern, von irgendwelchen Zeremonien, und auch von Jul und Bills Hochzeit gab es eine Fotografie.
Das Haus war ganz ruhig und so rief ich zögernd: «Hallo? Jul?»
Als niemand antwortete, ging ich in die Küche. Auf dem Küchentisch fand ich einen Zettel, auf dem mir meine Tante eine Notiz hinterlassen hatte.
Guten Morgen Samira (oder inzwischen Guten Nachmittag?)
Ich hoffe, du hast gut geschlafen und bist nun erholt und munter.
Im Kühlschrank hat es einen Teig für Pancakes, Marmelade, Erdnussbutter usw. Es hat auch noch Spaghetti Bolognese von heute
Mittag. Nimm dir, was du magst …
Ich bin einkaufen gefahren und habe die Kinder mitgenommen.
Bill ist bei den Rindern.
Schau dich etwas um, aber geh nicht zu weit weg vom Hof. Wir sind bald zurück.
Bis später
Deine Tante Jul
PS: Meine Nummer +1 605 459 78 65
Na gut, dann war ich also auf mich allein gestellt. Ich sah mich in der Küche um und entdeckte einen kleinen Radio im Regal. Ich stellte ihn an, und eine Stimme ertönte: «Hallo zusammen! Ich bin wieder zurück! Jetzt kann es weitergehen mit den Musikwünschen von KILI Radio! Ruft an und wünscht euch was! Hier bei eurem KILI Radio! Nun spielen wir The Monsters von Eminem und Rihanna, gewünscht von Loren aus Kyle! Ich wünsche euch viel Spass!»
Aus dem Kühlschrank holte ich den Pancaketeig, erhitzte etwas Butter in der Bratpfanne und fügte eine grosse Portion Teig hinzu. Mein Fuss schlug im Takt der Musik, und bald schnipsten auch meine Finger mit. Als sich Kyra aus Wanblee Happy von Pharell Williams wünschte, drehte ich den Radio auf und tanzte laut mitsingend durch die Küche. Diesen Song musste man einfach lieben!
Ich hatte meinen Pancake ganz vergessen, bis mir ein beissender Geruch in die Nase stieg. Mein Pancake! Scheisse! Schnell flitzte ich zur Pfanne. Es war zu spät. Ich kratzte ihn aus der Bratpfanne, tat nochmals Butter hinein und startete einen neuen Versuch. Nun bewachte ich den Pancake wie einen Goldschatz, und dieses Mal verkohlte er nicht. Nachdem ich es geschafft hatte, mir einigermassen passable Pancakes zu braten, die ich mit viel Marmelade ass, machte ich mich neugierig auf Erkundungstour. Sky hatte mich sofort entdeckt und kam schwanzwedelnd auf mich zu.
Ich wollte früher immer einen Hund haben. Sie sind liebenswerte und treue Gefährten. Meine Eltern waren total dagegen. Ich zitiere, was meine Mutter gesagt hatte: «Ein Hund braucht nur viel Zeit und Futter, und zudem gräbt er Löcher im Garten und zerkratzt den Boden im Haus.» Damit war das Thema erledigt. Ich fand mich irgendwann damit ab, dass wir weder einen Hund noch irgendein anderes Haustier haben würden. Ich kniete auf den Boden und streichelte Sky ausgiebig, dann ging ich Richtung Stall, von wo ich ein Wiehern gehört hatte.
Ich war keine Pferdenärrin, und ich war noch nie geritten. Aber ich mochte diese Tiere mit ihren grossen, klugen Augen und den Ohren, die sie nach vorne und hinten bewegten. Man wusste immer, ob sie zufrieden, aufgeregt, ängstlich oder wild waren. Ganz im Gegensatz zu vielen Menschen, bei denen ich nie den Durchblick hatte, wie es ihnen ging, da ihr Gesicht eine Maske war und sie nicht über ihre Gefühle sprachen oder keine hatten. Ich muss gestehen: Ich hatte auch eine Maske auf. Es war einfacher, die ganzen Gedanken und Gefühle zu verdecken, anstatt offen damit herumzulaufen. Egal, was soll’s, ich zerbrach mir jetzt nicht den Kopf darüber. Ich würde dafür noch mehr als genug Zeit haben.
Ich stand am Koppelzaun und hielt die Hand schützend vor die Augen. Etwas weiter unten bei einer kleinen Buschgruppe standen ein paar Pferde und grasten.
Automatisch dachte ich an meine Schwester Charlotte. Seit sie ein kleines Mädchen war, ritt sie klassisch englisch und hatte schon massenhaft Preise bei Turnieren abgeräumt. Ich konnte nie verstehen, wieso sie ritt, denn ich hatte immer das Gefühl, als würde es ihr keinen Spass machen. Ich ertrug es nicht, wie grob sie mit ihrem Pferd umging. Wie sie ihre Fersen in seinen Bauch schlug, an den Zügeln riss und das Pferd in der erzwungenen Haltung im Kreis trabte. Furchtbar! Sie war nicht die Einzige, die so ritt, praktisch alle, die ich bisher gesehen hatte, sahen das Pferd nicht als ein Individuum mit Herz und Seele, sondern als ersetzbare Turniermaschine. Ich stellte es mir wunderschön vor, auf einem Pferderücken durch die Landschaft getragen zu werden, über Felder zu galoppieren, als würde man fliegen. Bei Charlotte ging es bei allem nur um das Eine: zu gewinnen. Als ihr Springpferd Alexander verletzt war, wurde nicht lange gezögert. Innerhalb von wenigen Tagen war Alexander vergessen, verkauft und das, obwohl sie jahrelang auf ihm geritten war und mit ihm Turniere gewonnen hatte. Alexander war ihr tapferer Begleiter und Freund über Jahre gewesen. Hatte ihre Launen und ihre harten Worte geduldet und sie auf das Podest getragen. Doch dann war er plötzlich nicht mehr von Nutzen und wurde aus dem Weg geschafft. Ich werde nie seine traurigen Augen vergessen, als er von seinem neuen Besitzer in den Pferdeanhänger geführt wurde. Sein Wiehern hatte mir Gänsehaut auf die Arme gejagt.
Von daher hatte ich ein sehr negatives Bild vom klassischen Reitsport. Soviel ich wusste, gab es auch andere Reitweisen und Philosophien rund um das Pferd. Doch wirklich eine Ahnung von Pferden hatte ich nicht. Ich hatte viel indirekt durch meine Schwester in Erfahrung gebracht, weil der Reitsport oft Thema am Familientisch war. Selbstverständlich musste ich auch an die wichtigsten Turniere mitgehen, da sie Familienanlässe waren. Selber zu reiten, hatte ich nie in Betracht gezogen. Ich wollte nicht mit Charlotte konkurrieren. Sie nutzte jede Gelegenheit, mich zu übertrumpfen und wissen zu lassen, sie sei die Beste und ich würde nie besser als sie sein.
Ich vermisste weder meine Schwester noch meine Eltern. Bestimmt nicht! Immerhin etwas Positives an der ganzen Sache: Ich hatte nun ganze zwei, nein, waren es nicht drei Monate, die ich hier sein würde? Egal, auf jeden Fall musste ich sie eine ganze Weile nicht ertragen. Herrlich.
Wieso war ich eigentlich auf der Reise hierher nicht abgehauen? Dann hätte ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Irgendwie war das für mich keine Option. Vielleicht weil ich trotz allem noch einen Hauch Vernunft besitze oder vielleicht auch weil ich Angst hatte. Egal. Nun war ich hier.
Total versunken in meinen trübsinnigen Gedanken, lehnte ich am Koppelzaun und hatte gar nicht bemerkt, wie die Pferde, neugierig geworden, zu mir herübergekommen waren. Ich zuckte überrascht zusammen, als mich eine weiche Nase vorsichtig anstupfte.
«Oh, hallo, meine Liebe. Na, wie heisst denn du? Ich bin Samira.» Ein grosses, braunes Pferd stand vor mir und musterte mich, während seine Ohren hin- und herwackelten. Ich schmunzelte. Es sah zu komisch aus. Das Pferd schnaubte empört, als hätte es meine Gedanken gelesen. Jetzt lachte ich erst recht.
Ich liess mich von den anderen drei Pferden, die gespannt daneben standen, beschnuppern. Zwei von ihnen waren braun, eines hatte vier weisse Fesseln und eine helle Mähne und das andere eine dunkle. Das vierte Pferd war ein Schecke. Sie waren sehr neugierig und stupften mich immer wieder mit ihren weichen Nüstern. Sie hatten kluge, grosse Augen, welche mich wachsam, aber neugierig musterten. Ihr Fell war weich wie Seide und glänzte in der Sonne, als wäre es mit Tausenden Diamanten übersät. Ich strich mit den Fingern über ihr Fell und genoss die Nähe dieser wunderschönen Wesen. Ich hatte keine Angst vor ihnen und fühlte mich ruhig und entspannt.
Irgendwann hatten die vier genug Streicheleinheiten und gingen, um am vertrockneten Grass zu knabbern. Ich beobachtete sie eine Weile, dann suchte ich einen Schattenplatz, denn es war brütend heiss in der Sonne. Schliesslich setzte ich mich auf die Schaukel, die am Baum hing, der neben dem Haus stand. Ich schaukelte leicht hin und her und starrte in die Weite hinaus. Was konnte ich bloss tun? Es war mir eindeutig zu heiss, um meine Erkundungstour fortzusetzen. Ich hatte kein Netz, ich wusste nicht, ob sie hier Wireless hatten, und falls sie hatten, wie das Passwort lautete. Es war niemand da, mit dem ich etwas hätte unternehmen, sprechen oder, was weiss ich, machen können. Na toll, an meinem ersten Tag hier im Reservat wurde ich einfach alleine auf dem Hof gelassen.
Was würde ich die ganze Zeit über hier machen? Ich hatte keine Ahnung und schaute mich verzweifelt um. Nichts als Hügel mit vertrocknetem Gras und noch einer und noch einer … dann der Himmel. Mehr war hier nicht zu sehen. Was fand meine Tante an dieser Landschaft so bezaubernd, um sich hier niederzulassen! Die Trostlosigkeit machte mich traurig. Ich fühlte mich einsam. Was genau hatte mir daran gefallen, als ich aus dem Fenster geschaut hatte? Ich scharrte mürrisch mit den Schuhen auf der vertrockneten Erde. Dann beschloss ich, meine Headphones zu holen und Musik zu hören.