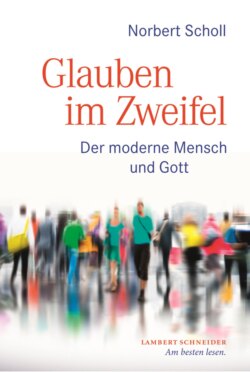Читать книгу Glauben im Zweifel - Norbert Scholl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweifel und Glauben gehören zur Wissenschaft
ОглавлениеDer Zweifel gehört zur Wissenschaft. Denn Zweifel stachelt das Nachdenken an. Etwas bisher scheinbar Selbstverständliches kann plötzlich fragwürdig erscheinen. Wir beginnen, die Argumente genauer zu prüfen, abzuwägen, zu hinterfragen, über Alternativen nachzudenken, andere Theorien zur Erklärung zu entwickeln.
Doch um wissenschaftlichen Ansprüchen genügen zu können, müssen auch diese auf den ersten Blick besser und stringenter erscheinenden Theorien überprüft werden. Seit Karl Popper gilt: Alle Aussagen müssen, um wissenschaftlich zu sein, etwas über die Realität aussagen, intersubjektiv nachprüfbar sein und an der Realität scheitern können. Sie müssen grundsätzlich verifizierbar und falsifizierbar sein.
Allerdings kann es gerade angesichts der hochkomplizierten und immer engmaschiger differenzierten Erkenntnisse vor allem in den modernen Natur- oder auch in den Sozialwissenschaften passieren, |10|dass jemand in einem bestimmten Bereich nicht kompetent genug ist, vielleicht sogar überhaupt nicht kompetent genug sein kann, um seine Überzeugung zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Kompliziert wird es, wenn er gar nicht merkt oder nicht wahrhaben will, dass er inkompetent ist. „It is not ignorance, but ignorance of ignorance, that is the death of knowledge“ (Alfred North Whitehead). Inkompetenz bewahrt vor Zweifel.
Vertreter der sogenannten exakten Wissenschaften behaupten gern, bei ihnen gehe es nicht um Meinen oder Glauben, sondern um Wissen. Ein anschauliches Beispiel dafür bietet der 1959 in Leipzig erschienene „Wegweiser zum Atheismus“: „Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass noch kein Mensch Gott gesehen, gehört oder sonstwie wahrgenommen hat. Es gibt keinerlei echte, wissenschaftlich haltbare Beweise für das Dasein Gottes bzw. für irgendeine göttliche Tätigkeit, weder logisch-theoretische noch praktische. Alle angeblichen Beweise von der Existenz Gottes sind nur der Versuch, durch entsprechende Deutung der wirklichen Welt den Eindruck zu erwecken, als wäre sie nur unter der Voraussetzung Gottes möglich. Die Welt aber besteht ewig. Sie entwickelt sich nach den ihr innewohnenden Gesetzen, und der Mensch ist grundsätzlich in der Lage, sie zu erkennen.“2
Hier hat Inkompetenz über Wissen gesiegt („Die Welt besteht ewig“). Dem Autor oder den Autoren war wohl nicht bewusst, dass auch die exakten Wissenschaften ohne Glauben nicht auskommen. In dem genannten Beispiel ist es der unbedingte Glaube an das atheistische Weltbild. In seiner Frankfurter Antrittsvorlesung hat 1965 der Philosoph Jürgen Habermas darauf hingewiesen, dass auch „in den Ansatz der empirisch-analytischen Wissenschaften … ein technisches … Erkenntnisinteresse“ einfließt. „Erfahrungswissenschaftliche Theorien (erschließen) die Wirklichkeit unter dem leitenden Interesse an der möglichen informativen Sicherung und Erweiterung erfolgskontrollierten Handelns.“3
Jedem naturwissenschaftlichen Experiment geht der Glaube voraus, dass eine bestimmte Versuchsanordnung zu dem erwarteten Ergebnis führen und eine vorausgehende, noch unbewiesene Annahme bestätigen wird. Je komplizierter und vielschichtiger die Erforschung einer bestimmten naturwissenschaftlichen Gegebenheit |11|ist, desto mehr fließen – bewusst oder unbewusst – in das Experiment und sein Ergebnis bestimmte Vermutungen und Deutungen, man könnte auch sagen „Glaubensinhalte“ ein. Dieser „Glaube“ oder, um mit Habermas zu sprechen, dieses „technische Interesse“ der Naturwissenschaften kann erst durch „Selbstreflexion der Wissenschaft“ richtig erkannt werden. So ist nicht zu bezweifeln, dass es Leben gibt; wohl aber können die verschiedenen Theorien über seine Entstehung bezweifelt werden. Für die Bereitschaft zu einer gegebenenfalls erforderlichen Korrektur braucht es zuvor ein „emanzipatorisches Erkenntnisinteresse“4: Es braucht den Zweifel.
Nicht allen Wissenschaftlern ist das bewusst; ihre Wissenschaftsgläubigkeit bleibt unangefochten. Eine ganze Reihe von ihnen ist freilich selbstkritisch genug, um zu erkennen und auch einzugestehen, dass es eben doch noch mehr gibt als das, was sich mit millionenschweren Instrumenten empirisch nachweisen und mit schönen Theorien darstellen lässt. Es sind gerade die klügsten Köpfe unter den Naturwissenschaftlern, die sich nicht scheuen, das demütig zu bekennen: „Das Wissen um die Existenz des für uns Undurchdringlichen, der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtender Schönheit, die unserer Vernunft nur in ihren primitiven Formen zugänglich sind, dies Wissen und Fühlen macht wahre Religiosität aus; in diesem Sinn und nur in diesem Sinn gehöre ich zu den tief religiösen Menschen“, so Albert Einstein5.