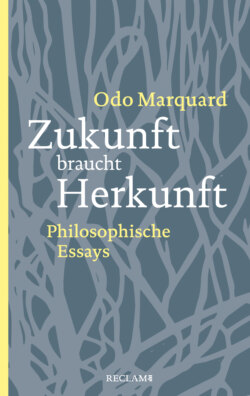Читать книгу Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays - Odo Marquard - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lob des Polytheismus
ОглавлениеÜber Monomythie und Polymythie
Das Bewusstsein der hohen Ehre, die mir widerfährt durch die Einladung, in Ihrem Mythenkolloquium zu sprechen, verbindet sich bei mir mit einer heftigen Furcht und einer zaghaften Hoffnung. Ich fürchte, Sie haben mich eingeladen, weil Sie bei mir mythologiephilosophische Kompetenz vermuten. Das wäre ein glatter Irrtum: ich habe keine. Wohl aber habe ich etwas anderes, nämlich die eben erwähnte zaghafte Hoffnung, dass Sie mich ganz im Gegenteil – um diese meine mythologiephilosophische Inkompetenz mehr als mir lieb sein kann wissend – aus zwei sehr anderen Gründen eingeladen haben, entweder aus dem einen oder aus dem anderen oder sogar aus beiden. Der eine Grund wäre dieser: Sie lassen mich nicht nur trotz, sondern gerade wegen meiner mythologiephilosophischen Inkompetenz sprechen: weil man hier in diesem Kolloquium – sagen wir einmal: aus Paritätsgründen – einen Nichtsachverständigenvertreter zu Wort kommen lassen will mit einer paradigmatisch inkompetenten Äußerung; nur einen zwar (schließlich haben alle Paritätsregelungen einmal klein angefangen), aber immerhin wenigstens einen; und in diesem Fall ist es ganz plausibel, dass man, wenn schon nicht notwendigerweise mich, so doch jedenfalls einen Auswärtigen chartert: Wer will schon eine Untat verrichten und dann am Tatort bleiben müssen? Der andere Grund wäre dieser: Sie haben erfahren, dass ich der Philosophie »Inkompetenzkompensationskompetenz« zuspreche; wenn das – so mögen Sie folgern – generell zutreffen soll, muss es auch im speziellen Fall – also für das Thema Mythos – zutreffen; und dann soll eben der Urheber dieser philosophiebezüglich halbüblen Nachrede einmal zeigen, was er einschlägig zu bieten hat.
Wohlan denn, ich biete: und zwar ein Lob des Polytheismus. Und ich trage damit natürlich sozusagen Eulen nach Athen, nach Spree-Athen; denn es handelt sich um Überlegungen, die sich – und zwar keineswegs zufällig – mit Gedanken berühren, welche – ungleich länger als ich – an Ihrem hiesigen Konkurrenzbetrieb Michael Landmann1 zu hegen pflegt und mehrfach publiziert hat: wie oft bei ihm am pointiertesten in Pluralität und Antinomie. Was ich – und ich gehe dabei nicht weiter als Landmann, sondern nur (vermutlich) zu weit – nun meinerseits hierzu einschlägig sagen möchte, sage ich in folgenden vier Abschnitten: 1. Zweifel am Striptease; 2. Monomythie und Polymythie; 3. Das Unbehagen am Monomythos; 4. Plädoyer für aufgeklärte Polymythie. Und ich beginne – ganz konventionell – mit Abschnitt
1. Zweifel am Striptease. Der Mythos ist gegenwärtig polymorph kontrovers. Aber man darf dabei ruhig simplifizieren; und sollte man es nicht dürfen: ich tue es trotzdem. Es gibt – meine ich – zunächst zwei Grundpositionen, zu denen alsbald eine dritte sich gesellt. Die beiden ersten haben eine gemeinsame Prämisse. Wilhelm Nestles Erfolgstitel Vom Mythos zum Logos2, der für Griechisches erfunden wurde, scheint über das von ihm Gemeinte hinaus den Gang der Weltgeschichte des Bewusstseins in ihrem späten Stadium insgesamt zu charakterisieren: als Aufklärung ist sie, scheint es – und es ist dabei egal, ob dies präzis dem Sinn der Bultmannschen Formel entspricht oder nicht – der große Prozess der Entmythologisierung. Mythos – was immer er sonst noch sein mag – ist dann jedenfalls dies: etwas, was wir im Begriff sind, hinter uns zu haben; und dass das so ist: das ist entweder – Position 1 – gut oder – Position 2 – schlimm. Diese beiden Positionen – das mehr oder weniger freudige Ja zum Untergang des Mythos: von Comte bis Horkheimer-Adorno und Topitsch; das mehr oder weniger energisch warnende Nein dazu: von Vico bis zur Heideggerschule – sind einigermaßen unvermeidlich im Spiel, wenn die Weltgeschichte des Bewusstseins zumindest in ihrem späten Stadium – als Aufklärung – dieses sein soll: der Prozess der Entmythologisierung. Aber ist sie das wirklich?
Diese Geschichte des Prozesses der Entmythologisierung ist – meine ich – selber ein Mythos; und dass so der Tod des Mythos selber zum Mythos wird, beweist ein wenig des Mythos relative Unsterblichkeit. Es ist zumindest ein Indiz dafür, dass wir ohne Mythen nicht auskommen. Auch diese Meinung – Position 3 – ist keineswegs neu: bei Lévi-Strauss ist sie impliziert und – wenn ich es richtig sehe – bei Hans Blumenberg auch; ausdrücklich vertreten wurde sie von Kolakowski.3 Ich mache mir hier – ohne in jedem Fall die angebotene Begründung zu übernehmen – diese dritte Meinung zu Eigen.
Die Menschen können ohne Mythen nicht leben; und das sollte nicht verwunderlich sein, denn was sind Mythen? Ein »mythophilos« – Aristoteles bezeichnet sich so – ist einer, der gern Geschichten hört: den täglichen Klatsch, Legenden, Fabeln, Sagen, Epen, Reiseerzählungen, Märchen, Kriminalromane, und was es an Geschichten sonst noch gibt. Mythen sind – ganz elementar – justament dieses: Geschichten. Man mag sagen: Ein Mythos ist fiktiver als eine »history« und realer als eine »story«; aber das ändert nichts am Grundbefund: Mythen sind Geschichten. Wer den Mythos verabschieden will, muss also die Geschichten verabschieden, und das geht nicht; denn: »Wir Menschen sind immer in Geschichten verstrickt«, meint Wilhelm Schapp; »die Geschichte steht für den Mann«,4 schreibt er und meint damit jeden Menschen und hat recht. Es ist diese unsere unvermeidliche Verstrickung in Geschichten, die uns zum Erzählen dieser und anderer Geschichten zwingt; das ist bei dem, was uns widerfährt, zuweilen die einzige Freiheit, die uns bleibt: das an den Geschichten, was wir nicht ändern können, wenigstens zu erzählen und umzuerzählen. Wir tun das auch dann, wenn dabei fast unkenntlich wird, dass es sich um eine Geschichte handelt; Prometheus: hier steht der Mann für die Geschichte, die für den Mann steht. Natürlich ist die Frage interessant, wann Mythen so ultrakurz sein dürfen und wann sie – wie Hans Blumenberg das nennt – »mythische Umständlichkeit«5 entwickeln müssen; aber so oder so: es handelt sich um Geschichten. Und wichtig ist sicher auch, ob Geschichten – wie Gehlen6 meint – dann zu Mythen werden, wenn sie gewissermaßen ›ungesättigt‹ bleiben dadurch, dass die empirische Identifizierbarkeit ihres Personals suspendiert ist: im Grunde agieren dann dort Platzhalter in einer »Erzählung an sich«, die erst bei der Rezeption konkret besetzt wird: so steht die Geschichte für jedermann; aber doch eben: eine Geschichte. Und selbst, wenn es scheint, dass der Kern dieser Geschichte ein »semiologisches System«7 ist und gleichsam maskierte Mathematik, handelt es sich dann um Mythen nicht deswegen, weil diese Geschichten Mathematik, sondern deswegen, weil diese Mathematik Geschichten sind. All das differenziert zwar, aber zugleich bestätigt es den Grundbefund: Mythen sind Geschichten.
Freilich: ist es nicht so, dass das Erzählen von Geschichten aufhört, sobald man wirklich weiß? Müssen nicht dort, wo die Wahrheit auftritt, die Mythen verschwinden? Doch gerade das ist – scheint mir – ganz und gar ein Irrtum. Ich bestreite nicht, dass Mythen in die noch leere Stelle der Wahrheit faktisch eingetreten sind, wo die Menschen noch nicht wussten; aber das ist eine Zweckentfremdung. Denn Mythen sind, wo sie nicht kontermythisch umfunktioniert werden, eben keine Vorstufen und Prothesen der Wahrheit, sondern die mythische Technik – das Erzählen von Geschichten – ist wesentlich etwas anderes, nämlich die Kunst, die (nicht etwa fehlende, sondern) vorhandene Wahrheit in die Reichweite unserer Lebensbegabung zu bringen. Da ist nämlich die Wahrheit in der Regel noch nicht, wenn sie entweder – wie etwa die Resultate exakter Wissenschaft z. B. als Formeln – noch unbeziehbar abstrakt oder – wie etwa die Wahrheit über das Leben: der Tod – unlebbar grausam ist: Da dürfen dann nicht nur, da müssen die Geschichten – die Mythen – herbei, um diese Wahrheiten in unsere Lebenswelt hereinzuerzählen oder um sie in unserer Lebenswelt in jener Distanz zu erzählen, in der wir es mit ihnen aushalten. Dafür haben wir nämlich – letzten Endes – nichts anderes als die Geschichten, insbesondere, wenn das gilt, was Schelling sagte: »Die Sprache selbst sei nur die verblichene Mythologie!«8 Eines ist die Wahrheit, ein anderes, wie sich mit der Wahrheit leben lässt: für jene ist – kognitiv – das Wissen, für dieses sind – vital – die Geschichten da. Denn das Wissen hat es mit Wahrheit und Irrtum zu tun, die Geschichten mit Glück und Unglück: ihr Pensum ist nicht die Wahrheit, sondern der modus vivendi mit der Wahrheit (darum – nota bene – ist es tröstlich, von den Dichtern zu wissen, dass sie wenigstens lügen können). So dürfen also dort, wo die Wahrheit auftritt, die Geschichten – die Mythen – nicht aufhören, denn gerade dort müssen sie ganz im Gegenteil allererst anfangen: das Wissen ist nicht das Grab, sondern das Startloch der Mythologie. Denn wir brauchen zwar die »besprochene«, aber wir leben in der »erzählten Welt«9. Drum eben gilt: Es geht nicht ohne Mythen: narrare necesse est.
Deshalb können wir die Mythen nicht einfach ablegen wie Kleider, obwohl ja auch das Ablegen von Kleidern zuweilen nicht ganz einfach ist. »Meine Identität ist mein Anzug«, sagte Gottfried Benn. Der eine der großen Zürcher Textilmetaphoriker, Gottfried Keller, schrieb: »Kleider machen Leute«; und wenn es doch – »die Geschichte steht für den Mann« – so ist, dass Geschichten Leute machen, haben offenbar Kleider, die Leute machen, etwas zu tun mit Geschichten, die Leute machen; drum auch schrieb der andere der großen Zürcher Textilmetaphoriker, Max Frisch, in seinem Gantenbein: »Ich probiere Geschichten an wie Kleider«.10 Aber aus Gantenbeins Qual der Wahl angesichts des Reichtums seiner Mythengarderobe ist eben nicht zu folgern, dass er er selbst ist erst dann, wenn er keine Geschichte mehr anhat; und so stimmt es auch nicht, dass die Weltgeschichte des Bewusstseins das ist, als was man sie – wie ich eingangs sagte – sehen will: ein ›Fortschritt‹ genannter Striptease, bei dem die Menschheit nach und nach – mehr oder weniger elegant – ihre Mythen ablegt und schließlich – sozusagen mit nichts als sich selber am Leibe – mythisch nackt dasteht: ganz nur noch bloße Menschheit. Dieses Bild ist nicht frivol, sondern hält sich streng im Rahmen der von Blumenberg untersuchten Metaphorik der »nackten Wahrheit«.11 Emil Lask sprach vom »logisch Nackten«; so darf man auch vom mythisch Nackten sprechen: das ist im menschlichen Fundamentalbereich jenes Nackte, das es nicht gibt. Der Mythonudismus erstrebt Unmögliches; denn – so scheint es mir – jede Entmythologisierung ist ein wohl kompensierter Vorgang: je mehr Mythen einer auszieht, desto mehr Mythen behält er an. Darum eben habe ich Zweifel am Striptease: Zweifel – genauer gesagt – an der Vorstellung der spätweltgeschichtlichen Aufklärung als Mythen-Striptease. Diese Vorstellung – sagte ich – ist selber ein Mythos; so ist es fällig, dazu einen Gegenmythos zu finden. Sie alle kennen Andersens sozialpsychologisches Märchen von »des Kaisers neuen Kleidern« und erinnern sich: Da hatten clevere Manager der Branche zur Produktion und zum Vertrieb jener Kleider, welche Leute machen, der herrschenden Klasse die Nullgarderobe aufgeschwatzt; die Sache funktionierte, bis ein zeitkritischer Dreikäsehoch ausrief: Die haben ja nichts an! (Das war zu jener Zeit, als das Kritisieren noch geholfen hat.) Beim jetzt, in unserer Zeit, gesuchten Gegenmythos – Überschrift etwa: »Der Striptease, der keiner war« – muss es umgekehrt sein: da ist die mythische Nullgarderobe gerade das ausdrücklich proklamierte Ziel, da strebt die wissenschaftliche und emanzipatorische Avantgarde nach mythischer Nudität und glaubt, sie zu haben; und hier – scheint mir – funktioniert die Sache vielleicht ebenfalls nur so lange, bis ein phänomenologisch-hermeneutischer Dreikäsehoch auftritt und per naivitatem institutam et per doctam ignorantiam etwa ausruft: Sie da, der Herr aus dem späten Wiener Kreis, Sie haben ja immer noch Mythen an! Was dem Betreffenden sicher gleichfalls sehr peinlich ist, selbst wenn er – denkt man z. B. an Ernst Topitsch – ein echtes Erzähltalent ist: welch pralle Mythen enthält doch sein »Naturgeschichte der Illusion« unterbetiteltes Buch;12 und auch das verbindet ihn mit den alten Mythologen, dass er immer wieder dasselbe erzählt. Ich räume ein: ein Philosoph, der jenen vermeintlichen Striptease als tatsächlichen Mummenschanz durchschaut, muss schon über sensible Methoden verfügen; so etwas Halbes wie etwa die Semi-Otik reicht da keineswegs aus, da muss schon jemand holotisch ein Hermeneutiker sein, um so zu intervenieren. Aber recht – scheint mir – hätte er ja wohl: Wir können die Geschichten – die Mythen – nicht loswerden; wer es trotzdem glaubt, betrügt sich selber. Menschen sind mythenpflichtig; ein mythisch nacktes Leben ohne Geschichten ist nicht möglich. Die Mythen abzuschaffen: das ist aussichtslos.
2. Monomythie und Polymythie. Durch diesen einleitenden Hinweis wollte ich – dem ersten Anschein entgegen – nicht dartun, dass die Aufklärung arbeitslos wird, dass das Pensum der Mythenkritik entfällt. Denn: wenn es aussichtslos ist, die Mythen abzuschaffen, so folgt daraus nicht, dass es am Mythos nichts mehr zu kritisieren gibt; ganz im Gegenteil: erst jetzt bekommt das Aufklärungspensum der Mythenkritik präzise Konturen. Nicht wahr: Wer angesichts von avancierten Knollenblätterpilzen die Forderung erhebt, man solle das Essen gänzlich bleibenlassen, der geht – scheint mir – einfach zu weit und wird nichts ausrichten; ein Ideologiekritiker könnte entlarvungsbeflissen schließen, so einer habe Interesse am Verhungern der anderen. Die vernünftige Maßnahme ist hierbei doch die, die längst erfolgreich ergriffen wurde: eine genaue Unterscheidung des Essbaren und Giftigen. Just so beim Mythos: Angesichts der Mythenpflichtigkeit der Menschen wird die Mythenkritik sinnvoll und vernünftig genau dann, wenn man die Mythen nicht mehr pauschal abwehrt, sondern wenn man bekömmliche und schädliche Mythensorten zu unterscheiden versucht und gegen die schädlichen antritt.
Es gibt giftige Mythen, und ich will hier zu sagen versuchen, welche das sind. Meine These – eine Arbeitshypothese – ist diese: Gefährlich ist immer und mindestens der Monomythos; ungefährlich hingegen sind die Polymythen. Man muss viele Mythen – viele Geschichten – haben dürfen, darauf kommt es an; wer – zusammen mit allen anderen Menschen – nur einen Mythos – nur eine einzige Geschichte – hat und haben darf, ist schlimm dran. Darum eben gilt: Bekömmlich ist Polymythie, schädlich ist Monomythie. Wer polymythisch – durch Leben und Erzählen – an vielen Geschichten teilnimmt, hat durch die jeweils eine Geschichte Freiheit von der jeweils anderen et vice versa und durch weitere Interferenzen vielfach über Kreuz; wer monomythisch – durch Leben und Erzählen – nur an einer einzigen Geschichte teilnehmen darf und muss, hat diese Freiheit nicht: er ist ganz und gar – sozusagen durch eine monomythische Verstricktseinsgleichschaltung – mit Haut und Haaren von ihr besessen. Wegen dieses Zwangs zur restlosen Identität mit dieser Alleingeschichte verfällt er narrativer Atrophie und gerät in das, was man nennen kann: die Unfreiheit der Identität aus Mangel an Nichtidentität. Den Freiheitsspielraum der Nichtidentitäten, der beim Monomythos fehlt, gewährt hingegen die polymythische Geschichtenvielfalt. Sie ist Gewaltenteilung:13 sie teilt die Gewalt der Geschichte in viele Geschichten; und just dadurch – divide et impera oder divide et fuge, jedenfalls: befreie dich, indem du teilst, d. h. dafür sorgst, dass die Gewalten, die die Geschichten sind, sich beim Zugriff auf dich wechselseitig in Schach halten und so diesen Zugriff limitieren – just dadurch erhält der Mensch die Freiheitschance, eine je eigene Vielfalt zu haben, d. h. ein Einzelner zu sein. Diese Chance hat er nicht, sobald die Gewalt einer einzigen Geschichte ihn ungeteilt beherrscht; dort – beim Monomythos – muss er die Nichtidentitätsverfassung seiner Geschichtenvielfalt vor dieser Monogeschichte auslöschen; er unterwirft sich dem absoluten Alleinmythos im Singular, der keine anderen Mythen neben sich duldet, weil er gebietet: Ich bin deine einzige Geschichte, du sollst keine anderen Geschichten haben neben mir.
Ich meine nun – denn als Opfer der Hochschuldidaktik weiß ich ja: um verständlich zu reden, soll man Beispiele bringen; aber ich bringe hier nicht nur ein Beispiel, sondern gleich das einschlägige Zentral-, Haupt- und Endspiel – ich meine also: Von dieser monomythischen Art ist der erfolgreichste Mythos der modernen Welt: der Mythos des unaufhaltsamen weltgeschichtlichen Fortschritts zur Freiheit in Gestalt der Geschichtsphilosophie der revolutionären Emanzipation. Das – Lévi-Strauss nennt ihn den »Mythos der Französischen Revolution«14 – ist ein Monomythos: er duldet – antihistoristisch – keine Geschichten neben dieser einen emanzipatorischen Weltgeschichte. Hier zeigt sich: Man kann zwar die Mythen – die Geschichten – nicht abschaffen, aber man kann sie durch Etablierung eines Monopolmythos zentralisieren und dadurch entpluralisieren. Das geschieht hier: In der Mitte des 18. Jahrhunderts – Reinhart Koselleck hat das durch seine begriffsgeschichtlichen Untersuchungen gezeigt15 – proklamiert die Geschichtsphilosophie, die dort entsteht und ihren Namen bekommt, gegen den bisherigen Plural der Geschichten »die« Geschichte. Seither – seit diesem »Zeitalter der Singularisierungen«16, in dem aus den Fortschritten »der« Fortschritt, aus den Freiheiten »die« Freiheit, aus den Revolutionen »die« Revolution und eben aus den Geschichten »die« Geschichte wird – darf die Menschheit sich nicht mehr in Sondergeschichten verzetteln, indem sie multiindividuell oder multikulturell je eigene Wege zur Humanität geht, sondern sie hat fortan zielstrebig diese eine einzige Fortschrittsgeschichte zu durcheilen als einzig möglichen Weg zum Ziel der Menschheit: Durch diese hohle Gasse muss sie kommen: es führt kein andrer Weg zur Freiheit, hier vollend’t sie’s, die Notwendigkeit ist mit ihr: wenigstens scheint das so. Wer sich dieser einen Emanzipationsgeschichte in Eigengeschichten entzieht, wird fortan zum Häretiker, zum Geschichtsverräter, zum Menschheitsfeind: bestenfalls ist er ein Reaktionär. So führt dieser Monomythos jener Geschichte, die nicht mehr »eine«, sondern »die« Geschichte zu sein beansprucht, zum Ende der Polymythie; ich möchte es nennen: das zweite Ende der Polymythie.
Denn dieses zweite Ende der Polymythie ist ein später Effekt und von langher vorbereitet durch das, was man – entsprechend – nennen kann: das erste Ende der Polymythie. Das war das Ende des Polytheismus. Der Polytheismus nämlich war sozusagen die Klassik der Polymythie. Die Geschichte steht nicht nur für den Menschen, sie steht auch für den Gott: So gab es im Polytheismus deswegen viele Mythen, weil es dort viele Götter gab, die in vielen Geschichten vorkommen und von denen viele Geschichten erzählt werden konnten und mussten. Jene Gewaltenteilung im Absoluten, die der Polytheismus war – eine Gewaltenteilung durch Kampf und noch nicht durch Rechtsregeln – brauchte und brachte die Gewaltenteilung der Geschichten durch Polymythie. Das Ende des Polytheismus ist der Monotheismus; er ist das erste Ende der Polymythie: er ist eine ganz besonders transzendentale – nämlich historische – Bedingung der Möglichkeit der Monomythie. Im Monotheismus negiert der eine Gott – eben durch seine Einzigkeit – die vielen Götter. Damit liquidiert er zugleich die vielen Geschichten dieser vielen Götter zugunsten der einzigen Geschichte, die nottut: der Heilsgeschichte; er entmythologisiert die Welt. Das geschieht epochal im Monotheismus der Bibel und des Christentums. Zwar pflegen hier die zuständigen Theologen – unter Hinweis etwa auf die Trinitätslehre – zu protestieren: das Christentum sei – anders als z. B. der Islam – gar kein »richtiger« Monotheismus. Aber es genügt für den Zusammenhang, der hier beschäftigt, dass das Christentum jedenfalls »als« Monotheismus »wirkte«. Der christliche Alleingott bringt das Heil, indem er die Geschichte exklusiv an sich reißt. Er verlangt das sacrificium mythorum17 schon bevor Gott innerhalb der Philosophiegeschichte des Christentums schließlich – zum Ausgang des Mittelalters – seiner heilsgeschichtlichen Macht das Image einer gegenweltlichen Willkürherrschaft gab. Wo dann diese – nominalistisch – von der Welt auch noch das sacrificium essentiae und vom Menschen auch noch das sacrificium intellectus verlangte, trieb dies Mensch und Welt in die Emanzipation: Der Kopf optiert fürs Profane, wenn dem Menschen theologisch zugemutet wird, vor Gott auch den Kopf abzunehmen; und wo die Heilsgeschichte gegenweltlich wird, muss sich – schon aus Notwehr – die Welt gegengeschichtlich formieren: die Welt wird so – indirekt durch den Monotheismus selber – zur Geschichtslosigkeit18 gezwungen. Sie formiert sich neuzeitlich durch Absage auch noch an die letzte, die Heilsgeschichte, und also antigeschichtlich: als exakte Wissenschaftswelt und als System der Bedürfnisse; sie versachlicht sich zur Welt der bloßen Sachen. Die Geschichten werden generell verdächtigt: die Mythen als Aberglaube, die Traditionen als Vorurteile, die Historien als Vehikel des Ablenkungsgeistes der bloßen Bildung. Das Ende des Polytheismus, der Monotheismus, entmythologisiert – im Effekt – die Welt zur Geschichtslosigkeit.
3. Das Unbehagen am Monomythos. Aber die Menschen sind mythenpflichtig: Wenn das – wie ich eingangs sagte – gilt, ist diese Geschichtslosigkeit der modernen Sachlichkeitswelt kein Gewinn, sondern ein Verlust, und zwar einer, der nicht ausgehalten und nicht durchgehalten werden kann. Darum hat die moderne Welt die Mythen und Geschichten nicht überwunden, sondern sie hat faktisch nur ein Geschichtsdefizit erzeugt: eine Leerstelle, eine Vakanz.
In diese vakante Stelle tritt jetzt – scheinbar unwiderstehlich – der nachmonotheistische Monomythos ein: die durch die Geschichtsphilosophie zu »der« Geschichte im Singular ausgerufene revolutionäre Emanzipationsgeschichte der Menschheit (sie mag nun per Utopie als Kurzgeschichte traktiert werden oder per Dialektik mythische Umständlichkeit gewinnen). Das ist – nachdem Gott sich auf dem Weg über seine Einzigkeit aus der Welt schließlich in sein Ende zurückzog – die Fortsetzung der Heilsgeschichte unter Verwendung halb anderer Mittel: Dieser Mythenbeendigungsmythos bleibt – wie die Heilsgeschichte: nicht als deren Säkularisation, sondern als das Misslingen ihrer Säkularisation – die Alleingeschichte der Ermächtigung einer Alleinmacht zur Erlösung der Menschheit. Zugleich aber ist dieser Monomythos ›Emanzipationsgeschichte‹ von der christlichen Heilsgeschichte durch das Ende des Monotheismus getrennt als ihre profane Kopie: er ist also historisch ganz spät und ein moderner Tatbestand; er gehört nicht zur alten, sondern zur ganz neuen Mythologie.
Der Ausdruck »neue Mythologie« entstand kurz vor 1800. »Wir müssen eine neue Mythologie haben«, »eine Mythologie der Vernunft«: dies meinte 1796 der Urheber des so genannten »Ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus«;19 ich gehöre zu denen, die der zuerst von Rosenzweig und zuletzt von Tilliette vertretenen Meinung anhängen, dass das Schelling gewesen sei.20 Aber Schelling, der so die »neue Mythologie« proklamierte, wurde – und das scheint mir bemerkenswert – nicht der Philosoph der neuen, sondern der Philosoph der ganz alten Mythologie. Zwar gilt das noch nicht vom Identitätssystem; dort – in der Kunstphilosophie: darauf hat besonders energisch Peter Szondi21 hingewiesen – gelten vorübergehend noch »berufene Dichter« und »jedes wahrhaft schöpferische Individuum« als interimistische Agenten der neuen Mythologie: jeder soll »von dieser noch im Werden begriffenen [mythologischen] Welt […] sich seine Mythologie schaffen«22. Aber dann – nach dem Ende des Identitätssystems – wird diese Forderung der neuen Mythologie für Schelling offenbar problematisch und schließlich suspekt: Mit ihr verbindet sich nun bei Schelling – scheint es – die Erfahrung, dass wir die neue Mythologie nicht erst haben müssen, weil wir sie längst schon in ungutem Übermaß haben. Denn – das zeigt sich jetzt und bis in unsere Zeit – die neue Mythologie wurde erfolgreich als Mythologie des Neuen: im Mythos des Fortschritts, der Revolution, der Weltveränderung, des kommenden Reichs, des Generalstreiks,23 des letzten Gefechts und der letzten Klasse, etc. Allemal handelt es sich dabei um Totalorientierung durch die Alleingeschichte der Ermächtigung einer Alleinmacht; das ist eben diejenige Gestalt des Monomythos, die nach dem Christentum möglich und gefährlich wird: der absolute Alleinmythos im Singular, der – als das zweite Ende der Polymythie – die Pluralität der Geschichten verbietet, weil er nur noch eine einzige Geschichte erlaubt: den Monomythos der allein seligmachenden Revolutionsgeschichte. Wo diese neue Mythologie die gegenwärtige Welt ergreift, wird gerade das liquidiert, was an der Mythologie doch Freiheit war: die Pluralität der Geschichten, die Gewaltenteilung im Absoluten, das große humane Prinzip des Polytheismus. Das Christentum verdrängte ihn aus dem Sonntag der modernen Welt, die neue Mythologie will ihn auch aus ihrem Alltag verdrängen. Darum gehört – wo sie aus Forderung Wirklichkeit wird und wo dies, wie beim späten Schelling, Erfahrung zu werden beginnt – zur neuen Mythologie das Unbehagen an der neuen Mythologie. Die Spätwerke Schellings sind – scheint mir – bereits Reaktion auf dieses Unbehagen: sie nehmen – wörtlich gemeint – Abstand von der neuen Mythologie. Darum kümmert sich Schellings »Philosophie der Mythologie« gerade nicht um die neue, sondern um die ganz alte Mythologie; und darum macht Schellings »Philosophie der Offenbarung« den Versuch, die neue Mythologie in ihrem ältesten Zustand anzuhalten und so als Position zu haben;24 denn die christliche Offenbarung: das ist die älteste neue Mythologie.
Schellings Abkehr von der neuen Mythologie durch Zuwendung zur ganz alten ist repräsentativ für das Schicksal des Mytheninteresses der modernen Welt insgesamt. Es ist geprägt durch das Unbehagen am Monomythos. Schon gleich, als dieser moderne Monomythos durch die Kreation des Singularbegriffs »die« Geschichte entstand, schon in der von Koselleck so getauften »Sattelzeit« kurz nach 1750 formiert sich – repräsentativ bei Christian Gottlob Heyne – im Gegenzug das affirmative Interesse an der Polymythie der alten und immer älteren Mythologie.25 Wo – vorbereitet durch den Monotheismus und vollstreckt durch den Monomythos der Fortschrittsgeschichte – nach dem Polytheismus auch die Polymythie aus unserer Welt zu verschwinden droht, sucht man sie – durch eine mythologische Wende zum Exotischen – außerhalb ihrer: diachronisch in der Vorzeit oder synchronisch in der Fremde, am besten in der fremden Vorzeit. Solch nostalgische Wende zur exotischen Polymythie vollzieht die von Carl Otlieb Müller sogenannte »Morgenländerei« der Altertumskunde: die Mythenforschung geht zurück vor die griechische Klassik auf deren orientalische Prämissen; das ist sozusagen der frühe und verdeckte Versuch einer Mythologie der dritten Welt. Sie hat – meine ich – mindestens drei Stadien: zunächst die mythologische Nachtseitenforschung der klassischen Philologie von Heyne und Zoëga über Görres und Creuzer bis Bachofen; dann das – immanent exotische – Morgenländereisurrogat einer Zuwendung zur germanischen Mythologie etwa bei Wagner; schließlich – nach der Konversion sozusagen von Odin zu Mao – die sinologische Linksmorgenländerei unseres Jahrhunderts, die immer noch – trotz des Schritts von Hafis zu Ho – der Devise des Westöstlichen Divan folgt: »Flüchte du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten«;26 diese mythologische Morgenländerei zerfällt heute in Maoismus und Tourismus. Ihre seriöse Überbietungsgestalt ist die strukturale Ethnologie: der Versuch insbesondere von Lévi-Strauss, vom neuen Monomythos des Neuen dadurch Distanz zu gewinnen, dass man ihn der Konkurrenz fremder – polymythischer – Mythologien aussetzt und dadurch relativiert.27 Hier rumort – Henning Ritter hat das für Lévi-Strauss gezeigt28 – allüberall das Rousseau-Interesse am guten Wilden. Und es genügt dann nicht, dass er in der Vorzeit oder den traurigen Tropen lebt: Die Nostalgie transportiert ihn – per Zitat: denn die Menschen sind zitierende Lebewesen – in die gegenwärtigste Gegenwart. Als der Bruch mit dem Etablierten durch Kleidungssitten demonstriert werden sollte, verfiel man nicht zufällig auf den Savage-look: Was da – zottig und bärtig – unter uns weilte und weilt, repräsentiert (auf der Spitze der Modernität) den bon sauvage; es ist nicht so, wie der Irrtum der Älteren es suggerieren wollte: da trotten nicht ungepflegte Menschen, sondern gepflegte Zitate: Rousseau-Zitate. Was hier vor sich geht – die Verwandlung des Ältesten ins Modernste, die Promotion des Archaischen zum Avantgardistischen – kann man auch an anderen einschlägigen Vorgängen beobachten, etwa: Was – durchaus im Kontext der mythologischen Morgenländerei – Hegels Ästhetik als die Kunst vor den Verehrungs-, den Reverenzobjekten beim Streit zwischen »Alten« und »Modernen« – vor der »klassischen« und der »romantischen Kunstform« also – identifizierte, die im Anschluss an Creuzers Terminologie so genannte »symbolische Kunstform« der – wie Hegel sagte – »abstrakten« Kunst,29 wird spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts zur Losung der Avantgarde. Innerhalb der Ästhetik der »Kunstformen« wird sie sozusagen aus dem ersten Abschnitt zum letzten: aus der frühesten zur fortgeschrittensten Kunst. Auch sie bekommt diesen Avantgarde-Appeal freilich nur, indem sie mit dem Monomythos des Fortschritts paktiert und – als ancilla progressus – in seine Dienste tritt: er beherrscht das Feld der Gegenwart – scheint es – so sehr, dass auf diesem Felde nur noch leben darf, was sich ihm anpasst und unterwirft.
Das Gesamtschicksal dieser mytheninteressierten Gegenbewegung gegen den neuen Monomythos ist also offenbar nicht glücklich: Weil der Monomythos der Fortschritts-Alleingeschichte die moderne Welt unbehaglich beherrscht, suchen ihre Zeitgenossen die verlorene Polymythie in der exotischen Mythologie der Vorzeit und Fremde. Weil das – offenbar – nicht genügt, kommt es zum Versuch ihrer Verwandlung in Gegenwart; dabei jedoch hört diese alte Mythologie auf, das zu sein, um dessentwillen man sie suchte: sie verliert ihren polymythischen Charakter durch Unterwerfung unter den Monomythos des Neuen; so bestätigt sie schließlich nur dessen Macht. Es wird also hier die Gegenmaßnahme überdauert durch das, was sie auslöste: durch das Unbehagen am Monomythos. Daraus – scheint mir – folgt: Das Interesse an der exotischen – der alten und der fremden – Mythologie ist ein Symptom, aber keine Lösung.
4. Plädoyer für aufgeklärte Polymythie. Es müssen daher – um zu einer Lösung zu kommen – alternative Gegenmaßnahmen erwogen werden. Ich will auch das hier nur in der Form einer kurzen Skizze tun. Dabei verlasse ich das Themenfeld Mythos nicht, ich vergrößere nur den Aktionsradius der mythenbetreffenden Aufmerksamkeit; denn die Aufmerksamkeit nur auf die exotische – die alte und die fremde – Mythologie birgt die Gefahr, die Aufmerksamkeit auf einschlägig moderne Phänomene zu blockieren. Das führt dann zu einer künstlich halbierten Charakteristik der Gegenwart, bei der nur das gesehen wird, was ich bisher angesprochen hatte: die moderne Versachlichung, die Geschichtslosigkeit ist, und deren – dann unwiderstehlich scheinende – Kompensation durch den neuen Monomythos. Aber zur Gegenwart gehört mehr und mythologisch jedenfalls nicht nur die Monomythie; denn – das ist hier meine mythenbetreffende Abschlussthese – es gibt auch eine Polymythie, die spezifisch der modernen Welt zugehört: auf sie muss man setzen, um das Unbehagen am Monomythos ins Produktive zu wenden. Denn es gilt nicht nur dies: die monotheistische Entmythologisierung ist die indirekte Ermächtigung des neuen Monomythos; es gilt nämlich ebenso dies: die monotheistische Entmythologisierung lanciert gerade modern das, was sie liquidieren wollte: die Polymythie. Wie geht das zu? Vielleicht so: Der Monotheismus hat den Polytheismus und mit ihm die Polymythie entzaubert und negiert. Die moderne Welt aber beginnt – im früher angedeuteten Sinn – damit, dass sich Gott aus der Welt in sein Ende zurückzieht: also mit dem Ende des Monotheismus. Dieses Ende des Monotheismus verschafft – wie auch anderen Phänomenen, die der Monotheismus scheinbar bezwang: etwa dem Fatum – dem Polytheismus und der Polymythie eine neue Chance: es lässt – sozusagen – ihre Entzauberung bestehen, aber es negiert ihre Negation. Mit anderen Worten: gerade in der modernen Welt können Polytheismus und Polymythie – entzaubert – wiederkehren: als aufgeklärter Polytheismus und als aufgeklärte Polymythie. Ich möchte auf drei Tatbestände hinweisen, die in diesen Kontext gehören. Da ist
erstens die entzauberte Wiederkehr des Polytheismus. Der moderne – profane, innerweltliche – Aggregatzustand des Polytheismus ist die politische Gewaltenteilung: sie ist aufgeklärter – säkularisierter – Polytheismus. Sie beginnt nicht erst bei Montesquieu, bei Locke oder bei Aristoteles, sie beginnt schon im Polytheismus: als Gewaltenteilung im Absoluten durch Pluralismus der Götter. Es war der Monotheismus, der ihnen den Himmel verbot und damit auch die Erde streitig machte. Weil sich aber der christlich eine Gott, der die vielen Götter negierte, zu Beginn der Neuzeit aus der Welt in sein Ende zurückzog, liquidierte er nicht nur den Himmel; denn er machte dadurch zugleich die Erde – die Diesseitswelt – frei für eine – nun freilich entzauberte, entgöttlichte – Wiederkehr der vielen Götter. Indem der biblische Monotheismus sie aus dem Himmel vertrieb, wies er sie im Effekt nur aus auf die Erde: dort richten sie sich ein als die zu Institutionen entgöttlichten Götter Legislative, Exekutive, Jurisdiktion; als institutionalisierter Streit der Organisationen zur politischen Willensbildung; als Föderalismus; als Konkurrenz der wirtschaftlichen Mächte am Markt; als unendlicher Dissens der Theorien, der Weltsichten und maßgebenden Werte: »Die alten vielen Götter« – schreibt Max Weber – »entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf.«30 Da ist
zweitens die Genesis des Individuums: es lebt von dieser Gewaltenteilung.31 Das Individuum entsteht gegen den Monotheismus. Solange – im Polytheismus – viele Götter mächtig waren, hatte der Einzelne – wo er nicht durch politische Monopolgewalt bedroht war – ohne viel Aufhebens seinen Spielraum dadurch, dass er jedem Gott gegenüber immer gerade durch den Dienst für einen anderen entschuldigt und somit temperiert unerreichbar sein konnte: Es braucht ein gewisses Maß an Schlamperei, die durch die Kollision der regierenden Gewalten entsteht, um diesen Freiraum zu haben; ein Minimum an Chaos ist die Bedingung der Möglichkeit der Individualität. Sobald aber – im Monotheismus – nur mehr ein einziger Gott regiert mit einem einzigen Heilsplan, muss der Mensch in dessen totalen Dienst treten und total parieren; da muss er sich ausdrücklich als Einzelner konstituieren und sich die Innerlichkeit erschaffen, um hier standzuhalten; die Allmacht konterkariert er durch Ineffabilität. Darum hat nicht der Polytheismus den Einzelnen erfunden: er brauchte es nicht, weil noch kein Monotheismus da war, der den Einzelnen extrem bedrohte. Der Monotheismus seinerseits aber hat nicht selber den Einzelnen entdeckt, sondern er – freilich gerade er – hat die Entdeckung des Einzelnen nur provoziert, weil zuerst er – der Monotheismus – dem Einzelnen wirklich gefährlich wurde. Darum konnte erst nachmonotheistisch der Einzelne offen hervortreten und – unter der Bedingung des säkularisierten Polytheismus der Gewaltenteilung – erst modern die wirkliche Freiheit haben, ein Individuum zu sein. Diese Freiheit riskiert er, wo er sich – monomythisch – einer neuen Monopolgewalt unterwirft. Fasziniert durch den neuen Mythos der Alleingeschichte bleibt er dann auf jener Strecke, die nur vermeintlich die Strecke zum Himmel auf Erden ist, in Wirklichkeit aber die zur irdischen Identität von Himmel und Hölle: zur integrierten Gesamtewigkeit. Darum braucht der Einzelne
drittens die entzauberte Wiederkehr der Polymythie, um hier erneut standzuhalten: um seine unausweichliche Mythenpflichtigkeit nicht – monomorph progressiv – durch eine absolute Alleingeschichte, sondern – polymorph transgressiv – durch viele relative Geschichten zu absolvieren. Es gibt – sagte ich – eine Polymythie, die spezifisch der modernen Welt zugehört. Man muss das eigens betonen: Die übliche Abwehr einer Definition der Mythen als Geschichten – die man gleichermaßen findet bei Roland Barthes und Alfred Baeumler32 – ist nur der Kunstgriff, mit dem man die Mythen aufs Exotische beschränkt und ausschließt, dass auch die Gegenwart ihre Mythen produziert. Je mehr hingegen die Mythen als Geschichten begriffen werden, um so mehr kann man sehen: es gibt eine spezifisch moderne Polymythie. Von ihren Gestalten nenne ich hier zwei: die Geschichtswissenschaft und das ästhetische Genus Roman. Sie sind spezifisch moderne Phänomene,33 und sie erforschen oder erfinden, und jedenfalls erzählen sie viele Geschichten. Durch den Monotheismus werden aus den Geschichten die vielen Götter, durch sein Ende wird auch noch der eine Gott aus ihnen als handelnde Zentralfigur getilgt: So – entzaubert – tun die Mythen modern in jeglicher Beziehung den Schritt in die Prosa: aus dem Kult in die Bibliothek. Dort sind die Geschichtswerke und die Romane präsent als die Polymythen der modernen Welt: auch das ist aufgeklärter Polytheismus. Das Aufgeklärte an ihnen ist unter anderem, dass sich Fiktion und Realität verschiedener Genera suchen, wenn es auch in den Realgeschichten der Historiker – wo sie Historiker bleiben, d. h. Geschichte erzählend schreiben – unvermeidliche Fiktionsreste gibt und in den Fiktionen der Romanciers – auch und gerade nach der modernen Entzauberung des Epos zur »Epopöe der gottverlassenen Welt«34 – die fundamenta in re. Historien und Romane sind die – aufgeklärten – Polymythen der modernen Welt.35 Den Umgang mit ihnen muss man suchen, um aus jener »nützlichen Idiotie«, zu der das ignorierensleitende Ignoranzinteresse der monomythisch inspirierten direkten utopischen Aktion verführt, in die besonnene Vorsicht der Bildung zurückzufinden: jener Bildung, die Chancengleichheit für die Geschichten – die Polymythen – gewährt: für die Historie, die nichtengagierte, und für die Literatur, die nichtengagierte, deren Liquidierung jenes Vakuum erzeugt, in das der Monomythos eindringt. Es ist fällig, gegenüber der schlechten Fortsetzung des Monotheismus durch Monomythie einzutreten für die modernen Geschichten im Plural – die historischen und die ästhetischen – und in diesem Sinn für einen aufgeklärten Polytheismus, der die individuellen Freiheiten schützt durch die Teilung auch noch jener Gewalten, die die Geschichten sind.
Es könnte – erlauben Sie mir diese Schlussbemerkung – sein, dass all das nicht ohne Konsequenzen bleibt auch für die Philosophie. Es scheint mir ebenfalls fällig, dass sie ihre Kollaboration mit dem Monomythos beendet und Distanz gewinnt auch zu all dem, was in ihr selber zu dieser Kollaboration disponiert. Das ist insbesondere das Konzept der Philosophie als orthologischer Mono-Logos: als das Singularisierungsunternehmen der Ermächtigung einer Alleinvernunft durch Dissensverbote, bei dem – als unverbesserliche Störenfriede – die Geschichten a priori nicht zugelassen sind: weil man da erzählt, statt sich zu einigen. Mir scheint, es wäre gut, zu solcher Orthologie jenes lockere Verhältnis wiederzugewinnen, das in Bezug auf die Orthographie Mark Twain empfahl, als er sagte: Ich bedauere jeden, der nicht die Phantasie hat, ein Wort mal so, mal so zu schreiben. Jede Philosophie ist eine traurige Wissenschaft, die es nicht vermag, über dieselbe Sache mal dies, mal das zu denken und jenen dieses und diesen jenes denken und weiterdenken zu lassen. In diesem Sinne ist selbst der Einfall suspekt: es lebe der Vielfall. Die Geschichten müssen wieder zugelassen werden: gut gedacht ist halb erzählt; wer noch besser denken will, sollte vielleicht ganz erzählen: die Philosophie muss wieder erzählen dürfen und dafür – natürlich – den Preis zahlen: das Anerkennen und Ertragen der eigenen Kontingenz. Aber da ahnt man schon die Entsetzensschreie der Innung und ihre empörten Warnungen: dass das Relativismus bedeute – mit den bekannten Widersinnskonsequenzen und fallacies – und bös’ enden müsse oder gar im Skeptizismus. Es war einmal ein Skeptiker, der hörte dies und empfand es nicht als Einwand: Was meinen die wohl – murmelte er, als er merkte, dass diese Warnung an ihn selber adressiert war: aber vorsichtshalber murmelte er nur – was meinen die wohl, warum ich ein Skeptiker bin? I like fallacy. Hier stehe ich und kann auch immer noch anders: Ich erzähle – als eine Art Scheherazade, die freilich anerzählen muss jetzt gegen die eigene Tödlichkeit – ich erzähle, also bin ich noch; und so – just so – erzähle ich denn: Geschichten und spekulative Kurzgeschichten und andere Philosophiegeschichten und Philosophie als Geschichten und weitere Geschichten und wo es den Mythos betrifft – Geschichten über Geschichten; und wenn ich nicht gestorben bin, dann lebe ich noch heute.