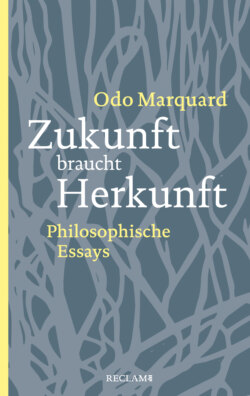Читать книгу Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays - Odo Marquard - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abschied vom Prinzipiellen
ОглавлениеAuch eine autobiographische Einleitung
Die Philosophie – schreibt Aristoteles – ist die »theoretische Wissenschaft von den ersten Gründen und Ursachen«1: sie fragt nach den Prinzipien und – bei gesteigerter Prinzipialität – nach dem prinzipiellsten Prinzip.
Abschied vom Prinzipiellen: bedeutet das also Abschied von der Philosophie? Diese Frage ist hier identisch mit der Frage, ob die Skeptiker wirklich zu den Philosophen gehören oder nicht; denn die Titelformulierung dieses Bändchens und seiner Einleitung avisiert nicht den Kritischen Rationalismus – an dem mich der Dogmatismus seines Antidogmatismus stört –, sondern sie bekräftigt die Wende zur Skepsis. Diese Wende zur Skepsis ist in der Philosophie bisher mein Weg und meine Arbeit gewesen: darüber – mit gebremstem Erzählgestus: seminarrativ – zu berichten scheint ein sinnvolles Pensum für die Einleitung zu einem Buche zu sein, das einige jüngere Dokumente dieses Weges zusammenstellt. Dieser Bericht gliedert sich in drei Abschnitte: 1. Skeptische Generation; 2. Nachträglicher Ungehorsam; 3. Skepsis und Endlichkeit.
1. Skeptische Generation. Die Skepsis ist eine alte Sache, und natürlich gehört sie in die Geschichte der Philosophie: als pyrrhonische und akademische Skepsis der hellenistischen Zeit; als moralistische Skepsis von Montaigne und Charron; als aufklärerische Skepsis von Bayle und Hume; als anthropologische Skepsis von Schulze-Aenesidem und Plessner; als historistische Skepsis von Burckhardt und als antihistoristische Skepsis von Löwith. Das ist also eine wohlidentifizierbare Tradition der Philosophie, eine alte: Wie kommt – und dies zunächst, ohne von diesem Traditionszusammenhang zu wissen – gerade ein Mensch meiner Generation in diese Tradition hinein?
Helmut Schelsky hat in seinem zuerst 1957 erschienenen Buch Die skeptische Generation2 darauf eine Antwort versucht: Die Wende zur Skepsis war – für jene Generation, zu der ich, 1928 geboren, gehöre: als einer, der mindestens im Anfangsteil der Zeit zwischen 1945 und 1955 (vgl. S. 5) nicht mehr Kind und noch nicht erwachsen war (vgl. S. 16–18) – in der Bundesrepublik gerade nicht das Außergewöhnliche, sondern das Normale. Schelsky unterscheidet als »zeitgeschichtliche Phasen« und »Generationsgestalten des Jugendverhaltens« seit der Jahrhundertwende: »1. die Generation der Jugendbewegung; 2. die Generation der politischen Jugend und 3. die deutsche Jugend im Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkriege, für die wir vorläufig die Bezeichnung ›die skeptische Generation‹ gewählt haben« (S. 57). Da war also zunächst die frühgrüne Generation der Meißner-Formel, des Wanderns, der Klampfe und Blockflöte; dann kam – zwischen den Weltkriegen – die Generation des radikalen politisch-ideologischen Weltverbesserungsengagements; schließlich formierte sich – nach dem Zweiten Weltkrieg – die skeptische Generation: Ihre Skepsis war – auch und gerade nach Schelskys Deutung – die Antwort auf die »Generation der politischen Jugend« und jene Zusammenbrüche, in die sie verwickelt wurde und die sie nach sich zog, die Antwort auf ihre Selbstkompromittierung; in der Erfahrung der Älteren (umstritten, umstreitbar): dass die Linke versagte3; und in der Erfahrung auch der Jüngeren (mit grauenhafter Evidenz, unbestreitbar): dass die Rechte die Katastrophe herbeiführte. Es kam zum Enttäuschungsschock; die Folge waren »Prozesse der Entpolitisierung und Entideologisierung des jugendlichen Bewusstseins« (S. 84): darum wurde »diese Generation […] in ihrem sozialen Bewusstsein kritischer, skeptischer, misstrauischer, glaubens- oder wenigstens illusionsloser als alle Jugendgenerationen vorher« (S. 488). »Diese geistige Ernüchterung macht frei zu einer für die Jugend ungewöhnlichen Lebenstüchtigkeit. Die Generation ist im privaten und sozialen Verhalten angepasster, wirklichkeitsnäher, zugriffsbereiter und erfolgssicherer als je eine Jugend vorher« (ebd.). Mit ihrem »geschärften Wirklichkeitssinn« für »das Praktische, Handfeste« (S. 88), ihrem »Konkretismus« (S. 89, 307 f.), ihrer »Pseudo-Erwachsenheit« (S. 93) war sie »die deutsche Ausgabe der Generation, die überall die industrielle Gesellschaft konsolidiert« (S. 493). Soweit diese Generation wirklich skeptisch war, habe ich an ihrem Schicksal teilgenommen: durch Wende zur Skepsis.
Denn – ich wiederhole es – die Wende zur Skepsis war – für jene Generation, zu der ich gehöre – nicht das Außergewöhnliche, sondern das Normale; außergewöhnlich war nur, dass ich mit dieser Wende zur Skepsis unter die Philosophen geriet und dann auch noch bei ihnen blieb. Denn Philosophie als Studium: das bedeutet – damals wie heute – in aller Regel nicht den Beginn einer erfolgreichen Karriere, sondern den Beginn einer persönlichen Tragödie, jedenfalls keinen »Konkretismus«; ich befand mich also – als Philosophiestudent, der außerdem Germanistik und daneben zunächst Kunstgeschichte, dann Geschichte, schließlich evangelische Systematische Theologie und ein wenig katholische Fundamentaltheologie studierte – gewisslich nicht auf dem Weg der »vorsichtigen, aber erfolgreichen jungen Männer« (S. 488) mit »geschärftem Wirklichkeitssinn« für »das Praktische, Handfeste« (S. 88): das – beim Zeus! – nun gerade mit Sicherheit nicht. Mitgrund für diese Blockade des »Konkretismus« bei mir mag gewesen sein: 1940–1945 – bis unmittelbar nach meinem 17. Geburtstag – war ich auf einer politischen Internatsschule4, einer späten und extremen Sozialisationsagentur der »Generation der politischen Jugend«: Ich kam – solide ausgebildet einzig in Weltfremdheit – (nach Kriegsende und kurzer Kriegsgefangenschaft) retardiert in die geschichtliche Wirklichkeit der skeptischen Generation hinein und schaffte – zusätzlich gebremst durch die akademische Entlastung von den Lebensfristungsnotwendigkeiten des Tages – zunächst nur die eine Hälfte ihres Generationspensums: also nicht den realitätstüchtigen »Konkretismus«, sondern nur die Skepsis. Just das freilich brachte mich zur Philosophie, und zwar auf dem Weg über die Ersatzbegeisterung an der Kunst – dem Versuch, durch Töne, Bilder, Worte die Wirklichkeit aussehender zu machen als Verlockung zum Lebenbleiben – und ihrer Verführung, sich gerade nicht zu verwirklichen, sondern zu vermöglichen: also über das Ästhetische.
Darum war es – nach dem temperierten Zufall, dass ich in der damaligen Numerus-clausus-Zeit 1947 nicht in Marburg und nicht in Kiel, sondern in Münster zum Studium zugelassen wurde – kaum ein Zufall, dass ich dort alsbald an jenen Philosophen geriet, der mein Lehrer wurde: Joachim Ritter; denn er begann damals seine Philosophische Ästhetik zu lesen, die – als Kompensationstheorie des Ästhetischen5 – die »Position der Möglichkeit« beschrieb und kritisierte und mich dadurch unmittelbar ansprach. Es war übrigens diese Vorlesung, durch die – noch vor seinen späteren Vorlesungen zur Praktischen Philosophie, in denen er seinen Ansatz positiv formulierte – Ritter die Älteren jener bunten und standpunktkontroversen Gruppe als Schüler gewann, die in der späteren Institutionengeschichte der bundesrepublikanischen Philosophie als derjenige Flügel des hermeneutischen Denkens wirksam geworden ist, der die Praktische Philosophie rehabilitierte: eben als Ritter-Schule, deren Lebendigkeit auch aus der »heterogenen Zusammensetzung des ›Collegium Philosophicum‹ Ritters« resultierte, »das Thomisten, evangelische Theologen, Positivisten, Logiker, Marxisten und Skeptiker vereint«6. Denn Ritter verpflichtete seine Schüler nicht auf seine eigenen Thesen7. Diesseits seiner Thesen habe ich von ihm gelernt: dass Merken wichtiger ist als Ableiten; dass niemand von vorn anfangen kann, dass jeder anknüpfen muss: also den Sinn fürs Geschichtliche; dass Widersprüche notfalls ausgehalten werden müssen gegen den Schein ihrer Auflösung; dass solche Widersprüche eindrucksvoller präsent sind durch Personen als durch Lektüren und dass dies verlangt: mit fremden Einstellungen leben und von ihnen lernen können; dass also die buntere Philosophenkonstellation die bessere ist; im Übrigen den Sinn fürs Institutionelle und seine Pflichten; und schließlich: dass Erfahrung – Lebenserfahrung – unersetzlich ist für die Philosophie. Erfahrung ohne Philosophie ist blind; Philosophie ohne Erfahrung ist leer: man kann keine Philosophie wirklich haben, ohne die Erfahrung zu haben, auf die sie die Antwort ist. Erfahrung aber braucht Zeit. Darum konvergierten die Ritter-Schüler in ihren inhaltlichen Thesen nicht im Studium und in den Lehrjahren, sondern erst Jahrzehnte später: als sie ihrerseits über Erfahrungen verfügten, die ihnen nunmehr Ritters eigene philosophische Antworten plausibel machten; es existiert – das bemerke ich heute – in der Ritter-Schule eine Schulkonvergenz als langfristige Spätwirkung. Damals jedoch, in der Studienzeit, gab es – begrenzt einzig durch institutionelle Pflichten und die Spürbarkeit jener Sorge, die sich Ritter um jeden von uns machte – beim Denken alle Freiheit: auch die, ein Skeptiker zu sein.
Den »interimistischen Skeptizismus« als »Position im nautischen Sinn« habe ich 1958 in meinem Buch Skeptische Methode im Blick auf Kant zu formulieren versucht: es war die (fast gänzlich umgeschriebene) Druckfassung jener Dissertation, mit der ich – Ritter war für drei Jahre nach Istanbul gegangen – 1954 in Freiburg promovierte, generös gefördert durch meinen Doktorvater Max Müller8. Das Buch galt als stilistisch eigenwillig: Form – Zeitdruckersatz unter Mußebedingungen – gehört als Mittel der Beliebigkeitsersparung zu den Produktionsschrittmachern beim Schreiben für den, dem Schreiben nicht leicht fällt. In einen ›Lebenslauf‹ geht normalerweise Wichtiges nicht ein: das Intime, das Schwere (es gibt das Grundrecht auf Ineffabilität); ich meine – und begann damals zu meinen –, dass man in der Philosophie dauerhafteren Umgang nur mit solchen Gedanken suchen sollte, die man auch in schweren Lebenslagen noch bemerkt und mit denen man es notfalls ein Leben lang aushalten kann. Das schließt – wie ich vor allem bei Kierkegaard und Heine lernte – die Suche nach der leichten und pointierten Formulierung nicht aus, sondern gerade ein; das ästhetische Kompositions- und Formulierungsspiel ist nicht das Gegenteil, sondern ein Aggregatzustand des Ernstes: jener, der den Ernst so ernst nimmt, dass er es für notwendig hält, ihn aushaltbarer zu machen. Dadurch fand ich zu meinem Genre: zur Transzendentalbelletristik.
2. Nachträglicher Ungehorsam. Das intellektuelle Klima der Bundesrepublik änderte sich: der »skeptischen Generation« folgte eine neue »Generation der politischen Jugend«. In der Philosophie ging ihr voraus der Erfolg der »Frankfurter Schule« nicht zuletzt bei den nunmehr Älteren. Auch auf mich hat die »Kritische Theorie« Horkheimers und Adornos wesentlichen Eindruck gemacht; Herbert Marcuses Eros and Civilization9 habe ich 1956 im Lesekreis des »Collegium Philosophicum« zustimmend und werbend referiert: Ich arbeitete damals schon an meiner Habilitationsschrift über Schelling und Freud10 mit der These: die Psychoanalyse ist – philosophisch gesehen – die Fortsetzung des deutschen Idealismus unter Verwendung entzauberter Mittel.
Freud benutzte – insbesondere in Totem und Tabu11 auch für die Theorie des Gewissens – den Begriff des »nachträglichen Gehorsams« (S. 173–175): die Söhne in der »Urhorde«, die den Vater ermordet hatten, »widerriefen ihre Tat, indem sie die Tötung des Vaterersatzes, des Totem, für unerlaubt erklärten, und verzichteten auf deren Früchte, indem sie sich die freigewordenen Frauen versagten« (S. 173); die »Totemreligion« war – wie dann auch das Gewissen – »aus dem Schuldbewusstsein der Söhne hervorgegangen als Versuch, dies Gefühl zu beschwichtigen und den beleidigten Vater durch den nachträglichen Gehorsam zu versöhnen« (S. 175). Der erfolgreiche Aufstand gegen den Vater wurde nachträglich ersetzt durch den Respekt vor dem, was an des Vaters Stelle trat. In der Bundesrepublik – meine ich – vollzog sich seit Ende der 50er-Jahre – und als spektakuläre Reprise dann in der so genannten »Studentenbewegung« Ende der 60er-Jahre – just das Gegenteil: die in der Nationalsozialistenzeit zwischen 1933 und 1945 weitgehend ausgebliebene Revolte gegen den Diktator (den Vater der »vaterlosen Gesellschaft«12) wurde stellvertretend nachgeholt durch den Aufstand gegen das, was nach 1945 an die Stelle der Diktatur getreten war: darum wurden nun die »Totems« gerade geschlachtet und aufgegessen und die »Tabus« gerade gebrochen: nach der materiellen Fresswelle kam so die ideologische. Es entstand ein frei flottierender quasimoralischer Revoltierbedarf auf der Suche nach Gelegenheiten, sich zu entladen; er richtete sich – zufolge der Logik der Nachträglichkeit – okkasionell und unwählerisch gegen das, was jetzt da war: gegen Verhältnisse der Bundesrepublik, also demokratische, liberale, bewahrenswerte Verhältnisse. Es ist – ich formuliere scharf (»gegen nichts ist man unnachsichtiger als gegen gerade abgelegte Irrtümer«: Goethe) – als Reflexion zelebrierte Dummheit, diese Verhältnisse zugunsten eines revolutionären Prinzips aufs Spiel zu setzen; denn es gibt keine Nichtverschlechterungsgarantie, auch und gerade nicht durch jene revolutionäre Geschichtsphilosophie, die sie durch den Fortschrittsgedanken zu geben verspricht:13 wir haben – und zwar in unserer Zeit und Gegend alle – sehr viel mehr zu verlieren als allein unsere Ketten.14 Das alles ignoriert der nachträgliche Protest; dadurch wird eine Demokratie zum nachträglichen Empörungsziel eines gegen die totalitäre Diktatur versäumten Aufstands: diese Absurdität steckt in der merkwürdigen Nachträglichkeit dieses Protestverhaltens. Es liegt nahe, zu seiner Beschreibung einen Gegenbegriff zu Freuds Begriff des »nachträglichen Gehorsams« zu bilden: darum nenne ich das, was hier – zwischen den späten 50er- und den frühen 70er-Jahren – vorging, den nachträglichen Ungehorsam.
Es war die Zeit des umgekehrten Totemismus. Zu ihm gehören eigentümliche Mechanismen und Reaktionen. Etwa: der Totemismus führt zu demonstrativer Askese; der umgekehrte Totemismus führt zu demonstrativer Libertinage, die sich als emanzipatorische und antiautoritäre Bewegung verstand. Im Totemismus zwingt – nach Freuds Interpretation – der Aufstand gegen einen Menschen (den Vater) zur nachträglichen Verehrung von Tieren (des Totem); im umgekehrten Totemismus zwingt der unterlassene Aufstand gegen das Staatstier ›Leviathan‹ zum nachträglichen Aufstand gegen wirkliche Väter und wirkliche Menschen. Dabei mag – individuell oder gruppenmäßig abgestuft – die Stärke einstmaliger Konformität mit der Stärke jetziger Distanzierung zuweilen signifikant korrelieren. Auch zwingt, dass eine Tat unterlassen wurde, nun dazu, dass nachträglich jedes Denken gleich zur Tat schreiten soll: ohne Rücksicht auf Spinozas Einsicht, dass man nur dann alles denken darf, wenn man nicht alles tun darf.15 Vor allem aber entstand der Zwang zur sekundären Verähnlichung von Heute und Damals: weil das, gegen das die Revolte unterblieb, Faschismus war, soll nun das, gegen das sie nachgeholt wurde, auch Faschismus sein und wird (durch ein entsprechendes Sortiment an Theorien) dazu stilisiert; denn sonst würde der Absurditätsgehalt des nur nachträglichen Ungehorsams allzu flagrant, und es würde allzu deutlich, dass er gegenwärtig in der Regel ein komfortabler Ungehorsam ist, der den Ungehorsamen wenig kostet. Darum wird die angleichende Negativierung des Vorhandenen – die Technik, in jeder Suppe ein Haar, in jeder Wirklichkeit Entfremdung, in jeder Institution Repression, in jedem Verhältnis Gewalt und Faschismus zu entdecken – zu hoher Kunst entwickelt: notfalls durch »Verbösung des Guten«16 und »geborgtes Elend«17 wird es sekundär negativiert. Partout nicht wegzuinterpretierende Differenzen zum Damals gelten als Zusatzschurkereien des Heute, als besonders infame Tarnung: so werden gerade Unterschiede zum Ähnlichkeitsbeweis. Niemand scheint dabei zu sehen, dass diese zwanghafte sekundäre Verähnlichung von Heute und Damals als nachträgliche Verharmlosung des Faschismus zu wirken geradezu prädestiniert wäre, wenn – womit offenbar niemand ernstlich rechnet – irgendjemand ihr wirklich glauben würde.
Der nachträgliche Ungehorsam kam nicht unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, sondern später, und zwar nicht zufällig. »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral« (Brecht): erst als durch den Wiederaufbau materiell erträgliche Zustände und dann Überflussverhältnisse entstanden waren, schlug das Entsetzen über das gewesene Schreckliche voll durch aufs Gewissen und wurde erst nun – mit Zeitverzug – moralisch wirklich unerträglich: erst jetzt fand man Zeit für Schuldgefühle, für das Unbehagen an der eigenen geschichtlichen Vergangenheit. Darum wurde gerade erst jetzt – und keineswegs früher – auch jenes Entlastungsangebot weithin unwiderstehlich und erfolgreich, das die entfremdungsentlarvende Kritik darstellte, die schnell monopolisiert wurde durch jene revolutionäre Geschichtsphilosophie, zu der die »Kritische Theorie« – alsbald gegen den Widerstand ihrer Erfinder und Protagonisten – weiterentwickelt worden war: dass man – wo Schuldvorwürfe es überlasten – das Gewissen nicht mehr zu haben braucht, wenn man das Gewissen wird. Aus dem nachträglichen Gehorsam entsteht das Gewissen, das man ›hat‹; aus dem nachträglichen Ungehorsam entsteht das Gewissen, das man ›ist‹: das Tribunal, dem man entkommt, indem man es wird. Es war das Erfolgsrezept der revolutionär geschichtsphilosophischen Kritik, diese Flucht aus dem Gewissenhaben in das Gewissensein zum Prinzip der Avantgarde zu machen und darauf ihren Anspruch zu gründen, dass nur noch die anderen die Vergangenheit sind und man selber nur noch die Zukunft, und zwar eben durch dieses nachträgliche Neinsagen. Eine der Geschichten vom Herrn Keuner von Brecht ist überschrieben »Maßnahmen gegen die Gewalt«18: Sie berichtet von einem Herrn Iggen (einem temperierten Akkomodateur zur Zeit der Gewalt), der erst dort, wo die Zeit der Gewalt vorbei ist, »nein« sagt. Diese Geschichte – das sei mein später Nachtrag zum sechsten Kolloquium (1972) der Gruppe »Poetik und Hermeneutik«19, zu der ich seit 1966 gehöre (ihr Motor war und ist Hans Robert Jauß) – scheint einschlägig interpretierbar: sie ist die nicht zu Ende geschriebene Parabel vom nachträglichen Ungehorsam.
Dies alles gehört in eine autobiographische Einleitung, weil es sich auch auf Introspektion stützt: auf eine Analyse des eigenen Mitmachverhaltens in den 60er-Jahren und seiner Umkehr in die Absage, in die Weigerungsverweigerung. Dazu gehört dann auch die Vermutung, dass diese Absage bei mir – einsetzend 1967: ich merke spät und habe lange Bremswege – erleichtert war durch die – gegenüber der frühen ›bloßen‹ Skepsis – nunmehr nachgeholte Konkretisierung. Denn inzwischen war bei mir der Schritt von der »Präexistenz« in die »Existenz«20 getan, der Schritt: zu heiraten (1960) und Vater zu werden, statt entlarvungsartistisch in Dauerreflexion zu verharren; die institutionelle Notwendigkeit der Habilitation endlich zu erfüllen (1963) und die Berufspflichten des akademischen Lehrers auf mich zu nehmen: als Privatdozent in Münster und ab 1965 in Gießen als Seminardirektor und als ordentlicher Professor und später – nach der Hochschulreform – als nicht mehr ganz so ordentlicher; schließlich als Dekan und seither unvermeidlich auch in mancherlei Funktionen der Wissenschaftsverwaltung, der Schul- und Hochschulpolitik, vor denen ich mich nicht gedrückt habe. Im Übrigen galt dann, was in Gides Falschmünzern Armand über seine Familie sagte: »Wir leben von Papas Glauben«, in abgewandelter Form auch von der meinen: Sie lebte von Papas Zweifeln und Verzweiflungen und seinem Talent, dieses Betriebskapital maßvoll mit Gelehrsamkeit vollzusaugen und in didaktische und transzendentalbelletristische Formulierungen umzusetzen, und sie lebte davon auf die Dauer – nach dem zweiten Ruf – nicht einmal schlecht. Sie hätte noch weit besser leben können, wenn ich dieses Betriebskapital nun auch noch durch ein Sortiment von revolutionären Gesinnungen und entsprechenden Theorien dauerhaft aufgestockt und arrondiert hätte; indes: dann hätte auch bei mir jene Diastase ein bestimmtes Spannungsquantum überschritten, die für diese ganze Phase bestimmend war: dass nämlich Reflexionswelt und Lebenswelt, Erwartungswelt und Erfahrungswelt, Gesinnungswelt und Verantwortungswelt, Reformwelt und Arbeitswelt, Resolutionswelt und Handlungswelt, Empörungswelt und glaubwürdige Welt auseinander traten und beziehungslos wurden zueinander.
3. Skepsis und Endlichkeit. Die Undurchhaltbarkeit dieser Diskrepanz – meine ich – führte zu dem, was man »Tendenzwende« genannt hat: sie war die fällige Verehrlichung der Verhältnisse. Denn es gibt das Recht der nächsten Dinge gegenüber den letzten.
Zu dieser neuen Ernüchterung gehörte der Katzenjammer in Bezug auf den Illusionsgehalt des nachträglichen Ungehorsams: mich jedenfalls wurmte es, dass mich gerade die Skepsis zu einer neuen Vertrauensseligkeit geführt hatte. Es scheint – unbehaglicherweise – so etwas zu geben wie ein Gesetz der Erhaltung der Naivität: Die menschliche Misstrauenskapazität ist begrenzt, und je mehr man sie an einer der Denkfronten konzentriert, desto leichter kommt die Naivität zum Sieg an den anderen. Die Gegenwartsszene ist bewegt von Gegenbesetzungen gegen diese unbehagliche Erfahrung; darüber – zum Beispiel – wurden unsere Dichter zu kochenden Seelen: sie kochen fast alle, entweder vor Wut oder am Herd (oder beides), und allemal gibt das Bücher. Ich selbst kann nicht kochen, es sei denn auch nur mit Wasser; aber sogar das – tristesse oblige! – gab ein Buch: die Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie (1973), die hier eine Zwischenbilanz versuchten. Die Philosophie – das gilt für die des nachträglichen Ungehorsams wie für die Zweifelsorgien der bloßen Skepsis – ist kein Amulett, das gegen Irrwege schützt; das nahm ich ihr übel, und aus dieser Enttäuschung heraus entstand der hier secundo loco abgedruckte – 1973 zum 60. Geburtstag von Hermann Krings geschriebene – Aufsatz »Inkompetenzkompensationskompetenz?«, der natürlich die Skepsis gegenüber der Philosophie übertrieb: aber gerade das ließ ihn mitrepräsentativ sein für jene spezifisch deutsche »Selbstunsicherheit der Philosophie«21 und Verzweiflung an ihr, die – historisch bedingt – eine umgekippte Überhoffnung ist. Denn die »verspätete Nation« – das hat Plessner dargelegt – kompensiert ihr verspätungsbedingtes Defizit an politischen Liberalwirklichkeiten zunächst durch Übererwartung an die Geisteskultur, speziell an die Philosophie. Doch diese Übererwartung kann die Philosophie (wie ihr Weg durchs 19. Jahrhundert zeigt, auf dem gerade darum die Kunst der Enttäuschung entstand: die Ideologiekritik) nur enttäuschen: Das erzwang – anders als etwa in den angelsächsischen Demokratien, deren Ansprüche an die Philosophie von vornherein bescheidener sein konnten – gerade in Deutschland die Neigung, die absolute Hoffnung auf die Philosophie schließlich durch die absolute Verzweiflung an der Philosophie zu ersetzen. Das tat auch mein Aufsatz über die »Inkompetenzkompensationskompetenz« der Philosophie. Im Grunde aber wollte er für die Philosophie nur das Ende der Unbescheidenheit22: in diesem Sinne wiederholte und bekräftigte er die Wende zur Skepsis.
Gerade diese Wende zur Skepsis jedoch – wiederholt und bekräftigt – musste skeptischer werden in Bezug auf sich selber: insbesondere angesichts des unbehaglichen Verdachts, sie wirke als indirekte Ermächtigung von Weltverbesserungsillusionen. Darum wurde es fällig, ihr Illusionspotential zu reduzieren: das Quantum quasigöttlicher Souveränität, das der Dauerzweifel zu enthalten scheint, an die Kette der Menschlichkeit zu legen und die Skepsis (meinethalben durch »existenzialistische« Akzentuierung) umzudefinieren zu einer Philosophie der Endlichkeit.
Darum wurden jetzt gleichwichtig mit dem Zweifel jene Züge, die die Skepsis – historisch belegbar – stets auch gehabt hat: die Ernstnahme des »Einzelnen« und die Bereitschaft, gemäß den »Sitten der Väter« zu leben, d. h. – wo es keine zwingenden Gründe fürs Abweichen gibt – nach Üblichkeiten zu handeln. Das ist für Menschen unausweichlich, weil sie Einzelne sind. Die Skepsis wünscht sich zwar den vermeidlichen Einzelnen: die gebildete Individualität. Aber sie rechnet mit dem unvermeidlichen Einzelnen: das ist jeder Mensch, weil er »unvertretbar« sterben muss und »zum Tode« ist.23 Dadurch ist das Leben des Menschen stets zu kurz, um sich von dem, was er schon ist, in beliebigem Umfang durch Ändern zu lösen: er hat schlichtweg keine Zeit dazu. Darum muss er stets überwiegend das bleiben, was er geschichtlich schon war: er muss »anknüpfen«. Zukunft braucht Herkunft: »die Wahl, die ich bin«24, wird »getragen« durch die Nichtwahl, die ich bin; und diese ist für uns stets so sehr das meiste, dass es – wegen unserer Lebenskürze – auch unsere Begründungskapazität übersteigt: Darum muss man, wenn man – unter den Zeitnotbedingungen unserer vita brevis – überhaupt begründen will, nicht die Nichtwahl begründen, sondern die Wahl (die Veränderung): die Beweislast hat der Veränderer. Indem sie diese Regel25 übernimmt, die aus der menschlichen Sterblichkeit folgt, tendiert die Skepsis zum Konservativen. »Konservativ« ist dabei ein ganz und gar unemphatischer Begriff, den man sich am besten von Chirurgen erläutern lässt, wenn diese überlegen, ob »konservativ« behandelt werden könne, oder ob die Niere, der Zahn, der Arm oder Darm herausmüsse: lege artis schneidet man nur, wenn man muss (wenn zwingende Gründe vorliegen), sonst nicht, und nie alles; es gibt keine Operation ohne konservative Behandlung: denn man kann aus einem Menschen nicht den ganzen Menschen herausschneiden. Das – unabsichtlich oder nicht – übersehen die, die den Begriff des Konservativen perhorreszieren. Analog lässt sich nicht alles ändern und darum nicht jegliches Nichtändern unter Anklage stellen: Deswegen bewirken die, die das – von den Geschichtsphilosophen bis zu den Diskursphilosophen – im Sinne einer »Übertribunalisierung der Wirklichkeit« tun, etwas anderes, als sie wollen. Das habe ich (mit Blick auf die Anfangskonstellation dieses Zusammenhangs) in dem 1978 geschriebenen Aufsatz »Der angeklagte und der entlastete Mensch in der Philosophie des 18. Jahrhunderts« darlegen wollen, der hier tertio loco abgedruckt ist: Die Übertribunalisierer etablieren nicht die absolute Rationalität, sondern den »Ausbruch in die Unbelangbarkeit«, der für Freiheiten eintritt, die wir – vor aller prinzipiellen Erlaubnis – schon sind; dazu gehören Üblichkeiten. Weil wir zu schnell sterben für totale Änderungen und totale Begründungen, brauchen wir Üblichkeiten: auch jene Üblichkeit, die die Philosophie ist. Die Skeptiker rechnen also mit der sterblichkeitsbedingten Unvermeidlichkeit von Traditionen; und was dort – üblicherweise und mit dem Status von Üblichkeiten26 – gewusst wird, wissen auch sie. Die Skeptiker sind also gar nicht die, die prinzipiell nichts wissen; sie wissen nur nichts Prinzipielles: die Skepsis ist nicht die Apotheose der Ratlosigkeit, sondern nur der Abschied vom Prinzipiellen.
Demgegenüber will die prinzipielle Philosophie gerade prinzipiell und Prinzipielles wissen: darum fragt sie nach den Prinzipien und nach dem prinzipiellsten Prinzip. Dieses absolute Prinzip aber – das (wie immer es gedacht wird) stets sozusagen das Gewissen ist, das die Wirklichkeit haben soll – verwandelt die faktische Wirklichkeit insgesamt in das Unselbstverständliche, Kontingente, Ungerechtfertigte, das aus diesem unprinzipiellen oder gar konterprinzipiellen Status allererst durch prinzipielle Rechtfertigung (durch prinzipielle Begründung oder durch prinzipielle Veränderung) erlöst werden muss. Als derartige ›Verwandlung‹ der Wirklichkeit ins Rechtfertigungsbedürftige – als tendenzielle Tribunalisierung der Wirklichkeit – ist die prinzipielle Philosophie der fundamentale Spezialfall einer Veränderung. Wenn aber – sterblichkeitsbedingt – gilt: die Beweislast hat der Veränderer, dann (wenn also das Faktische das Apriori des Prinzipiellen ist, und zwar gerade durch seine Vergänglichkeit) muss die prinzipielle Philosophie zuerst nicht das Faktische, sondern zuerst sich selber rechtfertigen.27 Doch beide Rechtfertigungen der prinzipiellen Philosophie – die Rechtfertigung des Prinzipiellen vorm Faktischen und die Rechtfertigung des Faktischen vorm Prinzipiellen – kommen entweder zu leer oder zu spät: nämlich, als unendliche Antwort an ein endliches Wesen, stets erst nach dessen Tod. Falls der transzendentale Hase als Überbringer der prinzipiellen Botschaft – unwahrscheinlicherweise – wirklich einmal gerannt käme (und dabei nicht von nichts, sondern wirklich von etwas wüsste), läge der endliche Swinegel immer schon da: tot. Das Prinzipielle ist lang, das Leben kurz; wir können mit dem Leben nicht warten auf die prinzipielle Erlaubnis, es nunmehr anfangen und leben zu dürfen; denn unser Tod ist schneller als das Prinzipielle: das eben erzwingt den Abschied vom Prinzipiellen. Darum muss der endliche Mensch – einstweilen, in provisorischer Moral: aber jedenfalls bis zu seinem Tod – ohne prinzipielle Rechtfertigung leben (so dass das Gewissen jeweils mehr Einsamkeit ist als Universalität; Mündigkeit ist vor allem Einsamkeitsfähigkeit): er muss kontingent und aus Kontingenzen heraus existieren, die aber für ihn – den Anknüpfenmüsser, der nicht vor ihnen steht wie Buridans Esel vor den Heuhaufen, sondern der in ihnen steckt und stets nur wenig herauskann – keine beliebig wählbaren und abwählbaren Beliebigkeiten sind, sondern (als die Nichtwahl, die er ist) unverfügbare und kaum-entrinnbare Schicksale. Deswegen – das macht der 1976 geschriebene und hier quarto loco abgedruckte Aufsatz »Ende des Schicksals? Einige Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren« geltend – wurde zwar das Schicksal theologisch-metaphysisch durch das absolute Prinzip des einen Gottes verdrängt; aber das verdrängte Schicksal kehrte – spätestens nach dem »Ende Gottes«, durch das die Neuzeit entstand – unverzüglich wieder: als die »Unverfügbarkeit der Vorgaben« und die »Unverfügbarkeit der Folgen«. Aus Kontingenzen zu leben, d. h., ein Schicksal zu haben ist – wegen ihrer Sterblichkeit – für die Menschen unvermeidlich.
All diese Überlegungen verabschieden die prinzipielle Philosophie; aber sie verabschieden nicht die unprinzipielle Philosophie: die Skepsis. Sie verabschieden für die Menschen die prinzipielle Freiheit; aber sie verabschieden nicht die wirkliche Freiheit, die im Plural: die Freiheiten. Zu ihnen kommt es durch die Buntheit des Vorgegebenen: dadurch, dass die Vielfalt – die Rivalität, der gleichgewichtige Widerstreit, die Balance – seiner Mächte deren Zugriff auf den Einzelnen neutralisiert oder limitiert. Freiheiten entstehen durch Gewaltenteilung. Der Sinn für diese Freiheiten ist nicht die prinzipielle Philosophie, sondern die Skepsis. Das bestimmt zugleich die Rolle ihres Zweifels: als Teilung auch noch jener Gewalten, die die Überzeugungen sind, ist der skeptische Zweifel der Sinn für Gewaltenteilung. Er ist nicht die absolute Ratlosigkeit, sondern der Vielfaltsinn für die »isosthenes diaphonia«28 – die Balance – nicht nur widerstreitender Dogmen, sondern auch widerstreitender Wirklichkeiten, die eben dadurch – divide et liberaliter vive! – dem Einzelnen Freiheiten lässt und jene Entlastung vom Absoluten gewährt, die vor allem auch – wie Hans Blumenberg gezeigt hat29 – als »mythische Gewaltenteilung« wirkt. In meinem Anfang 1978 geschriebenen und hier quinto loco abgedruckten Aufsatz »Lob des Polytheismus. Über Monomythie und Polymythie« habe ich das (durchaus in Spuren Blumenbergs gehend30) geltend gemacht: Freiheit ist, nicht »monomythisch« nur eine einzige Geschichte haben dürfen, sondern »polymythisch« deren viele durch die Teilung auch noch jener Gewalten, die die Geschichten sind. Dabei muss man – was diese Buntheit und Vielfalt betrifft – notfalls nachhelfen: und das – zumindest auch das – heißt dann Hermeneutik. In dem 1979 geschriebenen und hier sexto et ultimo loco abgedruckten Beitrag »Frage nach der Frage, auf die die Hermeneutik die Antwort ist« wollte ich – als späte, längst überfällige Bekräftigung meiner Zugehörigkeit zum hermeneutischen Lager – justament das unterstreichen: Hermeneutik ist die für Menschen lebensnotwendige Kunst, sich verstehend in Kontingenzen zurechtzufinden, die man festhalten und distanzieren muss, weil Wesen mit befristeter Lebenszeit sie nur begrenzt loswerden können; und der modernste Teil dieser Lebenskunst besteht – »lesen und lesen lassen!« – darin, den »absoluten Text«, der in den hermeneutischen Bürgerkriegen (den Konfessionskriegen) tödlicher Streitfall wurde, zum »relativen Text« – zum neutralen, literarischen, ästhetischen – unter anderen relativen Texten zu zähmen durch Pluralisierung auch noch der Lesarten, der Rezeptionsversionen: als Teilung auch noch jener Gewalten, die die Texte und Auslegungen sind, so dass »der Kern der Hermeneutik die Skepsis und die aktuelle Form der Skepsis die Hermeneutik« ist. Wir müssen unsere Kontingenz ertragen: Gerade die Skepsis – und auch das in dieser Einleitung Ausgeführte – ist keine absolute Mitteilung, weil jede Philosophie in ein Leben verwickelt bleibt, das stets zu schwierig und zu kurz ist, um absolute Klarheit über sich selber zu erreichen. »Das Leben« – sagt ein Sprichwort – »ist schwer, aber es übt«: vor allem trainiert es – more sceptico – Zufriedenheiten damit, dass es endlich ist.