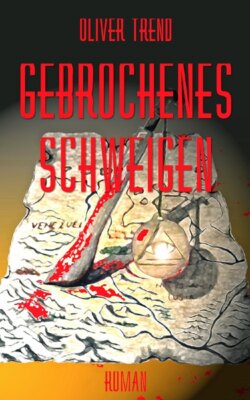Читать книгу Gebrochenes Schweigen - Oliver Trend - Страница 5
1
ОглавлениеEs begann im Frühsommer des Jahres 1948, als die blutige Violencia in Kolumbien losbrach, ein Bürgerkrieg von vielen. An diesen jedoch erinnere ich mich noch genau, da an jenem schicksalhaften Tag mein neunter Geburtstag gefeiert wurde. Es war der heißeste Tag des Jahres, und das nicht etwa nur der Hitze wegen, nein! Es wäre sogar möglich, dass es sich um den heißesten Tag eines ganzen Jahrzehnts handelte, und glauben Sie mir ruhig, dieses Datum, der 27. Mai 1948, brannte sich erbarmungslos in die Gedächtnisse und Seelen aller Kolumbianer ein. Ich verlor meine über alles geliebte Familie und all meine Freunde, einfach alles, was mir bis dahin lieb und teuer gewesen war.
Seit drei Monaten hatte es nicht mehr geregnet, der Boden in den höheren Regionen war staubtrocken. Viele der wilden Tiere kamen aus diesem Grund in dieser Jahreszeit mit ihren Jungen in die Tiefebenen herunter.
In einer dieser Tiefebenen der Ostkordilleren lebte ich in einem kleinen, aber reichen Dorf mit dem verheißungsvollen Namen Nuevo Alumbrado, was so viel bedeutet, wie „Neue Beleuchtung“. Nahe dem Río Humea, dem einzigen Fluss hier, der um diese Jahreszeit für alle genügend Wasser mit sich führte und dessen Uferläufe noch nicht ausgedorrt waren. Er mündete viele hundert Kilometer südöstlich, am Fuße des Anden-Gebirgsverlaufs, in den Río Meta und den Orinoco. Manchmal, wenn sich die wilden Tiere unbeobachtet fühlten, wagten sie sich auch tagsüber zum Río Humea herunter. Mein Onkel und Horatio, sein Chauffeur, erklärten mir dann flüsternd von der terraza grande aus, welcher Artenfamilie sie angehörten, ob sie gefährlich waren und wie ich mich verhalten sollte, wenn ich ihnen im Floresta Negra begegnete: Ein Wald, der sich weit die Anden hinaufzog, bis er vom ewigen Schnee abgelöst wurde. Wir nannten ihn so, weil die Bäume sehr dicht beieinander standen und hoch in den Himmel hinauf wuchsen. Und auch, weil der Wald am Tage düster und bedrohlich wirkte, vor allem auf uns Kinder! Weit im Süden verschmolz er mit dem Amazonasbecken, einer geheimnisvollen Landschaft aus dichten, tropischen Hölzern, vielen Flüssen, und Tieren, deren Namen ich nicht aussprechen konnte.
Die Erwachsenen betrachteten den Floresta Negra als Geschenk des Himmels. Denn einige Jahre zuvor wurden etwa drei Kilometer oberhalb des Dorfes beachtliche Smaragdvorkommen entdeckt, die den bis zu diesem Tag armen Bauern und einfachen Arbeitern erlaubten, sich fortan ein ruhigeres und besseres Leben zu gönnen. Das ging gut, bis zu den vorjährigen Präsidentschaftswahlen, dessen schändliche Folgen am Tag meines Geburtstages mich und die Leute unseres wunderbaren Tales erreichten, wie auch ein Tropensturm es im Sommer oft tat. Jeder wusste, dass er irgendwann kommt, aber niemand konnte vorhersagen, wann oder aus welcher Richtung er das Chaos mit sich bringen würde!
Die Truppen von Präsident Mariano Ospina Pèrez drangen mit Panzern und Artilleriegeschützen im Schutze des uns umgebenden Floresta Negra und der vorangegangenen Nacht zu uns vor. Sie erschienen mit den wilden Tieren, folgten leise ihren Spuren, bis hin zu unseren Dörfern. Pèrez’ Soldaten schlugen erst nach Mittag zu, in jener Stunde, die allgemein als siesta bekannt war. In der die meisten Bewohner Kolumbiens, ja in ganz Lateinamerika, ein Nickerchen zu tun pflegten.
Mein Onkel, Salvatore de la Sourca, war ein schlanker Mann mittlerer Größe und Großgrundbesitzer der vierten Generation. Er baute in der unteren Tiefebene traditionell Guadua-Bambus an, wie Novogratense in der oberen Tiefebene. Um genau zu sein, gehörte ihm Nuevo Alumbrado samt umliegendem Gebiet – eine Fläche von mehr als tausendfünfhundert Hektar Land: Also auch ein beachtlicher Teil des Floresta Negra unter- und oberhalb des Dorfes, in dem sich die Militärs von Pèrez für den Angriff wappneten!
Sie ahnen sicher, dass nichts auf seinem Land geschehen konnte, ohne dass er davon Wind bekam – auch nicht die heimliche Aufstellung von Soldaten einer subversiven Regierung, die den fast wichtigsten Stützpfeiler der kolumbianischen Gesellschaft mit Gewalt zu verdrängen suchte: nämlich die für das gemeine Volk so wichtige katholische Kirche.
Der einfache Diener Gottes unseres Dorfes war empört und außer sich über die unwürdigen Maßnahmen der Regierung, weswegen er an diesem Tag in der Kapelle blieb und betete. Salvatores Hacienda, seine Plantagen und Minen wurden seit knapp einem Jahr von mehreren privat organisierten paramilitärischen Milizen gesichert. Ebenso beschützten sie die Bewohner des Dorfes, sofern diese ihr Schutzgeld pünktlich an meinen Onkel entrichteten.
Wir hatten uns an dem Tag alle auf der terraza grande von Onkel Salvatores Hacienda (von wo aus er mir sonst immer mit Horatio zusammen die wilden Tiere erklärte) versammelt. Ich packte voller Freude meine Geschenke aus. Die Hacienda, die er bewohnte, hätte für das halbe Dorf gereicht, aber er lebte nur mit Salma, meiner Tante, und ihrem gemeinsamen Sohn Chevaron dort – ein eingebildeter Junge, der mich meistens hänselte.
Es war kurz vor Mittag, die Sonne kroch unaufhörlich gen Zenit zu. Die Luft war feucht; es roch nach Tang vom nahen Fluss. Ein leichter Wind umgarnte die Tiefebene, brachte aber nicht die gewünschte Abkühlung mit, nur den schweren Geruch des Tangs. Ein von meinem Onkel zusammengestelltes Orchester aus dem fernen Medellín spielte leise auf der tags zuvor frisch gemähten Wiese die zeitlosen Kompositionen zu Verdis `La Traviata` – Sempre Libera.
Während ich neugierig das Geschenk von Horatio auspackte, guckten mir alle geladenen Gäste lachend zu. Sie waren heute zum Scherzen aufgelegt und nahmen sich gegenseitig hoch.
„He, Luis!“, rief Horatio dem el gigante con solo un brazo, wie der einarmige Riese oft von seinen sogenannten Freunden betitelt wurde, zu.
Luis drehte seinen Kopf und blickte zu ihm herüber.
Horatio war aufgestanden und stellte sich grinsend hinter die dicke Haushälterin. Er ließ seine Hüften im Takt zu Maria Callas’ hoher Stimme vor- und zurückschwenken.
Luis und die anderen Männer johlten auf und feuerten ihn lautstark an, „si, hombre!“, als die Haushälterin sich plötzlich umdrehte und Horatio eine scheuerte.
„Caramba, pórtate bien, Horatio!“
Die Männer krümmten sich vor Lachen und mahnten ihn: „Hast du gehört, Horatio, benimm dich!“
Dieser winkte ab und meinte nur: „Ja, ja …, man darf doch noch seinen Spaß haben oder?“, und sein Grinsen verschwand zunehmend aus seinem vollen Gesicht. Seine tiefliegenden Augen schielten einige Male unsicher zum Patron herüber.
Der lehnte lässig an der Balustrade und lachte wie die anderen.
Horatio schüttelte darauf seinen Kopf und gab der Haushälterin, die abermals an ihm vorbeiging, einen Klaps auf den Hintern, wofür er noch mal eine kassierte.
„Ich warne dich, Horatio!“, knurrte sie mit funkelnden Augen und einem spitzbübischen Schmunzeln. „Sonst sag ich deiner Frau, dass du deine Hände nicht bei dir lassen kannst und sie dich gefälligst an die Leine nehmen soll!“
Die anderen grölten lauthals, während sie Horatio stirnrunzelnd anstarrte. „Oder lässt sie dich jetzt schon nicht mehr ran, mmmhh?“, fragte sie darauf schnippisch und stemmte ihre Fäuste in die Hüften. „Warum?“, wollte sie weiter wissen. „Wäschst du dich nicht oft genug?“
Luis krümmte sich auf seinem Stuhl und gab glucksende Töne von sich.
„Das … das“, stotterte Horatio verlegen, „geht dich nichts an! Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Sache!“
„Mein Hintern ist meine Sache!“, fauchte sie und ließ ihn stehen.
„Ja, ja, … lacht nur, ihr …“, maulte Horatio, während er sich zu seinem Platz begab und sich niedergeschlagen auf den Holzstuhl plumpsen ließ und „bin auch nur ein Mann!“ murmelte.
Luis neben ihm hatte vor Lachen Tränen in den Augen und schüttelte immer wieder zuckend den Kopf.
Die Kinder und ich kümmerten uns nicht um die Männer, wir waren viel zu sehr mit den überwältigenden Geschenken beschäftigt. Wir saßen in einem Kreis am Boden nicht weit von Horatio entfernt; ich packte gerade das Geschenk von Tante Salma aus. Zum Vorschein kam ein weißer Hut mit einer rosaroten Schleife. Ich jauchzte vor Freude, während ich aufsprang, zu Tante Salma eilte, sie fest umarmte und mich bedankte. „Danke, Tante Salma, den habe ich mir schon so lange gewünscht!“, ich drückte mich an ihre Brust.
„Ich weiß, Liebes! Pass immer gut darauf auf, ja!“, mahnte sie und fuhr mir mit der Hand durch mein langes Haar. „Und jetzt pack die anderen Geschenke aus, sonst bist du heute Abend noch nicht fertig damit!“, neckte sie und kitzelte mich.
„Aufhören, Tante Salma … bitte aufhören!“, johlte ich, und sie ließ mich nach einem Moment los.
„Jetzt pack die anderen Sachen aus! Die Leute hier“, zeigte sie in die Runde der Gäste, „warten gespannt darauf, dass ihre Geschenke als Nächstes dran sind.“
Die Bauern und Arbeiter aus der Umgebung nickten alle gut gelaunt.
Ich schnappte mir das nächstbeste Paket.
Selbstverständlich waren nur diejenigen Bauern und Arbeiter mit ihren Familien geladen worden, die ihr Schutzgeld pünktlich an meinen Onkel zahlten. Die anderen schmollten im nahen Dorf und warteten auf den Tod, ohne es auch nur zu ahnen. Die Männer spielten gelangweilt Karten oder lagen vom Bier niedergestreckt, geräuschvoll dösend in ihren flickbedürftigen Hängematten auf ihrer einfachen Veranda. Ihre Frauen hockten zusammen und tratschten, wie jeden Nachmittag, bis auf den heiligen Sonntag natürlich, ausgelassen miteinander. Dafür gab es in Nuevo Alumbrado einen Platz, der nach dem berühmten Freiheitskämpfer Simón Bolívar benannt worden war; an dem sich die Frauen trafen, um sich die jungfräulichsten Neuigkeiten zu berichten und nicht selten lautstark darüber zu urteilen. Der Platz war von den einfachen Fincas umgeben, in denen sie meist seit ihrer Kindheit wohnten. Dahinter verbarg sich der urgewaltige Regenwald, der heroisch in den türkisblauen Himmel ragte – la Floresta Negra. Heute war das Thema der Tratschtanten, wie konnte es auch anders sein: Mein Geburtstag!
Aber ehrlich gesagt, bekam ich es an dem herrlichen Tag nicht mit. Ich war zu sehr mit den vielen großzügigen Geschenken beschäftigt, die mit Abstand die tollsten waren, die ich je bekommen hatte.
Schließlich schaffte ich es aber, jedes von ihnen auszupacken und mich dafür zu bedanken. So durfte ich endlich mit den anderen Kindern spielen gehen. Wir verzogen uns von der knarrenden terraza grande.
Wir schlenderten zusammen zum nahen Waldrand, wo wir einen roten Ball hin- und herwarfen. Ich sollte hier erwähnen, dass es mir wie den anderen Kindern verboten war, dort zu spielen! Doch war es wohl genau das, was mich diesen schrecklichsten Tag meines Lebens überleben ließ. Vielleicht war es auch Gott, der einfach nicht wollte, dass ich an meinem Geburtstag sterben sollte.
Niemand, weder die tratschenden Frauen auf dem Platz des Simón Bolívar noch wir fröhlich miteinander spielenden Kinder oder die geladenen Bauern, bemerkten, dass die Vögel heute erstaunlich still waren, ebenso wie die Affen und anderen Tiere.
Onkel Salvatore natürlich schon. Schließlich handelte es sich nicht nur um ein paar versprengte Soldaten der Regierung, sondern um ein ganzes Regiment, welches von General Morillias in mehrere schlagkräftige Bataillone, die schon seit Tagen von den Anden her in die Täler vordrangen, aufgeteilt wurde.
Wir vergnügten uns, unwissend vom nahenden Unheil, lautstark mit dem Ball – ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen! Wohl auch deswegen, weil sich noch so viel ereignen würde, und ich … Stopp! Ich greife den Geschehnissen zu weit vor, entschuldigen Sie! Wo waren wir? Ach ja, im Wald! Wir spielten im Schatten der mehr als dreißig Meter hohen Regenwaldbäume.
Chevaron warf mir gerade den Ball zu, den ich nicht zu halten vermochte. Er rollte raschelnd hinter mir in die dichten Büsche, und ich musste ihn suchen gehen.
Die Kinder riefen meinen Namen, während ich durch das Dickicht kroch.
„Ja, ich komme ja!“, gab ich lautstark zurück, als ich den Ball auch schon entdeckte. Ich bewegte mich auf allen Vieren darauf zu, darauf bedacht, mein Kleid nicht kaputt zu machen. Dreckig war in Ordnung, aber wenn ich es, aus welchen Gründen auch immer, zerriss, bekam ich richtigen Ärger mit meiner Mutter.
Als ich den Ball erreichte, bemerkte ich erschrocken, dass ein Mann in einem eigentümlichen, purpurfarbenen Gewand daneben stand. Er hatte keine Haare auf dem Kopf und blickte mich mit tiefgrünen Augen, die von vielen Falten umgeben waren, an. „La Fraternitis wird dich beschützen, mein Kind!“ Er hüstelte, glotzte mich an, während sich noch mehr Falten in seinem Gesicht bildeten.
Es raschelte plötzlich überall um uns herum. Äste brachen knackend. Er hob seinen dürren Zeigefinger an die spröden Lippen. „Schschschscht!“
Keine Sekunde später erfüllten schallende Maschinengewehrsalven die von der Hitze flimmernde Luft.
Ich schrak zusammen und drehte mich panisch um. Allerdings hockte ich mitten in den Büschen und konnte deswegen nicht wirklich etwas erkennen. Ich drehte mich gehetzt zu dem Mann um. Er war verschwunden.
Wieder Schüsse.
„Onkel Salvatore!“, wimmerte ich unschlüssig, was ich tun sollte. Da traf mich etwas Hartes am Hinterkopf, und mir wurde schwindlig.
„Onkel Salvatore!“, wiederholte ich mit brüchiger Stimme; einen Augenblick später sackte ich bewusstlos auf den trockenen, mit Ästen übersäten Untergrund. Das bewahrte mich davor, mit ansehen zu müssen, wie meine Eltern, mein Onkel und meine Tante; alle, die ich kannte, auf bestialische Weise ermordet wurden: Selbst den Pater, der seit den frühen Morgenstunden in seiner kleinen Kapelle am westlichen Ende des Dorfes betete, verschonten sie nicht. Nicht einmal einen einfachen Diener Gottes!
Als ich das erste Mal erwachte, war es bereits Nacht, und der Vollmond leuchtete auf uns herab. Alles um mich drehte sich. Ich brauchte einige Zeit, bis ich begriff, was geschehen war; respektive geschehen sein konnte. Erst, als ich den roten Ball neben mir entdeckte, der inzwischen von Kugeln zerfetzt war, begriff ich es. Ich kroch hektisch aus den raschelnden Büschen, dahin, wo wir vorhin gespielt hatten.
An der Stelle lag Chevaron vor mir auf der Erde. Seine feinen Kleider, die er extra für meinen Geburtstag hatte anziehen dürfen, waren mit rot umrandeten Löchern übersät. Bei genauerem Hinsehen bemerkte ich durch sein zerrissenes Hemd, dass sein Bauch über der Hose aufgeplatzt war und überall Feuerameisen herumwuselten.
„Chevaron?“, japste ich entsetzt, ahnend, dass er tot war.
Auch alle anderen Kinder, die mit mir gespielt hatten, lagen um ihn herum im feuchten Morast! Meine Kraft ließ augenblicklich spürbar nach. Ich kippte nach hinten; die Ohnmacht nahm mich wiederholt in ihren wiegenden Armen auf. Ich registrierte nicht einmal mehr, wie mein Oberkörper auf dem Waldboden aufschlug. Auch nicht, wie das Militär mein geliebtes Nuevo Alumbrado samt Hacienda meines Onkels anzündete, wie es loderte und knackend in sich zusammenbrach, es auf bizarre Weise die sternenklare Nacht erhellte, ebenso wie in Dutzenden anderer kleiner Dörfer in den Tiefebenen der Ostkordilleren. Trotzdem wurde ich in dieser Nacht erwachsen, so erwachsen, wie ein Mädchen mit neun Jahren nur werden kann.
Denn, als ich das nächste Mal erwachte, lag ein unrasierter, keuchender Mann auf mir. Ein Soldat, der aus jeder Ritze seiner Uniform stank, sodass mir speiübel wurde. Allerdings war es wohl auch der Grund, weshalb ich wieder das Bewusstsein erlangte.
Der Mann schob gerade seine glitschige Zunge lüstern in meinen trockenen Mund, als mir dämmerte, was mit mir geschah.
Ich presste meine Lippen aufeinander.
Er meinte keuchend: „Stell dich nicht so an, Kleines, ich werde dir nicht weh tun!“, wieder drückte er seine Zunge zwischen meine Lippen.
Ich konnte das feuchte Etwas an meinen Zähnen fühlen und wollte schreien.
Der Soldat hielt mir plötzlich die Nase zu, dass ich mit dem Mund nach Luft schnappen wollte.
Stattdessen bekam ich nur die faulige Luft seiner Lungen von ihm. Ich spürte, wie sich seine Zunge gierig in meine Mundhöhle hineinwand. Keine Luft …! Ich kriege keine Luft!, schoss es mir durch den Kopf. Dabei versuchte ich, mich zu drehen, um von dem stinkenden Mann wegzukommen. Aber ich schaffte es nicht, zumindest nicht so! Getrieben durch die tief sitzende Angst, biss ich so fest ich konnte mit meinen Zähnen zu! Presste sie so heftig aufeinander, bis es schrecklich knirschte und mein Mundraum nass und warm wurde.
Der Soldat ließ augenblicklich von mir ab und drückte sich vor Schmerz stöhnend die Lippen zusammen. Doch die Anstrengung war umsonst! Blut quoll ihm aus den vibrierenden Mundwinkeln, ohne dass er es verhindern konnte. Er torkelte im Schein des brennenden Dorfes in seiner Qual nach hinten und versuchte, das quellende Blut hinunterzuschlucken. Aber es schien ihm das Leben nicht zu retten, da er nach einigen Sekunden Blut aus der Nase pustete, worauf er unkontrolliert hustete. Er spuckte einen Schwall Blut nach mir und sackte vor Pein schwer stöhnend auf den Waldboden. Der Mann wollte wieder husten, was ihm diesmal nicht richtig gelang. Ich vermute, weil er den kümmerlichen Rest seiner Zunge heruntergeschluckt hatte. Er zitterte am ganzen Leib, während seine rechte Hand nach der Waffe im ledernen Halfter tastete. Seine dunklen Augen starrten mich an, als wäre ich ein Waldteufel. Schweiß perlte ihm von der Stirn, ich konnte es deutlich im flackernden Schein des Feuers erkennen.
Ich sah voller Furcht zu ihm hoch, ohne dass ich es fertig brachte, zu schreien. So spuckte ich, ohne es zu wollen, die Spitze seiner weichen Zunge aus dem Mund. Dabei beobachtete ich, wie er den Halfter, in dem seine Dienstwaffe steckte, fand.
Er zog die Waffe mit einem Ruck heraus und zielte auf mich, doch die Luft, die er dafür brauchte, reichte nicht mehr aus! Er zuckte plötzlich wild und unwillkürlich, schmiss die Waffe im wahrsten Sinne des Wortes weg; fasste sich panisch an die Kehle und grunzte eigenartig, während sein Mund weit offen stand. Blut quoll dunkel glitzernd aus seinem krampfhaft aufgesperrten Maul und aus seinen Nasenlöchern. Er glotzte mich aus aufgerissenen Augen an, ehe er nach hinten stürzte und elendig krepierte.
Ich fixierte gebannt den sich in der Agonie windenden Soldaten, bis zum letzten Zucken. Mir schossen unzählige Gedanken durch den Kopf, denn wir Mädchen wurden dahin erzogen, immer zu helfen, dem Mann zu Diensten zu sein; eigentlich selbst dann, wenn wir verprügelt oder entehrt würden. Aber ich half ihm nicht, konnte es nicht! Ich hockte im Morast und wartete starr darauf, bis ich sicher war, dass er tot war. Daraufhin versuchte ich, vorsichtig aufzustehen, ohne meinen Blick vom toten Soldaten wenden zu können. In meinem Unterleib brannte es wie Feuer, ohne dass ich darauf reagierte. Zu groß war die Verwirrung über das Geschehen, die Gewalt und die Angst, dass noch ein Soldat auftauchen würde.
Als ich es endlich nach einiger Anstrengung schaffte, mich zu erheben und die Ameisen das Blut des Soldaten von meinem Gesicht gewischt hatten, hörte ich die Stimmen weiterer Männer. Die Kraft kehrte mit einem surrenden Gefühl in meine Beine zurück; ich wollte in Panik wegrennen, irgendwo hin, einfach weg von hier.
Da packte mich eine kräftige Hand am Schopf, sodass ich laut aufkreischte und endlich ungehemmt schreien konnte. „Hier geblieben Kleine!“, donnerte eine harte, befehlsgewohnte Männerstimme von hinten, woraufhin ich mitten in der Bewegung erstarrte.
In diesem Moment vergaß ich, weiter um Hilfe zu schreien.
Der Soldat drehte mich grob um und studierte mein blutverschmiertes Gesicht, blickte hin und wieder zum toten Soldaten am Boden. „Mmmhh“, brummte er mit verdrießlicher Miene. Er blickte auch zu den anderen toten Kindern, und seine Stirn wurde daraufhin von tiefen Furchen durchzogen.
„War er das?“, fragte er in die Richtung der leblosen Körper. Als ich nicht antwortete, nur gebannt in sein kantiges Gesicht starrte, drehte er seinen Kopf zu mir und guckte mich prüfend an. Sein Griff lockerte sich leicht; der stechende Schmerz, der dadurch erzeugt wurde, ließ nach.
Derweil traten weitere Soldaten zu ihm, die mich eingehend musterten, nachdem sie entdeckten, was ich mit ihrem colega de puta getan hatte, beziehungsweise er sich selbst angetan hatte.
„Wir nehmen sie mit!“, befahl der Mann, der mich am Schopf festhielt.
„Zu Befehl, General Morillias!“
„Und das ihr nichts geschieht, klar!“, der General drehte sich auf dem knackenden Ästen zu seinen Männern um und blickte sie streng einer nach dem anderen an: „Ihr haftet persönlich für ihre Sicherheit, verstanden!“
„Ja, General, wir haben verstanden!“, klang es synchron in die Nacht hinein, die lediglich vom Knistern des nahen Feuers gestört wurde.
All die Tiere, die sonst um diese Jahreszeit hierher kamen, schienen vom Erdboden verschluckt. Die vorangegangenen Schießereien und das schreckliche Feuer hatten sie vertrieben.
„Mit eurem Kopf!“, fügte der General kalt und emotionslos hinzu und brach diese eigenartige Atmosphäre für einen Moment.
Als ich trotz der oberflächlichen Gewissheit, diese Nacht unbeschadet zu überleben, laut heulte, streckte mich einer der Soldaten kurzerhand mit dem Gewehrkolben nieder. Ich hörte noch das hohle Klacken des wuchtigen Aufschlages, ehe ich in einer wirren Welt versank, in der ich schon zuvor gewesen war. Hernach luden mich die Soldaten auf einen Militärjeep und brachten mich in ein höher gelegenes Kloster, welches schon seit Jahrhunderten friedlich da oben existierte.
Die Iglesia del Cielo, welche anno 1534 von Felipè Melidas gegründet wurde, thronte an der oberen Grenze des Floresta Negra; mehr als tausenddreihundert Meter höher, als Nuevo Alumbrado und mindestens siebzig Kilometer weiter nördlich. Sie befand sich mitten in den Anden, weit südwestlich von den Grenzen zu Panama, gut versteckt auf einem Hochplateau zwischen zerklüfteten Steilhängen und hohen Nadelhölzern. Ich wusste es, weil ich einmal mit meinen Eltern hier gewesen war und wir mehrere Nächte hier oben verbringen durften.
Die etwas mehr als vierzig Klosterfrauen lebten von allem zurückgezogen, bevor Morillias Truppen auftauchten. Sie existierten ganz bescheiden, ohne die übrige Welt für ihre Errungenschaften zu beneiden. Ihre Töpfe, Krüge, Betten, einfach alles stammte noch aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, und sie dankten jeden Tag Gott dafür. Sie bewirtschafteten Gärten, die genügend Knollengewächse, Gemüse und Früchte hergaben, damit sich der Orden davon ernähren konnte. Ganz nach den Grundsätzen, welche einst vom großen Konquistador Melidas erdacht wurden. Zumindest taten sie das, bevor die Soldaten vom General den Befehl erhielten, hier einzukehren.
Das Militär brachte zahlreiche Geschütze, Gewehre und dutzende Kisten Munition hierher und verwandelte das alte Kloster in eine kaum einzunehmende Festung.
„Die Brigado Libertad de Credibilidad, die noch ein entscheidendes Kapitel in Kolumbiens Geschichte einnehmen könnte; für die zahlreichen Rebellen und noch zahlreicheren paramilitärischen Milizen nur schwer anzugreifen und für die kommende Zeit des Blutes mehr als nur angemessen ist!“, so der General bei einer seiner leidenschaftlichen Reden in Santafè Bogotha vor den sogenannten Cámara de representante, fünf Tage, bevor der Bürgerkrieg die Freiheit der Menschen dieses wunderbaren Landes in Asche verwandelte.
Ich erwachte in einem kleinen Zimmer. Das Erste, was ich erblickte, war eine ältere Nonne, die an meinem Bett saß und mir meine Stirn mit einem feuchten Tuch abtupfte. Sie erweckte in mir den Eindruck, als wäre sie die ehrwürdige Mutter persönlich. Ihr Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen, ihre dunklen Augen blickten ernst. Heute würde ich sagen, die Ordensschwester umgab eine Aura der Reinheit, als hätte Gott selbst seine schützende Hand über sie gelegt. Als sie bemerkte, dass ich wieder unter den Lebenden weilte, erhob sie sich leise und verließ, ohne ein Wort an mich zu richten, mit lautlosen Schritten das Zimmer.
Ich vermochte es nicht, ihr mit meinen Augen zu folgen. Meine ganze linke Schädelseite brannte, wie ein eben entfachtes Feuer. Es pochte schmerzlich; ich wusste nicht, warum! Dennoch versuchte ich, mich zu erheben, als ich hörte, wie die Tür verriegelt wurde. Aber die Kraft reichte dafür nicht aus, ich sank nach einigen vergeblichen Versuchen zurück ins weiche Bett.
Draußen zwitscherten Vögel, in weiter Ferne meinte ich, einen Affen brüllen zu hören oder vielleicht doch eher einen Puma, oder beides? Ich konnte es nicht mit Sicherheit sagen, war verwirrt und erschöpft. Ich schloss meine brennenden Augen und lauschte den vertrauten Klängen der Natur und döste weg. Verwickelte mich in einen absurden Traum, in dem sich meine Eltern wie lebendige Fackeln auf dem Boden gehetzt und schreiend hin und her wälzten. Ebenso mein Onkel und meine Tante und alle anderen aus Nuevo Alumbrado. Ich roch das verbrannte Fleisch, das nach Metall schmeckende Blut; stand mit meinem weißen Hut mit der rosa Schleife in den Händen haltend da, ohne etwas tun zu können, außer zu schreien: Es war das Einzige, was ich wirklich machen konnte! Plötzlich wurde ich von einem kräftigen Arm niedergedrückt, mit dem Kopf in die feuchte Erde, sodass mir die Luft wegblieb. Ich hörte, wie er mit den Händen die Unterwäsche zerriss, worauf ich einen heftigen Stich zwischen meinen Schenkeln verspürte. Es brannte, als würde Feuer in mich eindringen.
Es musste bereits Mittag sein, als die Tür hektisch aufgeschlossen und danach grob aufgestoßen wurde. General Morillias und die Nonne betraten zusammen mit einem Arzt das Zimmer. Ich vernahm in meinem weichenden Dämmerzustand die leicht hallenden Schritte, raschelnde Kleider und probierte, mich sogleich mühsam im Bett aufzurichten. Das Tageslicht stach in meinen Augen. Ich blinzelte mehrmals, ohne den gewünschten Erfolg zu erzielen, stattdessen füllten sich meine Augen mit Tränenwasser. Trotz des Gefühls, ausgeruht zu sein, schaffte ich es nicht, mich ganz aufzurichten. Ich sackte keuchend vor Anstrengung zurück ins Kissen. Mein Kopf pochte, als sei er eben gerade geplatzt, und weil das alles zu viel für mich war, schluchzte ich still. Die warmen Tränen rollten über meine Wangen, als sich der Arzt über mich beugte und eindringlich begutachtete. Und ich weiß nicht, warum, aber mit den hektischen Gestiken des Arztes kehrten auch die Erinnerungen an die Geschehnisse, die mir die üble Wunde am Schädel zugefügt hatten, zurück.
Der Arzt hielt mir ein Licht in die Augen, dass es bis in mein Gehirn stach. So schwoll mein erst leises Weinen rasch zu einem lauten Heulen an; die Furcht vor weiteren Misshandlungen gewann rasch an Kraft in mir. Der Arzt schob mein Haar beiseite und entdeckte das unförmige Feuermahl an meinem linken Ohr.
„Oh, eine Gezeichnete!“, meinte er daraufhin nur abschätzig und machte mit seiner Arbeit weiter. Nach einigen Minuten richtete sich der Arzt auf und drehte sich zum General um – ein hoch gewachsener Mann mit stechenden Augen, die in einer prägnant hohen Stirn eingelassen waren.
Die dunklen Augen ruhten auf mir, als sich seine schmalen, fast femininen Lippen plötzlich bewegten. Er bat mich höflich, aufzuhören zu weinen, zwinkerte mir gar zu.
Aus einer mir unergründlichen Tatsache heraus, hörte ich prompt auf und glotzte ihn mit geschwollenen Augen an. Wahrscheinlich lag es an seiner tiefen Stimme, die mir irgendwie Wärme und Sicherheit vermittelte, oder dem Zwinkern, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung!
„Sie wird wieder!“, diagnostizierte der Arzt abwesend, während er in seiner mitgebrachten Tasche nach einer Arznei kramte. „Dreimal am Tag, zwei von diesen hier“, und streckte der alten Ordensschwester dabei einen Beutel mit Tabletten hin.
Anfangs starrte sie nur drauf, ohne Anstalten zu machen, ihn an sich nehmen zu wollen.
„Nehmen Sie schon, Schwester Lucia, es ist in Gottes Interesse!“, er blickte rasch nach oben, als würde es etwas ändern.
Zögerlich nahm Lucia den Beutel an sich. Sie schielte kurz zum General und hernach zu mir herüber, ehe sie wieder den Arzt anschaute. „Gracias“, entgegnete sie kaum hörbar und nickte ihm zu, dass sie verstanden habe.
Der Arzt drehte sich nun zum General und erklärte trocken: „Eine Woche, dann ist sie wieder auf den Beinen, General Morillias, ich verspreche es Ihnen. Vielleicht wird sie noch Kopfschmerzen haben, aber auch das wird mit der Zeit verschwinden. Das kommt von der Gehirnerschütterung, die sie erlitten hat.“ Danach wandte er sich wieder an Schwester Lucia und meinte spöttisch, „und sonst werden Sie es schon mit Ihren Gebeten richten, verehrte Schwester!“, grinste selbstgefällig und winkte ab, „oder wird sich die alte Maselda um die Kleine kümmern?“
„Mmmhh … bueno, bueno, das höre ich gerne“, nickte Morillias indessen mit erhellter Miene der Nonne zu, die sich sogleich mir zuwandte, ohne dem Doktor eine Antwort zu geben.
Der General blickte sie eine Weile eingehend an und antwortete für sie: „Sie konnte noch nie jemandem etwas zu leide tun – darum beschränkt sie sich wohl auch darauf, allen zu helfen – bis zu ihrem Tod! Und Maselda …“, er schüttelte angewidert den Kopf, als würde ihn schon der bloße Gedanke an sie abstoßen, „ja, die hat der nackten Wahrheit bereits ins Antlitz geblickt! Nicht wahr, Schwester Lucia? Unsere reizende Maselda weiß, dass es nicht nur Gottes Kinder auf dieser Erde gibt!“
Als die Nonne auch dieses Mal nicht antwortete, schmunzelte der General zufrieden und klopfte dem Doktor kumpelhaft auf die Schultern. Daraufhin verließen sie zusammen das Zimmer, ohne weiter auf die Schwester oder mich zu achten.
Obschon ich wieder weinte und mich im Kissen versteckte, hörte ich, wie sie beim Weggehen von der gestrigen Nacht sprachen. Ich erinnere mich noch, als wäre es eben gewesen. Erinnere mich an das Kissen, ja, dieses wunderbare Kissen, welches nach frischer Seife roch, die mir erst auffiel, als ich den Kopf darin eingrub. Ich atmete einige Male tief ein, während ich meine Augen geschlossen hielt; einen einzigen Augenblick war ich wieder zu Hause in Nuevo Alumbrado, zu Hause in der Hacienda meiner Eltern, in meinem Zimmer.
Als mich im nächsten Moment eine kalte Hand berührte, platzte die Illusion. Ich öffnete meine Augenlider, so gut ich es vermochte und blickte in das Gesicht der Schwester. Es verschwamm langsam, ich weinte erneut.
„Es wird alles gut, Kind! Gott lässt nichts geschehen, was nicht für einen vorgesehen ist!“, ein trauriges Lächeln umspielte ihre ausgetrockneten Lippen, während sie mir sorgfältig die Tränen mit einem weißen Tuch wegwischte. „Glaube mir ruhig, Kind, ich weiß es genau!“, sie drehte sich um und nahm den Beutel mit den Tabletten.
„Die brauchst du nicht, Kleines. Sie sollen nur dafür sorgen, dass dein Wille gebrochen wird!“, mit diesen Worten ließ sie den Beutel in ihrer passend dazu raschelnden schwarzen Kutte verschwinden. Das Lächeln, welches sie mir nun schenkte, wo sie sanft mit ihrer linken Hand über meine Stirn streichelte, besaß eine unfassliche Barmherzigkeit.
Ich hörte auf, zu heulen und zu schluchzen. Ich fühlte mich plötzlich geborgen und brachte erstmals seit gestern ein schüchternes Lächeln zustande. Ihre starke Präsenz lullte mich angenehm ein; ich ließ es geschehen.
„Ich werde dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Du darfst dir keine Sorgen machen, alles ist in Ordnung! Du musst nicht auf die Worte des Doktors hören oder gar die von General Morillias! Sie versuchen nur, deinen Verstand zu trüben, deinen Geist zu vergiften und deine Seele zu schänden!“, Schwester Lucia streichelte mich erneut mit sanften Berührungen; ein Lächeln stahl sich in ihr faltiges Gesicht. Ihre Augen strahlten eine Gutmütigkeit aus, die sich tief in mich hineinbrannte.
„Ich werde auf dich aufpassen, Kind, ich verspreche es dir im Beisein unseres geliebten Herrn!“, und als wären diese Worte das Zeichen gewesen, stach es heftig in meinem Unterleib, als wäre er vom Blitz getroffen worden. Ich krümmte mich stöhnend und nach Luft schnappend im Bett zusammen.
Schwester Lucia fragte besorgt, was los wäre, als ich ihr nicht sofort antwortete, mich stattdessen nur vor Schmerzen zusammenzog, riss sie unsanft die Decke von meinem Körper. Zwischen meinen Oberschenkeln war alles voller Blut!
Der Schmerz zwischen meinen Beinen klang langsam ab. Lucia setzte sich am nächsten Morgen zu mir ans Bett und erklärte mir behutsam, dass Mädchen ab einem gewissen Alter dort unten bluten und sie das die Menstruation nennen würden. Alles wäre völlig in Ordnung mit mir. Sie erläuterte es mir mit einer Selbstverständlichkeit, wie ich sie zuvor nicht kannte.
„Keine Sorge, du wirst dich mit der Zeit daran gewöhnen!“, erklärte sie mir einfühlend und strich mit ihren schwieligen Fingern durch mein langes Haar. „Bei vielen Frauen lässt der Schmerz mit den Jahren nach, du wirst sehen!“
Ich starrte währenddessen gedankenverloren auf ein seltsames Bild, welches mit der hinteren Wand zu verschmelzen schien.
Lucia folgte meinem Blick und räusperte sich. „Das ist ein Fresko. Ein Bild, das direkt auf den frischen Verputz aufgetragen wird, auf die Mauer sozusagen. Es zeigt den Erbauer dieses Klosters, den spanischen Konquistador Felipè Melidas, der anno 1511 mit acht weiteren Schiffen an der heutigen Küste Venezuelas strandete und danach brandschatzend durch das Land bis hierher zog …, mmmhh, bis er schließlich verschwand! Niemand hat ihn je wieder gesehen!“, sie verwarf die Arme.
„Ich verstehe!“, erwiderte ich tonlos. Meine Gedanken kreisten plötzlich um den seltsam gekleideten alten Mann, der mir im Gebüsch begegnet war. Er wurde bestimmt auch umgebracht, so wie Chevaron und all die anderen. Ich fragte mich, ob sie wohl im Himmel waren und auf mich heruntersahen. Vielleicht beschützen sie mich ja, und alles wird gut! So, wie Schwester Lucia sagt!
Die Schwester zog ihre Stirn kraus und nickte ebenso, während sie mich aus den Augenwinkeln beobachtete. „Ich denke, es geht in Ordnung, wenn du dich noch ein Weilchen ausruhst, Liebes!“, sie strich mir über die Wange und lächelte, „damit du wieder zu Kräften kommst!“ Sie stand auf und verließ das Zimmer.
Ab dem vierten Tag musste ich Schwester Lucia helfen, die Leintücher von den mehr als hundert Betten abzuziehen, anschließend zu waschen und nach dem Trocknen wieder auf die Matratzen zu spannen. Die Latrinen auf allen Stockwerken der provisorischen Festung zu säubern und für die Soldaten zu kochen. Und wenn Sie bei „provisorisch“ denken, es handle sich um einige Stützwerke und Verstrebungen, dann irren Sie sich gewaltig! Überall türmten Soldaten, die Atemmasken trugen, Säcke voller Sand vor den Ausgängen. Schafften so eine Art Schutzwall, hinter dem sie sich verstecken konnten, wenn es zum Angriff kommen sollte. Viele der oberen Öffnungen schützten sie auf ähnliche Weise, mit dem Unterschied, dass sie nach einigen Abständen ein großes Maschinengewehr dazwischen aufstellten. Morgens früh bis spät abends wurden Befehle durch die Gänge gebrüllt. Soldaten hasteten umher wie aufgescheuchte Ameisen. Andauernd kamen hupende Lastwagen an und brachten allerlei Verbrauchsmaterial sowie einen gewaltigen Nachschub an Säcken. Auch hier trugen die Soldaten alle Atemmasken. Eigentlich waren nur die verbliebenen Schwestern und ich in den Untergeschossen ohne Gesichtsschutz unterwegs.
Auf dem Ostturm wurde seit einem Tag eine Funkanlage installiert. Überall hingen Kabel herum, über die jeder immer mal wieder fluchend stolperte. An manchen Stellen schlugen die Soldaten die Mauern ein und trugen die Steine andernorts wieder auf – alles nur, damit sie sich möglichst lange darin verschanzen konnten!
Am Ende des Tages verzog ich mich erschöpft in mein Zimmer, um mich zu waschen. Ich wollte gerade ein frisches Handtuch aus dem Schrank nehmen und öffnete ihn ahnungslos:
Drinnen hockte Maselda, eine der alten Ordensschwestern des Klosters, ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Ihre weißgrauen Haare waren verfilzt und stanken nach Rauch. Auf ihrer knolligen Nase bildete sich ein fetter Pickel, fast so groß wie ein Fingernagel. In ihrer Rechten schwenkte sie ungehalten eine halbvolle Schnapsflasche, während sie im Flüsterton mit sich selbst debattierte.
Ich starrte sie erschrocken an, ohne eine weitere Bewegung machen zu können. Nicht einmal atmen konnte ich. Der scharfe Geruch des Schnapses und ein Gestank, den ich Jahre später als französischen Weichkäse identifizierte, brannten zusammen mit dem abgestandenen Rauch in meiner Lunge, sodass ich nach einigen Sekunden widerwillig husten musste.
Darauf blinzelte sie zu mir hoch und meinte nur trocken: „Willst auch einen Schluck?“, sie hielt mir die Flasche hin, „betäubt garantiert die Sinne und Schmerzen in dir!“, dabei schlug sie sich mit der anderen Hand mit geräuschvoller Gebärde an die Brust und nickte überzeugt. „Ich weiß das … ja, ich weiß das!“
Ich stand nur da, schüttelte verwirrt und eingeschüchtert meinen Kopf, während ich versuchte, nicht zu atmen.
Sie musterte mich kurz und nickte erneut. „Gut, dann mach bitte die Schranktüre wieder zu, Kind Gottes, und vergiss, dass ich hier bin!“, strenger fügte sie hinzu: „Entiende bonita!“ Sie blickte mich verächtlich an.
Ich murmelte etwas Unverständliches und schloss die Schranktür.