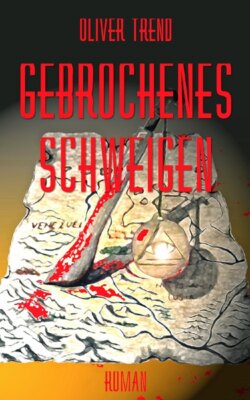Читать книгу Gebrochenes Schweigen - Oliver Trend - Страница 7
3
ОглавлениеIglesia del Cielo, Kolumbien. Am fünften Tag weckten mich zwei junge Soldaten in der Früh und brachten mich in einen Raum oben im Ostturm, in dem General Morillias mit ernster Miene auf mich wartete. Er saß hinter einem großen Holztisch, rauchte eine dicke Zigarre und blies genüsslich den würzigen Rauch aus.
Ich betrat müde und mit einem unbeschreiblich flauen Gefühl den Raum und wurde von den Soldaten auf den Stuhl dem General gegenüber platziert. Über ihm hing ein Bild von Präsident Pèrez. Mein Herz raste. Onkel Salvatore erzählte mir oft von den Methoden der staatlichen Truppen, wie sie Menschen, Frauen und Kinder wie mich, zum Reden brachten.
Aber ich war tapfer und betete zu Gott, dass er mir die Kraft geben mochte, die ich brauchte, um alles hier zu überleben. Es war ein Gebet, welches mir Schwester Lucia vor zwei Tagen beigebracht hatte. Schließlich geschah einem nichts im Leben, was nicht von Gott gut geheißen wurde. So glaubte ich es damals aus ganzem Herzen.
Währenddessen wurde die Tür hinter mir von den beiden Soldaten geschlossen, ich hörte, wie sie davor Stellung bezogen.
Der General durchbohrte mich mit seinen stechenden Augen. „Wie heißt du, bonita?“
Ich wusste, wenn ich leben wollte, durfte ich ihm nicht sagen, wer ich war – dass Salvatore de la Sourca mein Onkel war, den er vor fünf Nächten brutal ermorden ließ – ihn, wie das ganze Dorf!
„Willst du es mir nicht verraten?“, fuhr er fort, ohne seine Stimmlage zu ändern. Er machte auf mich einen gütigen Eindruck. zumindest im Augenblick, was, wenn ich im Nachhinein so bedenke, sehr widersprüchlich war! Er sog abermals genüsslich an seiner Zigarre und blies den Rauch aus.
„Meinen Namen kennst du bestimmt!“, er beugte sich ein wenig zu mir nach vorne, sodass der Stuhl unter seinem Gewicht ächzte und lächelte: „Nun möchtest du bestimmt wissen, wie es dazu kommt, dass ich mich in einem Kloster aufhalte, nicht?“, er blinzelte mir dabei zu und wartete auf meine Antwort.
Ich nickte verlegen, während sein Lächeln breiter wurde.
„Gut, dann will ich dir eine Geschichte erzählen, meine, wenn du so willst“, er kaute auf der Zigarre herum und schien einen Moment zu überlegen, ehe er sie behutsam in den Aschenbecher auf dem Tisch legte und sich wieder zurücklehnte. Nachdem er den grauen Rauch aus seinem Mund gepustet hatte und gerade beginnen wollte, klopfte es hohl an der Tür.
Morillias hielt augenblicklich inne und schaute zur Tür. „Si, entre!“, meinte er darauf deutlich strenger, und einer der Soldaten trat ein, der vor der Tür Wache hielt.
Er marschierte großen Schrittes zum General hinter dem Tisch und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Dieser nickte nachdenklich.
Da hörten wir, wie plötzlich ein Flugzeug über die Festung hinweg flog.
„Coño!“, fluchte der General gefährlich leise, schnappte mit einer schnellen Bewegung nach seiner glimmenden Zigarre. „Joder, la puta mierda … diese verfluchten Hunde!“, schoss aus seinem Stuhl hoch und verließ eilends mit dem Soldaten den Raum, ohne weiter auf mich zu achten.
Sekunden später hockte ich alleine drin, angespannt lauschend, wie unzählige Kampfstiefel auf die Dielenbretter und Steinplatten trafen. Ein matt hallendes Geräusch machte sich im Turm breit. Ich war vor Angst erstarrt. Erst viele Minuten später, als eine Ratte, so groß wie mein Unterarm, links von mir auf dem Boden entlanghuschte, konnte ich mich wieder bewegen. Ich stand mit einem Ruck auf und rannte kreischend aus dem Raum, mit der keimenden Furcht in mir, dass ich nicht mehr lange lebte. Tränen rollten mir von den Wangen, während ich zur Wendeltreppe hastete.
Abermals dröhnten die Propeller des Flugzeuges über mir, ich vernahm Gewehrsalven, und eine Heidenangst erfasste mich. Ich stürzte in meiner Panik und schlug mir die Knie auf dem kalten Steinplattenboden auf.
„Alle Soldaten an die Waffen, wir werden angegriffen!“, lärmte des Generals tiefe Stimme durch die an den Wänden angebrachten Lautsprecher.
Darauf erschallte ein unerträgliches Heulen, wahrscheinlich eine Art Alarm.
Ich kreischte aus voller Kehle heraus, aus Verzweiflung, aus Wut, ich weiß es nicht mehr! Es half mir aber, wieder aufzustehen und weiter zur Wendeltreppe zu hasten. „Ich will hier raus!“, schrie ich mit meiner hohen Mädchenstimme, die im Lärm der Waffen und gebrüllten Befehlen unterging, „ich will hier weg!“
Als ich die aus Stein gefertigte Wendeltreppe hinter mir gelassen hatte und das große Gewölbe im Obergeschoss erreichte, atmete ich kurz auf. Meine Knie brannten, beinahe so fest wie meine Oberschenkel, mein Schädel pochte genauso wie, als ich das erste Mal hier erwachte. Ich begutachtete heulend meine leicht blutverschmierten Knie, strich zitternd über die Schürfungen und schniefte wieder, „ich will hier raus!“, als ich meinte, ein Fahrzeug draußen zu hören.
Ich stolperte in ein Nebenzimmer gegenüber der Treppe, deren Wand herausgeschlagen war. Als ich bei der Öffnung angelangt war, die mit Sandsäcken geschützt war, spähte ich vorsichtig hindurch. Ich schaute ins weite, grüne Tal hinunter, ohne aber etwas zu entdecken, was wie ein Fahrzeug aussah, nur die leere Straße. Unten über dem Tor, wo noch vor Kurzem die Soldaten Säcke auftürmten, lag ein weißer Schleier über der Erde. Es schmeckte bitter, mein Rachen fühlte sich kurz darauf eigenartig betäubt an. Ein toter Soldat hing einen Stock tiefer über einem zerfetzen Sack, der ein weißes Pulver beinhaltete, welches sich langsam mit tiefrotem Blut vollsog. Wieder Schüsse, doch dieses Mal irgendwo weiter weg. Trotzdem schreckte ich schnell hinter die schützende Mauer zurück. Dann sehr laute Schüsse, ganz nahe. Sie kamen von hinten, direkt hinter mir!
Ich drehte mich hastig um, stolperte beinahe über meine eigenen Füße und starrte mit weit aufgerissenen Augen in die eines sehr vertrauten Mannes aus Salvatores Privatarmee. Ich erkannte ihn, weil er, seit ich denken konnte, meinen Onkel herumchauffierte und stets freundlich zu mir war: Horatio! Sein Oberkörper war blutgetränkt, während er kraftlos und mit ausgebreiteten Armen auf mich zu taumelte.
Ich weinte und schrie, als sich blitzschnell eine unterarmlange Klinge um seinen Hals legte.
Er strauchelte und hielt mitten in seiner Bewegung inne und glotzte mich, den nahenden Tod in seinen verklärten Augen, unverhohlen an. „Corre, bonita, lauf!“, dann verwandelte sich sein zittriger Flüsterton in ein hilfloses, abgehacktes Gurgeln.
Der Mann hinter ihm zog mit einem kräftigen Ruck die schmutzbefleckte Klinge bis zur Spitze durch das Fleisch, ohne dass ich ihn dabei erkennen konnte. Doch es reichte mehr als deutlich aus, dass ich mein Leben lang davon träumte, mich diese Bilder jagten, ja gar bis in den Tod hinein verfolgen! Es ließ mich damals auch aus der Starre erwachen, und ich rannte los. Vorbei an dem zusammensackenden Chauffeur meines Onkels, Vater von drei Kindern, zuletzt Kämpfer für die Freiheit Kolumbiens.
Carlos Horatio Carreras stürzte hinter mir vergebens nach Luft schnappend zu Boden, während ich dazwischen ein kaum wahrzunehmendes Klacken vernahm. Ich hetzte mit großen Schritten laut schnaubend, auf die Treppe zu, dann nahm ich einen Satz, noch einen und danach noch einen. Gerade als ich die Treppe erreichte und die Steinstufen hinunterhastete, explodierte Horatio samt seinem namenlosen Mörder hinter sich. Staub stob wie ein Sandsturm durch die Gänge und rieselte hernach kraftlos zu Boden.
Ich rannte geduckt und nach Luft schnappend, hinunter ins nächste Stockwerk. Mir war übel; ich dachte jeden Augenblick, mich übergeben zu müssen. Meine Brust hatte sich schmerzhaft zusammengezogen, ich bekam kaum Luft. Als ich ein Geschoss tiefer angekommen war, blieb ich auf der Treppe stehen. Niemand folgte mir, so glaubte ich. Einige Sekunden lang wurde mir schwarz vor Augen; ich fiel beinahe vornüber, konnte mich aber im letzten Moment fangen. Durch einen Schleier nahm ich umgestürzte Tische und Stühle wahr. Säcke, die ungeordnet im Raum verteilt lagen. Ich hielt mich an der kalten Steinwand fest, während sich mein Blick langsam klärte. Überall donnerten schallende Schüsse durch die Luft, begleitet von schauderhaften Schreien und lauten Jubelrufen zugleich!
Da drangen mehrere Soldaten aus einem angrenzenden Zimmer gegenüber der Treppe, auf der ich stand, in den Saal herein. Sie riefen sich gegenseitig immer wieder zu, sich zu ergeben – beide Fraktionen ernteten von der anderen dafür höhnisches Gelächter. Darauf klickte es mehrfach, eine Sekunde später lösten sich auf beiden Seiten hallende Schüsse.
Ich konnte mich nicht von der Stelle bewegen, meine Beine wollten nicht, egal, wie sehr und vor allem wie laut ich sie in Gedanken anflehte. Sie zitterten nur heftig, ohne dass ich es schaffte, sie zu bewegen. Bilder von Horatio blitzten in meinem Kopf auf, wie er mich mit aufgeschnittener Kehle aufforderte, zu rennen, ehe er explodierte! Renn!, befahl mir mein ganzes Inneres panisch. Doch ich starrte nur furchterfüllt zu den aufeinander schießenden Soldaten im Saal vor mir und urinierte vor Angst in mein Höschen.
Die drei Männer vor mir hatten sich inzwischen auf den Boden geworfen und robbten hinter die Tische, Stühle und Säcke. Dabei schossen sie auf die anderen, die sich hinter dem Türrahmen zum nächsten Zimmer verschanzten, ohne sich anfangs zu treffen. Weißer Staub wurde durch die Luft geschleudert und brachte die Soldaten zum Keuchen und Fluchen, während sie schwitzten wie Schweine. Sie nahmen keine Notiz von mir, während sie sich gegenseitig umbrachten.
Meine Zähne surrten, als wären sie betäubt, ebenso fühlte sich auch meine Mundhöhle samt Rachen an. Das Atmen ging jetzt wieder, doch das Gefühl war seltsam, kribbelnd irgendwie!
Während sich die Soldaten beschossen, flog das Flugzeug erneut über uns weg, worauf überall Kugeln in die Wände krachten und sie durchbrachen wie dünnes Holz. Es zischte, donnerte und grollte, dazwischen immer wieder ratternde Gewehrsalven. Steinsplitter wurden durch den Saal geschleudert, Befehle und Drohungen wurden geschrien, die ich nicht mehr zuordnen konnte.
Einer der Soldaten direkt vor mir war aufgesprungen, vollzog einen ruckartigen Satz nach vorne, während er von Dutzenden Kugeln durchsiebt wurde. Seinem Kameraden erging es gleich.
Der Letzte der Dreiergruppe sprang jetzt ebenfalls hinter der behelfsmäßigen Deckung hervor, etwa zwei Meter vor mir und fing einige Kugeln ab, die mich sonst wahrscheinlich getroffen hätten. Er stöhnte laut, ging aber nicht in die Knie, er taumelte lediglich kurz. Darauf hob er zitternd sein Gewehr durch den Nebelschleier und drückte ab. Heute kann ich mit Sicherheit sagen, dass er damals unwissend mein Schutzengel war, denn in jenem Moment spürte ich eine kräftige Hand auf meiner rechten Schulter, die mich aus der Starre erlöste.
Ich ließ mich fallen, rollte unbeholfen, aber schnell auf die Seite, kam irgendwie wieder auf die Beine und sauste los. Vorbei an meinem fallenden Schutzengel und den vier Soldaten, die ihre Gewehre noch immer auf den Fallenden richteten.
Ich stürmte in das Zimmer, aus dem zuvor die Soldaten kamen, ohne mich umzudrehen, dann war Endstation! Im Saal vorne wurde wieder geschossen und geflucht, ohne dass sie auf mich reagierten. Da glaubte ich, in dem heillosen Durcheinander abermals ein Fahrzeug zu hören und hastete zu einem der Fenster.
Diese waren ebenfalls mit Säcken ausgefüllt. Über einem lag der Soldat, den ich vorhin von oben gesehen hatte, besser gesagt, was von ihm übrig geblieben war! Seine Beine waren ihm abgerissen worden; ich konnte deutlich die glitzernden Innereien in seinem aufgeplatzten Unterleib erkennen.
Nach einiger Überwindung brachte ich es fertig, an einem der Fenster daneben hinaus zu spähen. Nichts! Doch plötzlich brauste ein khakibrauner Jeep hupend die matschige Straße hinauf. Ich beobachtete ihn eine kurze Weile, registrierte einen Mann mit weißem Hut, weißem Hemd, der bequem auf der Beifahrerseite saß. Und, als hätte mir mein geliebter Gott ein dunkles Tuch von den Augen gezogen, erkannte ich, wer es war.
Heilige Maria, er lebt!
Da donnerte das Flugzeug erneut nahe am Kloster vorbei, während dutzende Kugeln in die Wand hinter mir einschlugen und sie wegfetzten. Ich warf mich laut brüllend auf den Steinplattenboden und bedeckte mit meinen Armen meinen Kopf. Über mir schossen unzählige Felsbrocken durch die Luft. Es zischte bedrohlich, gepaart mit einem schrillen, unstetigen Pfeifen. Einer der Stützpfeiler stürzte laut krachend in sich zusammen.
Ich befürchtete in meiner Angst und dem unsagbaren Getöse, das ganze Gewölbe über mir stürze gleich ein. Sand von geplatzten Säcken wurde durch das Gewölbe geschleudert, sodass ich lauthals brüllte. Die Sandkörner stachen und piesackten mich überall, wo ich nackte Haut entblößte. Nach mehreren Sekunden prasselte der Sand an die Wände. Das Zimmer und der davor liegende Saal waren jetzt nicht mehr getrennt. Dort, wo eben noch ein Gefecht stattfand, lagen jetzt nur noch Tote!
In meiner Panik wollte ich zur nahen Treppe zurückkriechen, die weiter nach unten führte. Dahin, wo sich hoffentlich Lucia und ihre verbliebenen Schwestern aufhielten. Meine Knie schmerzten vom vorangegangenen Sturz, bei jeder Bewegung auf dem knirschenden Sand, die ich tat. Ich drückte mich weinend an den blutüberströmten Soldaten vorbei, ohne sie anzusehen. Es rieselte jetzt eine Unmenge Staub auf mich hernieder. Dazwischen einzelne Mauerstücke, von denen manche die Größe einer Faust wie meine hatten. Als ich endlich nahe genug an der Treppe war, sprang ich auf und rannte. Meine Knie wollten nicht, doch meine Angst – die Angst, hier drin begraben zu werden – war in jenem Moment eindeutig stärker.
Wieder donnerten Gewehrsalven ins Gewölbe; ich fühlte, wie etwas Schreckliches passieren würde. Aus mehreren Richtungen hallten ratternde Maschinengewehrsalven an meine Ohren. Die Schwestern! Dachte ich panisch und hastete die Treppe hinab. Von unten her drangen laute Gewehrschüsse zu mir hoch, verzweifelte Schreie und wieder Schüsse, als Lucia und Schwester Maselda die Treppe hinaufhetzten.
Lucia bedeutete mir in Panik, ich solle still sein. Ihre Augen, die aus einem schmutzigen Gesicht starrten, entblößten mir dabei das nackte Grauen.
Ich nickte verstört, während ich mich eilig umdrehte, um mit ihnen wieder nach oben zu flüchten.
Wieder hallende Schüsse im Untergeschoss, dieses Mal ohne Schreie; wir wussten, die da unten, wer auch immer die armen Teufel waren, hatten das Leben hinter sich gebracht!
Ich wimmerte, ohne es zu wollen, in mich hinein, konnte einfach nicht damit aufhören. Wollte, dass es wieder so wurde, wie es vor meinem schrecklichen neunten Geburtstag war! Wir hörten, wie Soldatenstiefel über und unter uns über die steinigen Böden stapften.
Plötzlich blieb Lucia auf dem zwischendurch bebenden Treppenlauf stehen. Sie packte mich am Schopf. „Hier rein!“, schnaubte sie außer Atem. Ihre Augen blitzten dabei unheilvoll auf, ich ahnte, dass sie keinen Widerspruch duldete.
Staub und feine Gesteinsbrocken, die sich unentwegt von der Decke lösten, rieselten auf uns hernieder.
Maselda drückte schwer atmend einen bestimmten Stein an der linken Wand, der sichtlich keine besonderen Merkmale aufwies, in das Mauerwerk hinein. Der Stein glitt mühelos und mit einem leisen Kratzen zurück.
Beinahe im selben Moment öffnete sich gegenüber eine Luke, Lucia drückte sich schnell durch, dann ich und zuletzt Maselda. Ehe die Soldaten die Stelle auf der Treppe erreichten, schloss sich die Luke, als hätte es sie nie gegeben. Da erzitterte die ganze Festung in ihren Grundmauern, gefolgt von einem mächtigen Krachen und nachfolgenden Grollen, als würden die Anden selbst erwachen. Wir krochen indessen durch einen engen schachtähnlichen Gang, der uns nach oben zu führen schien, als die Decke über uns einzustürzen drohte.
„Bastardos, no me gusta nada!“, schimpfte Maselda in den Lärm hinein, „banditos del Diablo!“, als sie grob von Schwester Lucia unterbrochen wurde, die abrupt stoppte und nach hinten, „sei still Maselda, um Gottes Willen, sei still!“, fauchte.
Dann krochen wir alle schweigend weiter, während ich noch immer leise wimmerte.
Vor mir Lucia, hinter mir Maselda, die jetzt etwa so leise fluchte, wie ich weinte. Zwischendurch zauberte sie eine kleine Flasche aus ihrer nach Schweiß stinkenden Robe und nahm einen kräftigen Schluck daraus. Am Ende machte sie sich nicht einmal mehr die Mühe, den Schnaps zu verstecken, da sie sich alle paar Minuten einen Mundvoll gönnte.