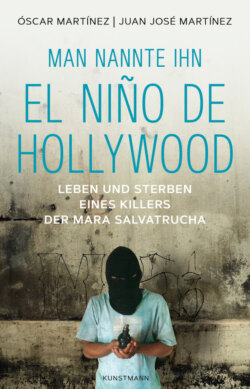Читать книгу El Niño de Hollywood - Oscar Martínez - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DRITTES KAPITEL Der Ursprung
ОглавлениеAm 24. März 1980 um sechs Uhr abends hielt ein hochgewachsener, bärtiger junger Mann in einem zweitürigen roten Volkswagen vor der Kapelle einer Krebsklinik in Miramonte, einer Wohnsiedlung der Mittelschicht in der salvadorianischen Hauptstadt. Das Präzisionsgewehr Kaliber .22, das er bei sich hatte, sollte in El Salvador alles verändern.
Schon vor 1980 hatte es in dem Land Kämpfe gegeben. Die Guerilla-Gruppen waren in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre größer geworden, und die Ausbildung der Mitglieder fand innerhalb und außerhalb des Landes statt. Dennoch war die Koordinierung zwischen ihnen mangelhaft. Abgesehen von der FPL, der Fuerzas Populares de Liberación (Volksbefreiungsbewegung), unter dem Kommandanten Cayetano Carpio, der damals mächtigsten Guerillabewegung des Landes, setzten sich die Organisationen aus Akademikern, Dichtern, Denkern und, im Allgemeinen, begeisterten und romantischen jungen Revolutionären zusammen. Es fehlte ihnen an Entschlossenheit, und es fehlte ihnen an Jahren.
Auch die Regierung war kein homogenes Ganzes. Die mächtige Elite der Großgrundbesitzer und Industriellen sah sich von den neuen revolutionären Ideen der Massen bedroht, die alle zwei Wochen mit Streiks und Straßensperren die Produktion lahmlegten. Den Militärs vertraute sie nicht mehr, und die Außenpolitik des US-amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter erschien ihr fast kommunistisch.
Es gab nur eine einzige Person, die sowohl den Respekt der Militärs als auch den der Plantagenbesitzer, der Industriellen und der politischen Klasse genoss: General José Alberto »Chele« Medrano. Er war ein Militär der alten Schule, ein Haudegen, rücksichtslos und brutal. Kurz, all das, was von einem salvadorianischen Mann erwartet wurde. Er war Kommandant der Nationalgarde gewesen und hatte sich sein hohes Ansehen im letzten, schmerzlichen Krieg zwischen mittelamerikanischen Staaten erworben, als er die gefürchteten Nationalgardisten bei der Invasion von Honduras im Jahre 1969 befehligte. Es hatte eine Reihe von Scharmützeln an der Grenze zwischen El Salvador und Honduras gegeben, die einhundert Stunden andauerten. Der berühmte polnische Journalist Ryszard Kapuściński bezeichnete den Konflikt als »Fußballkrieg«, weil drei Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko diesen ernsten Konflikt ausgelöst hatten. El Salvador gewann zwei der drei Spiele gegen Honduras und fuhr zum ersten Mal in seiner Geschichte zur Weltmeisterschaft. Dort verloren sie alle Spiele und erzielten kein einziges Tor.
In jenen Jahren Kommandant der salvadorianischen Nationalgarde zu sein war so ähnlich, wie Kommandant der Gestapo in Nazi-Deutschland zu sein. Die Nationalgarde wurde 1912 geschaffen, um die staatlichen Sicherheitskräfte zu bündeln, und seitdem waren die Gardisten im gesamten Staatsgebiet gefürchtet. Es war eine regelrechte Militärpolizei, und obwohl später noch die Nationalpolizei und die Angst und Schrecken verbreitende »Policía de Hacienda« gegründet wurden, war es vor allem die Nationalgarde, die die Macht des salvadorianischen Staates verkörperte. Deswegen war es auch General Chele Medrano, der, als im letzten Jahr der turbulenten Sechziger die Spannungen zwischen Honduras und El Salvador ihren Höhepunkt erreichten, die Vorbereitung der Invasion übernahm. Er reiste inkognito nach Europa und kaufte mit dem von den Plantagenbesitzern beschafften Gold Flakbatterien, moderne Sturmgewehre und Granaten, um die honduranische Armee zu bekämpfen. Es war ein sinnloser, absurder Krieg. Während der Invasion tötete die salvadorianische Armee mehr Rinder als Menschen, und die Truppe konzentrierte sich darauf, honduranische Plantagen zu zerstören. Es war der Krieg der Elenden. Wie zwei ausgezehrte Boxer, die sich gegenseitig Schmerzen zufügen wollen, aber nicht mehr die Kraft dazu haben.
Es war egal. Die Sinnlosigkeit des Krieges tat der Begeisterung keinen Abbruch, mit der General Medrano und seine Nationalgarde in San Salvador empfangen wurden, nachdem die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) wie eine Mutter, die von ihren ungezogenen Kindern genervt ist, den Feindseligkeiten ein Ende gesetzt hatte. Der General führte den Triumphzug in Galauniform, Gewehr über der Schulter, auf einem schwarzen Maulesel an. Zu seinen und seiner Männer Ehren wurde die Straße, durch die sie zogen, auf den pompösen Namen getauft, den sie bis heute trägt: Bulevar de los Héroes (»Boulevard der Helden«). Es ist eine der wichtigsten Verkehrsadern der salvadorianischen Hauptstadt.
Daraufhin wurde General Chele Medrano zum starken Mann des Militärs und zum wichtigen Beschützer der Kaffeeplantagenbesitzer. Er modernisierte den Repressionsapparat und ergriff effektive Maßnahmen gegen mögliche Aufstände. Gardisten und Polizisten kannten sich bereits mit Folter aus. Sie hatten sie jahrzehntelang im Einsatz gegen die gewöhnliche Kriminalität angewendet, waren Experten darin, Banditen, Mörder und kleine Diebe unter Druck zu setzen. Fußtritte, die »Kalkkapuze« und natürlich der gefürchtete Wassereimer, der an die Hoden gehängt wurde, das waren ihre Methoden.
Doch diese Maßnahmen reichten in den Siebzigerjahren nicht mehr aus, um die aufständischen Gruppen zu bekämpfen. General Medrano wusste das, er war bei den US-amerikanischen Militärs in Asien in die Schule gegangen und hatte viel gelernt. Er war es, der den ersten richtigen militärischen Geheimdienst gründete: die Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña (ANSESAL). Und er schuf ein Netz von Informanten unter den Bauern, den Ohren der Armee: die Organización Democrática Nacionalista (ORDEN). An die Spitze des neu gegründeten Geheimdienstes stellte er einen Mann seines Vertrauens, einen jungen Offizier, der mit ihm gegen die Honduraner gekämpft und sich durch seine Intelligenz und seine große Brutalität hervorgetan hatte. Es handelte sich um den dreißigjährigen Roberto D’Aubuisson.
Gemeinsam bekämpften sie die Anfänge der Guerilla. Die Informationen der ANSESAL führten sie zum Aufenthaltsort Hunderter organisierter Bauern, der Priester der Basisgemeinden (das Modell der neuen, gerade in Mode gekommenen Theologie der Befreiung für ganz Lateinamerika), der Gewerkschaftsführer und linken Ideologen, die man später ermordet auf irgendwelchen Feldwegen fand, mit durchgeschnittener Kehle, die Atemwege verstopft von Kot und Urin, woran sie erstickt waren. Die Mission von General Chele Medrano und damit die der Streitkräfte war es, mit den Worten eines Guerilleros jener Jahre, »das Kind in der Wiege zu ermorden«. Mit dem Kind war die revolutionäre Bewegung gemeint. Und mit »ermorden« genau das. Doch das Kind wuchs heran, ging in die Berge und lud sein Gewehr.
Im März 1980 gab es eine winzige Hoffnung auf eine politische Lösung. Ein Jahr zuvor hatte eine Gruppe junger Militärs einen Staatsstreich verübt und eine revolutionäre Regierung aus Ökonomen, Doktoren, Politikern und Militärs gebildet. Der damalige Erzbischof von San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, forderte die Massen auf, Ruhe zu bewahren. Er hatte Vertrauen zu der bürgerlich-militärischen Junta. Und die Massen hatten Vertrauen zu diesem außergewöhnlichen Erzbischof, der zu ihnen in die Gemeinden und Siedlungen kam und von der Kanzel der Kathedrale der Hauptstadt herab die staatlichen Übergriffe verurteilte.
Doch El Salvador ist ein Land abrupter Wendungen. Was heute eine glatte, gerade Straße ist, kann morgen eine Piste voller Schlaglöcher und enger Kurven sein, die das Lenkrad zittern lässt. Eine dieser überraschenden Wendungen ging mit General Chele Medrano vor sich. Er verliebte sich in ein Hippie-Mädchen, eine hübsche, reiche junge Frau, die, einen Joint in der Hand, in ihrem offenen Mercedes-Benz durch die Straßen von San Salvador fuhr. Sie war die Tochter von Ernesto Interiano, einem berüchtigten Banditen der Dreißigerjahre, den die Regierung von General Maximiliano Hernández Martínez ermorden ließ, demselben General, der die aufständischen Ureinwohner im Westen hatte umbringen lassen. Das Hippie-Mädchen hieß Miriam Interiano. General Medrano verließ die Armee, gab sich dem Boheme-Leben und Miriam Interiano hin und wurde schließlich vor seinem Haus in San Salvador von der Guerilla aus dem Hinterhalt ermordet. So endete der kurvige Lebensweg des gefürchteten Generals, aber nicht der seines Vertrauten.
Die Verantwortung für die Organisation des Kampfes gegen die Aufständischen ging wie selbstverständlich auf Roberto D’Aubuisson über, General Chele Medranos Musterschüler. Er hatte seine militärische Laufbahn als Mayor, einem mittleren Rang auf der Befehlsebene, inzwischen beendet. Nach dem Staatsstreich und der Einsetzung der bürgerlich-militärischen Junta 1979 war er überzeugt, dass das Ganze eine Verschwörung der Kommunisten war, um die Macht an sich zu reißen. Tatsächlich roch für Mayor D’Aubuisson damals alles, einschließlich gewisser politischer Maßnahmen der Vereinigten Staaten, nach Kommunismus. In D’Aubuissons fiebrigem Hirn verband sich vor allem eine Person mit dem ungebremsten Vormarsch der »kommunistischen Banden«: Erzbischof Romero.
Mit der Kugel, die am Nachmittag des 24. März 1980 während der Totenmesse für Doña Sara Meardi aus dem Gewehr eines Mörders kam, starb die Hoffnung auf eine politische Lösung des offenen sozialen Konflikts. Romero wurde ermordet, als er die Hostie über seinen Kopf erhob und sagte: »Möge dieser geschändete Leib und dieses für die Menschen vergossene Blut uns nähren, damit wir unseren Leib und unser Blut dem Leiden und dem Schmerz opfern, wie Christus es getan: nicht um seiner selbst willen, sondern um unserem Volk Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. So lasset uns denn im Glauben und in der Hoffnung vereinen und für Doña Sarita und für uns beten.« In diesem Moment fiel der Schuss.
Während der Totenmesse für Erzbischof Romero schossen die Streitkräfte des Staates, wie zur Besiegelung der Kriegserklärung, erbarmungslos auf die Tausenden von Trauergästen, die sich vor der Kathedrale der Hauptstadt versammelt hatten. Der Krieg hatte begonnen. Die Ruhe vor dem Sturm war beendet. Die Salvadorianer waren bereit, zu kämpfen. Und El Salvador stürzte sich in den Abgrund.
So wie die Ermordung des Erzherzogs von Österreich, Franz Ferdinand, durch die Hand eines Extremisten im Jahre 1914 den ersten großen Krieg in Europa ausgelöst hatte, löste die vom Gefolgsmann der Rechten, Roberto D’Aubuisson, angeordnete Ermordung Monseñor Romeros die Katastrophe in El Salvador aus. Die Guerillagruppen stellten ihre Differenzen zurück und schlossen sich zu einer gemeinsamen Volksbefreiungsfront zusammen, dem Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Der Staat seinerseits wurde von der neuen US-Regierung unter Präsident Ronald Reagan mit Waffen versorgt und rüstete damit fünf Eliteeinheiten aus, die von US-amerikanischen Militärberatern zu Tötungsmaschinen ausgebildet wurden. Zu Männern, die, was Gewalt betrifft, Rambo in den Schatten stellten.
Der Geheimdienst und die politische Repression blieben in den Händen der Nationalgarde und der beiden Polizeiverbände, doch den eigentlichen militärischen Kampf führte, zum ersten Mal, die salvadorianische Armee.
Der Norden des kleinen Landes wurde fast vollständig zum Rückzugsgebiet der Guerilla. Das Landesinnere war ununterbrochen umkämpft. Nur der Westen, der schmerzgeplagte, blutige Westen der Plantagenbesitzer El Salvadors, hielt sich weitgehend aus dem Konflikt heraus. Das Trauma, das die Gesellschaft nach dem Massaker an den Ureinwohnern in den Dreißigerjahren davongetragen hatte, erfüllte die neuen Generationen noch immer mit Angst.
1980 stürzte sich El Salvador, jetzt ohne einen Monseñor Romero, der den Konflikt und das Morden hätte stoppen können, in einen totalen Krieg, in eine Orgie von so maßloser Gewalt, dass es zwölf Jahre brauchte, um den Brand zu löschen. Zwei Monate vor seiner Ermordung hatte Monseñor Romero die Oligarchie El Salvadors davor gewarnt, was kommen würde. Wie ein Prophet hatte er bei einer Messe in San Salvador gesagt: »Wer sich weigert, die Ringe von seinen Fingern abzustreifen, läuft Gefahr, dass ihm die Hand abgehackt wird. Und wer sich weigert, aus Liebe und sozialer Gerechtigkeit anderen etwas abzugeben, läuft Gefahr, dass man es ihm mit Gewalt entreißt.« Von 1980 bis 1992 wurden in El Salvador viele Hände abgehackt, fielen zahlreiche Ringe ab, wurde viel Blut vergossen. Der Tod von Monseñor Romero, dem prophetischen Bischof, war vielleicht am schwersten zu vergessen.
Anfang der Achtzigerjahre hatte die Mara Salvatrucha 13 Paten. Zwei gewissenlose Paten. Mit zeitlichem Abstand betrachtet, erscheint alles höchst merkwürdig, um nicht zu sagen, unglaublich. Die beiden Paten wussten nicht, dass sie welche waren, und wären erstaunt, wenn sie heute sähen, welches Monster sie herangezüchtet haben. Der erste hieß Ronald Wilson Reagan, der zweite 18th Street Gang oder Barrio 18.
1981, ein Jahr nach Ausbruch des Krieges in El Salvador, wurde Ronald Reagan zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. In seiner Jugend war er ein Frauenschwarm in Hollywood gewesen, der in den Dreißiger- und Vierzigerjahren durch Westernfilme der Warner Bros., in denen er Herzen brach und sich mit brutalen Cowboys anlegte, berühmt geworden war. Er wuchs in Los Angeles auf und war Gouverneur des reichen Staates Kalifornien gewesen. Von seiner Präsidentschaft erwartete man sich Stärke. Seinem Vorgänger, dem Demokraten Jimmy Carter, wurde vorgeworfen, eine allzu nachgiebige Außenpolitik gegenüber dem Vormarsch des Kommunismus in Lateinamerika vertreten zu haben. Reagan dagegen hatte vor, sich wie sein Filmheld George Custer in Santa Fe Trail (»Land der Gottlosen«) zu verhalten und den Abschaum zu beseitigen, der den Lebensstil des Durchschnittsamerikaners sowohl innerhalb als auch außerhalb der Landesgrenzen, vor allem in Zentralamerika, bedrohte. Er versorgte General Efraín Ríos Montt, den guatemaltekischen Diktator, der Dutzender von Massakern an den Ureinwohnern beschuldigt wurde, mit Waffen und Militärberatern. In El Salvador unterstützte er trotz des brutalen Mordes an Romero die Militärregierung, indem er Waffen lieferte und die Ausbildung der fünf Eliteeinheiten finanzierte, die die Guerilla bekämpfen sollten. Es war, als werfe man eine brennende Zigarette in trockenes Heu. Eine Apokalypse. Der Krieg wurde mit einer solchen Brutalität geführt, dass er Tausende Salvadorianer außer Landes trieb. Die meisten von ihnen flüchteten nach Kalifornien, nach Los Angeles, wo sie zu jenen stießen, die bereits in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre, als der Bürgerkrieg sich am Horizont abzuzeichnen begann, fortgegangen waren.
Frisches, aggressives Fleisch, um die Mara Salvatrucha zu mästen. Die Bestie.
Die Massen neuer Flüchtlinge und Deserteure sahen sich Reagans Innenpolitik gegenüber, der zweiten Säule seiner Präsidentschaft. In seinen Reden pflegte er Drogen als den Feind Nr. 1 zu bezeichnen. Und die sollten in Kalifornien, wo er fünf Jahre lang Gouverneur gewesen war, zu einem immer größeren Problem werden.
Ab 1982 wurden insbesondere die Banden und Gangs der Lateinamerikaner verfolgt, die sich dem Drogenhandel widmeten. Dazu kam, dass die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles kurz bevorstanden, eine gute Gelegenheit, im schwelenden Konflikt zwischen den beiden großen Weltmächten des Kalten Krieges zu glänzen. Die Straßen mussten vom Abschaum gesäubert werden, er sollte in den Gefängnissen verschwinden.
Hunderte Bandenführer wurden verhaftet, ganze Gangs zerschlagen. Das komplizierte Ökosystem der großen Banden geriet durch die neue Politik der Vereinigten Staaten durcheinander. Die Mara Salvatrucha Stoner stieß in diese Lücke. Und Reagan ebnete ihr den Weg. Einerseits sorgte er für einen konstanten Zustrom gut ausgebildeter und immer aggressiverer Mitglieder aus El Salvador, andererseits holte er die mächtigsten Rivalen von der Straße. Mit einem so großzügigen Paten war es nur eine Frage der Zeit, bis die Bestie dick und fett wurde.
Doch die Mareros waren noch sehr ungezähmt. Auch wenn sie den Soundtrack der Stadt verstanden hatten, verstanden sie noch nicht ihren Text und ihr Thema. Sie waren eine gesetzlose Bande. Sie nahmen sich, was sie wollten, durchquerten feindliches Gebiet und vertrauten den Macheten und Äxten, die sie in ihren weiten Hosen mit sich herumtrugen. Den Menschen misstrauten sie. Regelmäßig trafen junge Deserteure der Guerilla oder der Armee aus El Salvador ein und wurden freudig willkommen geheißen, wie Helden. Sie brachten den Jungs auf den Straßen von LA neue Methoden bei, den Feind zu bekämpfen und in einen Hinterhalt zu locken. Sie kannten sich mit Strategien aus und waren brutal wie nur wenige Männer auf der Welt, wie kein mexikanisches Bandenmitglied jener Jahre sein konnte. Die militärische Ausbildung der salvadorianischen Streitkräfte, die Reagan finanziert hatte, trug am Ende zur Effizienz der MSS bei.
Doch die Stadt verstanden sie immer noch nicht. Der höchst undurchsichtige Krieg, den die chicanos, die Amerikaner mexikanischer Abstammung, gegeneinander führten, war ein Mysterium, das die Mareros noch nicht durchschaut hatten. Bis zu einem gewissen Punkt konnten sie den Krieg der chicanos gegen die Banden der Schwarzen, die berüchtigten Gangs Bloods und Crips, verstehen. Sie waren anders, und das war ein ausreichender Grund für die Gewaltorgie. Sie verstanden auch, warum die chicanos sie, die Salvadorianer, die in ein bereits besetztes Gebiet gekommen waren, hassten. Was sie aber nicht verstanden, war, warum sich die chicanos gegenseitig abmurksten, um sich danach zu verbünden, wieder zu trennen und schließlich wieder zu verbünden. Eine scheinbar chaotische Abfolge von Konfrontationen und Bündnissen. Wie Baseball und das undurchschaubare Spiel four corners war auch dieses Spiel ein Mysterium, und die Stadt weigerte sich einstweilen noch, es ihnen zu erklären. Noch waren sie ein Zwischending zwischen einer Gruppe gewaltbereiter Freunde und einer kalifornischen Bande.
Der Anthropologe Abner Cohen zitiert in einem seiner Werke ein Sprichwort arabischer Bauern, um das System von Bündnissen und Aggressionen zu erklären. Es fasst alles in einem Satz zusammen, den man sehr gut auch auf das System der lateinamerikanischen Banden ein Jahrhundert später anwenden kann: »Ich gegen meine Brüder. Mein Bruder und ich gegen meine Cousins. Mein Cousin, mein Bruder und ich gegen den Fremden.«
So war es. So ist es. Die Banden der chicanos können sich noch so brutal untereinander bekämpfen, aber sobald sie in den Strafvollzug kommen, wo die mächtigen Banden der Schwarzen, Asiaten und Weißen auf sie warten, schließen sie sich zu einer gemeinsamen Front zusammen, die sie El Sur nennen. Dieses System bedarf eines Führers, und der heißt Mexican Mafia. Dabei handelt es sich um eine Art Zentralkomitee sämtlicher mexikanischer Banden im Süden Kaliforniens. Eine aus verschiedenen Banden zusammengesetzte übergeordnete Struktur, gebildet aus deren Anführern. Im System El Sur sind Hunderte von Banden zusammengeschlossen, aber nur einige wenige haben einen Vertreter in der Mexican Mafia oder der M, wie sie auf den Straßen von denen genannt wird, die sich trauen, ihren Namen auszusprechen.
Die M ist per definitionem eine Bande im Strafvollzug. Aus den Haftanstalten heraus legen sie die Rechte und Pflichten der mexikanischen Gangs fest. Sie bestimmen die Regeln, stellen einen Verhaltenskodex auf: Du sollst nicht aus einem Fahrzeug heraus töten. Du sollst kein Bandenmitglied angreifen, das mit seiner Familie unterwegs ist. Du sollst keinem Faustkampf ausweichen. Du sollst Blau tragen, nie Rot. Du sollst Abgaben an die M entrichten, in welcher Form auch immer die M sie von dir einfordert.
Wenn ein Mitglied die Regeln und Gesetze nicht befolgt, macht die M seine gesamte Gang dafür verantwortlich. Bei einem schwerwiegenden Vergehen kann sie sogar »grünes Licht« geben, das heißt, die Todesstrafe verhängen. Von dem Moment an sind alle Banden des Systems El Sur verpflichtet, diese eine Bande zu bekämpfen. Zahlreiche Gangs wurden durch die Zähne des Systems El Sur zerfleischt, weil sie schwere Verstöße gegen den von der M aufgestellten Verhaltenskodex begangen hatten.
Richard, ehemaliges Mitglied des Barrio 18 und fünfzig Jahre alt, erinnert sich, während er einen frisch gepressten Orangensaft im El Basurero (»Der Müllmann«) trinkt, einer Suppenküche in der Colonia Dina, einem der gefährlichsten Viertel von San Salvador:
»Als ich nach Los Angeles kam, traf ich als Erstes auf die MS in der Gegend um den Lafayette Park. Aber die Leute gefielen mir nicht, ich weiß nicht … Alle hatten lange Haare, waren schmutzig, besoffen. Alle hatten T-Shirts von Black Sabbath oder Metallica an, und das gefiel mir nicht. ›Los, komm zu uns, schließ dich an. Wir bieten dir Schutz‹, sagten sie zu mir, aber mir gefiel das nicht. Sie waren immer zugedröhnt, rauchten Crack.«
Richard kam Anfang der Achtziger nach Los Angeles. Er hatte den Comandos Urbanos der Guerilla angehört, doch der Mord an Romero, die Intensivierung des Krieges und die Bildung der fünf Eliteeinheiten durch die Reagan-Administration jagten ihm Angst ein. Er war damals gerade mal siebzehn Jahre alt und folgte seinen Onkeln und Cousins in den Norden. Nach seiner enttäuschenden Erfahrung mit den Mareros der Mara Salvatrucha Stoner suchte er einen anderen Baum, an den er sich anlehnen konnte. Er fand ihn schnell. In der Gegend um den Shatto Park stand jene kräftige Eiche, die seinem Leben mehr als zwanzig Jahre lang Schatten spenden sollte: die homeboys vom Barrio 18.