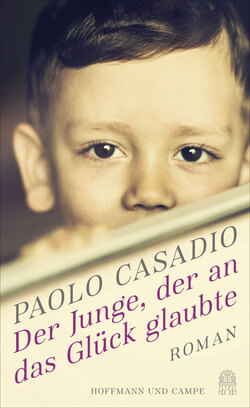Читать книгу Der Junge, der an das Glück glaubte - Paolo Casadio - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Wecker klingelte
ОглавлениеDer Wecker klingelte, und sein Läuten drang in den Schlaf der Familie Tini.
Nur langsam begriff Giovannino, wo er war. Beim Erwachen begleitete ihn die übliche morgendliche Angst. Dies war für ihn der schwierigste Moment des Tages: aufstehen, den Tag mit verantwortungsbewusstem Verhalten füllen, die Arbeit gewissenhaft tun, ihre unvorhergesehenen Zwischenfälle meistern, den Tagesablauf überstehen, um zurück ins nie genug zu preisende Bett zu kommen.
So sah seine tägliche Qual aus.
Vielleicht war das der Grund, und Giovannino sah darin keine Feigheit, warum die Aussicht auf die Versetzung nach Fornello ihn insgeheim begeistert hatte. Denn für ihn bedeutete diese Abgeschiedenheit – er hatte sich sofort über den Ort informiert – eine Lebensstrategie. Er mochte einsame Orte, es genügte ihm, Lucia an seiner Seite zu haben, die Frau, mit der er einen heimlichen Pakt fürs Leben geschlossen hatte. »Du wirst mich begraben«, hatten sie sich gegenseitig versprochen, und das genügte. Nein, er war kein Schürzenjäger, kein Kneipenbesucher. Er liebte Lucia, er liebte ihren vollkommenen Körper, den guten Charakter, die tröstende Kraft dieser blaugrünen Augen, und dann würde Anselmo kommen, und er würde diesem Kind beibringen, die Tiere, die Natur, die Größe der Schöpfung zu entdecken, und dafür schien Fornello genau der richtige Platz zu sein.
Es gab noch andere Gründe, ebenso heimliche, um mit dieser Station nicht unzufrieden zu sein. Wie vielen Italienern, obgleich eine Minderheit, war ihm die politische Situation, die sich in Europa zusammenbraute, nicht geheuer. Noch komplizierter wurde sie durch die jüngste Nachricht von der deutschen Wiederbewaffnung, diesen Kanonen, die den Frieden garantieren sollten, aber Kanonen blieben, und in seinem Krebsherzen entdeckte er jeden Tag eine neue Sorge, ein unheimliches Vorgefühl, eine Furcht. Darum, so Giovannino Tinis schlicht pragmatische Schlussfolgerung, war es besser, an einem Ort zu leben, der weniger von Gott als vielmehr von den Menschen vergessen war.
Lucia begann den neuen Tag mit anderen Aussichten. Das nächtliche Gewitter, dessen klar gegliederter Ablauf im Flachland undenkbar war, hatte sie nicht nur als Zeichen des Willkommens erlebt, sondern, und das war sehr wichtig, als die Preisgabe einer unbewussten Neutralität. Bis jetzt war es ihr so vorgekommen, als führte sie ein Leben im Wartezustand, sie hatte darauf gewartet, dass das Leben begann, sie hatte darauf gewartet, etwas tun zu dürfen, und auf eine unbekannte, aber nicht fremde Heimat. Einfach ein Warten. Und jetzt dachte sie darüber nach: Sie wartete auf das Leben, weil sie es leben wollte und Geschenke vom Leben haben wollte – schöne oder hässliche –, die ihm einen unwiederholbaren, ganz eigenen Sinn geben würden. Diese abgeschiedene Bahnstation mit ihrem naiven Rosa zwischen den Ginsterbüschen stellte eine Herausforderung, eine Provokation dar, und in ihrem Inneren spürte sie, zusammen mit diesem Kind, die nötige Energie, um die angebotene Chance wahrzunehmen. Jeder Tag würde eine neue Eroberung sein, eine Erfahrung, die zum Gepäck der Seele hinzukam. Entschlossen bestätigte sie, dass sie dazu bereit war.
So war sie die Erste, die aus dem Bett stieg, auf das Tal hinausblickte und sich an den kräftigen Farben des frühen Morgens erfreute. Wohlgemerkt, sie war die Erste, die in diesem Haus auf den Beinen war, denn auf den feuchten Berghängen und in den Wäldern sah sie Menschen Heu mähen und Tiere grasen.
Am Vorabend hatte Rinaldo ihnen eine Flasche Milch dagelassen.
»Das ist gute Milch, Ihr werdet es schmecken. Man bringt sie mir frisch von den Häuschen dort drüben«, und er hatte nach oben gezeigt, nach Norden, zum Bergkamm hin.
Lucia machte den Petroleumofen an und stellte die Kanne aus Aluminium darauf, nachdem sie zwei Tassen der pastösen Milch hineingegossen hatte, die dickflüssig war wie Sahne. Dann schnitt sie vier Scheiben vom Brot aus Kastanienmehl ab, auch dies ein Geschenk von Rinaldo: »Wenn Ihr wollt, begleite ich Euch morgen zum Einkaufen nach Gattaia runter. Wir stellen zwei Bütten auf das Fahrrad, dann dient es wenigstens als Lastesel …«
Lucia hatte zugestimmt.
Der erste Zug fährt um sieben Uhr durch, er kommt aus der Romagna, sein Ziel ist Florenz. Es ist keine Dampflok, sondern eine neue Maschine, Littorina genannt. Die Schnauze des Triebwagens ist kielförmig, als flöhe sie gebückt vor dem großen Radiator in Form eines griechischen Tempels. Mit ihren zwei Motoren ist die Littorina schneller als Dampflokomotiven, und die Waggons sind gut ausgestattet, mit bequemen, breiten Samtsitzen. Giovannino hat einige dieser Züge bei Testfahrten gesehen. Nur schade, denkt er, dass dieser dunkle, beißende Dieselrauch unangenehm ist und zu lange in der Kehle bleibt.
Der neue Bahnhofsvorsteher ist pünktlich an seinem Platz, der Zylinder und die Uniform tadellos in Ordnung. Lucia hat alles kontrolliert und ist ihm mit einem Vorschlag gekommen: »Weißt du, dass dir ein Schnurrbart gut stehen würde?« Giovannino hat sich im Spiegel über dem Waschtisch betrachtet und versucht, sich mit Bart vorzustellen.
»Mag sein«, gibt er zu. »Ich denk drüber nach.«
Verärgert bemerkt der Stationsvorsteher, dass die Littorina verspätet ist.
Als er die Treppe herunterging, hat er im Wartesaal eine in feierliches Schwarz gekleidete Alte mit elfenbeinfarbener Schürze gesehen, auf dem Boden vor sich zwei Taschen, prallvoll mit frischem Gemüse. Die Alte ist aufgestanden und zum Fahrkartenschalter gegangen.
»Einmal dritte Klasse nach Ronta, Hin- und Rückfahrt, mit Ermäßigung.«
Nein, so sagt sie das nicht. Das Fehlen der Zähne zerquetscht die Aussprache, vermischt die Worte. Giovannino bringt es nicht über sich, sie nach einem Ausweis zu fragen, um zu überprüfen, ob sie ein Anrecht auf Ermäßigung hat. Er ahnt das arbeitsreiche Leben dieser Großmutter, und die Frage erscheint ihm unredlich, denn die Frau hat den Preisnachlass auf jeden Fall verdient. Schweigend reicht er ihr die Fahrkarte, das Geld ist abgezählt, Zeichen einer eingeübten Praxis. Pipito, der aus dem Büro gelaufen ist, als sein Herrchen herunterkam, stellt sich vor die schwarze Gestalt und beobachtet sie freundlich mit seinen wachen, intelligenten Augen. Denn dieser Hund verliebte sich in die Verlierer, und das hatte niemand je verstanden.
Noch bevor er sie sieht, hört Giovannino die Littorina ankommen, und als der Zug vor seiner Signalscheibe hält, zählt er gut fünf Minuten Verspätung. Dem Zugführer, der die Tür des Triebwagens öffnet, verbirgt er seine Missbilligung nicht, schaut ostentativ auf seine Uhr und spricht ernst seinen Tadel aus: »Dem Land dient man auch mit Pünktlichkeit.«
Der Zugführer kassiert den Vorwurf, denkt vielleicht, dass er es mit einem dieser Hundertprozentigen zu tun hat, einem, der von Anfang an dabei war, und erwidert nichts. Giovannino reicht der Großmutter seinen Arm, um ihr beim Einsteigen zu helfen, und Pipito begleitet sie bis zur ersten Stufe. Der Rock hebt sich und enthüllt die schwieligen Füße ohne Schuhe. Der Zugführer will die Fahrkarten lochen und sieht, dass es ein Billett dritter Klasse ist. Die moderne Littorina hat sechsundfünfzig Plätze, aber keine dritte Klasse mehr. Giovannino bemerkt die Verwunderung des Eisenbahners, und ihn ergreift ein ungewohntes Gefühl, ähnlich wie Scham – aber es ist keine Scham. Er hört sich sagen: »Die Signora steigt in Ronta aus«, und seine Stimme ist entschlossen, duldet keine Erwiderung, gewährt keinen Rabatt. Dann gibt er das Signal zur Abfahrt. Mehr muss nicht gesagt werden, vor Pipitos feuchtem, fragendem Blick wird die Tür geschlossen.
Rinaldo hatte schon alles vorbereitet.
Mit einem Strick hatte er zwei Weidenkörbe am Sattel befestigt und so den Drahtesel in einen Lastesel verwandelt. Mehr konnte man von dem Fahrrad nicht verlangen, denn an diesem Ort hätte man es nie benutzen können, auch nicht bergabwärts, und Lucia sollte das bald verstehen.
Als Giovannino sie aufbrechen sah, hatte er besorgt gebeten: »Sei vorsichtig, pass gut auf dich auf …«, und die Augen verrieten die Angst um seine Frau.
Auf dem Saumpfad brauchte man bergabwärts bis Gattaia etwa eine Stunde, etwas länger für den Rückweg bergauf. Mit einer Breite von knapp zwei Metern, manchmal viel weniger, folgte er wie alle Saumpfade den natürlichen Windungen des Berges. Er war aus den grauen Kalksandsteinen der Gegend errichtet, einer dicht hinter den anderen gezwängt und an den Rändern durch größere Blöcke befestigt. Sie bildeten einen stabilen Pfad mit unregelmäßiger Oberfläche, gut für Maultiere, sehr viel weniger geeignet für die Schuhe von Städterinnen.
Der zweite Stationsvorsteher hatte sie sofort gesehen. Schöne Stadtschuhe mit weicher Sohle, elegant, ebenes Straßenpflaster gewohnt. Er hatte überlegt, ob er etwas sagen sollte, und sich dann entschlossen, nichts zu sagen. Die Frau des Bahnhofsvorstehers musste ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Ort machen, dachte er, und Warnungen oder Ratschläge hätten nichts genützt. Es war ihm gleich verschroben vorgekommen, Fahrräder ins Gebirge mitzunehmen, ein Fahrrad hatte hier niemand, man dachte nicht im Traum daran, Fahrrad zu fahren. Er würde aufpassen, dass sie sich nicht wehtat, das ja, denn in ihrer Situation war ein Sturz gefährlich, leicht konnte sie das Kind verlieren. Mehr als einmal hatte er gesehen, wie sie ihren Bauch streichelte, dann entspannte sich ihr Gesicht, ihre Züge wurden sanfter bei dieser Geste, die die Zukunft schützte.
Als sie aufbrachen, Rinaldo schob das Fahrrad, gesellte Pipito sich zu ihnen. Er sah sein Frauchen losgehen und hörte sofort auf, den Bürgersteig überall zu beschnüffeln, sich bei der Jagd nach Bienen um sich selbst zu drehen und lustige Sprünge zu machen, im vergeblichen Versuch, nach Schmetterlingen zu schnappen. Jetzt lief er den beiden gut zehn Meter voraus, denn er hatte die Aufgabe übernommen, die unbekannte Strecke zu erforschen. Dann kehrte er zu seinem Frauchen und Rinaldo zurück, stand auf seinen krummen Beinchen vor ihnen, der Schwanz fegte durch die Luft, die länglichen Ohren hingen herab, als wollte er sagen: »Alles friedlich, ihr könnt weitergehen.«
Lucia, die mit Gebirgspfaden gänzlich unvertraut war, erkannte sofort, dass sie sich verrechnet hatte. Das nächtliche Gewitter hatte die Steine rutschig gemacht, hinzu kam ihre unterschiedliche Höhe. Bei der Suche nach sicherem Stand geriet jeder Schritt nachdenklich, die Wadenmuskeln verhärteten sich, wenn der Weg abschüssiger wurde. Rinaldo hielt das Fahrrad, ständig schlug die Kette mit einem metallischen Geräusch gegen das Schutzblech.
»Seid vorsichtig dort drüben …«, mahnte er vorausblickend, während Pipito ganz auf sein erkundendes Vor und Zurück konzentriert war. Da Rinaldo sah, dass Lucia sich immer schwerer tat, blieb er vor dem Strunk eines schönen Nussbaums stehen, entdeckte einen gerade gewachsenen Schössling, holte ein Messer aus der Tasche, in wenigen Minuten war der Gehstock fertig und wurde überreicht. »Hier, stützt Euch darauf.«
Trotz des unsicheren Abstiegs, den das fortwährende Hin und Her des Hundes noch schwieriger machte, entging Lucia Assirelli die wilde Schönheit des Tals nicht. Nachdem sie die imposanten Eisenbahnüberführungen zu ihrer Rechten hinter sich gelassen hatten, waren sie in üppigeres, frisches Grün gekommen, wo sich zwischen den Bäumen die regelmäßigen Kastanienhaine und das gepflegte Unterholz auf der anderen Seite abhoben. Die reine Luft ließ sich gut atmen, sie war leicht und zart, nicht schwül wie die Luft im Flachland, außerdem gab es zum Glück keine Mücken, die besonderes nachts lästig wurden. Lucia versuchte, so viele gute Seiten wie möglich zu erkennen, wusste sie doch nur zu gut, dass sie weit mehr als eine Jahreszeit an diesem Ort verbringen würde, und dass eine Versetzung ihres Mannes wegen des späten Parteieintritts auf sich warten lassen würde. Wichtig ist auf jeden Fall, sich gut einzuleben, dachte sie, die Gegend kennenzulernen, mit den Menschen vertraut zu werden, das Haus so gemütlich wie möglich einzurichten und, warum nicht, ein bisschen Geld für die Zukunft beiseitezulegen, vielleicht sogar ein Radio auf Raten zu kaufen. Außerdem fuhr hier der Zug nach Florenz vorbei, eine Gelegenheit, die Stadt zu besuchen, sie war noch nie in Florenz gewesen.
Darüber dachte Lucia Assirelli nach, während sie achtgab, auf diesem steilen, steinigen Weg nicht zur stürzen. Sie dachte an das Morgen, wie es sich gehört für eine junge Frau, die bald Mutter wird.
Pipito lief immer noch vor und zurück, die Zunge hing ihm wegen der Hitze aus dem Maul, als sie auf einem hohen Brückchen aus roten Backsteinen zwei Frauen gemessenen Schritts aufsteigen sahen. Sie kamen näher, und Lucia sah den vollgefüllten Korb, den jede auf dem Rücken trug, die Trageriemen aus Stricken, die ihnen in die Schultern schnitten, und als die Frauen dicht vor ihnen waren, konnte sie den Geruch nach Schweiß und ungewaschener Kleidung nicht ignorieren. Sie verbarg ihren Eindruck, denn die beiden blieben stehen, um Rinaldo zu begrüßen, in Wirklichkeit aber wollten sie die Fremde sehen.
»Signor Cenci, da habt Ihr aber eine wirklich schöne Begleiterin …«, sagte die Ältere mit lauter Stimme, und nichts verriet ihre Anstrengung. Lucia musterte die beiden, ohne dass sie ihnen ein Alter zuordnen konnte. Die Haut ihrer Gesichter und Hände war sonnenverbrannt, rissig vom Wind und schwielig von der Arbeit. Statt die Frau des Stationsvorstehers zu begutachten, warfen die beiden nun neugierige Blicke auf das Fahrrad mit den Bütten.
»Und das, was ist das für eine Erfindung?«, fragten sie lachend.
»Das Fahrrad der Signora Lucia, der Frau des neuen Bahnhofsvorstehers.« Ein schüchternes Anwesenheitsjaulen lenkte die Aufmerksamkeit auf Pipito.
»Und der da, was ist das für ein Hund?«
»Das ist unser Hund. Er heißt Pipito«, erklärte Lucia.
»Ich meine … ist das ein Jagdhund? Ein Hirtenhund?«
»Ein Gesellschaftshund.«
Die Frauen sahen sich verwundert an. Hunde hielt man nur aus wirtschaftlichen Gründen, nie war es vorgekommen, dass Hunde aus Gefühlsgründen angeschafft wurden. Zur Gesellschaft? Reichte nicht eine acht- bis zehnköpfige Familie als Gesellschaft?
»Ein Gesellschaftshund?«, wiederholten sie als Antwort und legten die größtmögliche Ungläubigkeit in das Wort. Lucia fühlte sich geprüft und bewertet, beginnend bei ihren Stadtschuhen, sie suchte mit Blicken nach den Schuhen der beiden und sah unter den schmutzigen Säumen der langen Röcke nackte Füße hervorschauen. Unwillkürlich zog sie ihre Füße unter den Rock zurück und schämte sich, für sie ein ungewohntes Gefühl.
»Wohin wollt Ihr?« Mit der Frage versuchte sie das Thema zu wechseln. Rinaldo, der den gutgemeinten Versuch wahrscheinlich verstand, übernahm die Antwort.
»Sie gehen nach Piandolci. Das liegt vor Fornello, aber höher.«
Nun wurde Lucia ihrerseits neugierig, sie sah die beiden forschend an und wollte wissen, was sie in diesen vollen, schweren Körben trugen und wie sie miteinander verwandt waren, denn sie ähnelten einander und mochten Schwestern sein, obgleich man den Altersunterschied bei näherer Betrachtung deutlicher sah.
»Wie geht’s dem Papa?«, fuhr der zweite Stationsvorsteher fort.
»Besser, wegen der Salze aus Montecatini …«
»Dann grüßt ihn schön von mir und sagt, ich komme bald den Käse holen … Einen guten Tag noch!«
Sie nahmen ihren langsamen Abstieg nach Gattaia wieder auf. Rinaldo räusperte sich verlegen und schüttelte den Kopf.
»Ich muss Euch etwas sagen, Signora, aber nur, wenn Ihr’s mir nicht übel nehmt.«
Lucia hörte den Tonfall, und wieder überfiel sie ein ungewohntes Gefühl, sie fühlte sich schuldig.
»Ihr dürft die Frauen nicht so anschauen.«
»Wie anschauen?«
»Als wären sie anders als Ihr. Sie merken das.«
Getroffen von der Bemerkung sagte sie kein Wort mehr bis zum Ende des Wegs, als die ersten der wenigen Häuser von Gattaia auftauchten: die Kirche mit dem Pfarrhaus, der Friedhof, vier große Steinhäuser an der Straße neben dem Gebirgsbach, der hier zum Fluss wurde.
Sie hatte mehr erwartet und konnte kaum glauben, dass zu diesem Klümpchen Häuser sogar ein Laden gehörte. Natürlich gab es ihn, aber anders als die Geschäfte in der Stadt mit ihren geschmückten, bunten Schaufenstern. Eine schlichte Tür ohne irgendein Reklameschild und ein großer Raum, niedrig, dunkel, es roch nach Tabak, Korn, Öl und Wachs. Hinter dem hölzernen Ladentisch mit Brandflecken von Zigarren stand neben der roten Waage ein bärtiges Subjekt in schwarzer Latzhose, buschige Augenbrauen, dicht behaart bis zur Nase, einer kolossalen Nase.
»Faschistischer Gruß«, und er hob die rechte Hand wie ein Pinguin den Stummelflügel, nämlich bloß mit einer trägen Drehung des Handgelenks.
»Faschistischer Gruß«, erwiderte Rinaldo gleichmütig, als hätte er gesagt: »Gutes Wetter heute.«
Als sie den kurzen Austausch von Floskeln hörte, beschlich Lucia das dritte ungewohnte Gefühl an diesem Tag, das Befremden über faschistische Grüße. Sie begriff, dass sich zwischen dem Tag des Umzugs und diesem heutigen Tag schon ein Graben, eine Andersartigkeit aufgetan hatte. Im Tal von Fornello – so nannte sie es, weil sie noch nicht wusste, dass es das Tal des Muccione war – hatte sie nicht das geringste Anzeichen des Regimes, keine Inschriften, keine Uniformen gesehen. Erst jetzt wurde ihr die Abwesenheit der Politik in diesem Tal bewusst, und obwohl dieser Aspekt im Leben von Lucia Assirelli zweitrangig war, konnte sie sich eine leise Sympathie für die Eroberungen des Regimes gewiss nicht verhehlen. Sie dachte und sagte es auch, dass es Gutes und weniger Gutes gab, wie bei allem in dieser Welt, außerdem gingen bedauerliche Ereignisse wie die Ermordung des Abgeordneten Matteotti oder des Pfarrers von Argenta auf die frühen Zwanzigerjahre zurück, als sie ein kleines Mädchen war. Einmal an der Macht, hatten die Faschisten sich gehäutet, hatten die ungezügelten Elemente nach Ostafrika exiliert, die Hitzköpfe unschädlich gemacht. Aber warum fühlte sie sich dann so befremdet? Vielleicht war es weniger die Frage, die sie ärgerte, als die Tatsache, dass sie keine Antwort fand.
Sie lenkte sich ab, indem sie ihren Blick durch den Laden schweifen ließ. Alles war da: von der Pasta aus Nola bis zum Cerasella-Likör, vom Efti-Mokka bis zum Negri-Sirup und sogar dem Waschmittel Lysoform. All das sah sie aufgestapelt in den Regalen, in Schachteln, auf Stühle gelegt, am Boden aufgetürmt. Aber sie sah nicht alles.
»Habt Ihr Käse?«
»Nao.«
Genau das sagte der Ladenbesitzer, die Oberlippe verziehend: Nao.
»Eier?«
»Nao.«
»Kartoffeln?«
»Nao.«
Was war das für ein Laden ohne Käse, Eier, Kartoffeln? Im Lebensmittelladen in Faenza fand Lucia alles und weit mehr als Käse, Eier und Grünzeug, sie fand tagesfrisches Gemüse, soeben gekochten Ricotta, Squacquerone, den typischen Frischkäse der Romagna, Cassatelle, duftiges Gebäck, das die Luft mit Wohlgeruch erfüllte, und weiche, pikante Schafskäse aus Castelraniero! In was für einen schäbigen, heruntergekommenen Laden hatte der zweite Stationsvorsteher sie da gebracht?
»Signora«, erklärte Rinaldo, als könnte er ihre Gedanken lesen. »Ihr dürft ihn nicht nach Dingen fragen, die die Bauern selbst haben, denn die verkauft er nicht. Ihr müsst das verlangen, was die Bauern nicht selbst erzeugen: Kaffee, Zucker, Streichhölzer, solche Sachen …«, und dann, an den Ladenbesitzer gewandt: »Das ist die Frau des neuen Bahnhofsvorstehers, wisst Ihr …«
»Und wo finde ich Kartoffeln, Käse, Eier? Ihr glaubt doch nicht etwa, dass ich die selbst erzeuge?« Lucias Antwort mischte sich mit seiner Erklärung.
»Gute Frau«, fuhr der Ladenbesitzer brüsk dazwischen, »die findet Ihr bei den Bauern, zu Eurem Nutzen und Gefallen.«
Zu ihrem Nutzen und Gefallen kaufte Lucia Assirelli diverse Vorräte für mehrere Wochen. Getrocknete Hülsenfrüchte, Dosenerbsen, Salz zum Konservieren, Reis, Tomatenkonzentrat, sogar die berühmten Fischfilets der Marke Florio, das war ein Schwangerschaftsgelüst. Als es ans Bezahlen ging, fischte sie, während Rinaldo alles ordentlich in den Bütten verstaute, Geldscheine aus ihrer Börse, wurde aber vom Ladenbesitzer mit weit ausholenden Handbewegungen zurückgehalten.
»Was tut Ihr da? Immer mit der Ruhe, hier schreibt man an, Ihr zahlt am Monatsende, wie alle …«, und er schlug ein blaues Heft mit welligen Rändern auf. »Hier: Bahnhofsvorsteher von Fornello. Wir streichen den alten Namen durch und schreiben den neuen. Was schreibe ich?«
»Tini, Giovannino.«
»Tini … Giovannino. Fertig, das wär’s. Faschistischer Gruß, Signora Tini.«