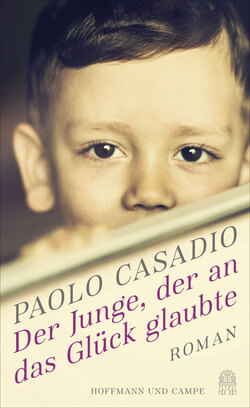Читать книгу Der Junge, der an das Glück glaubte - Paolo Casadio - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Rückweg
ОглавлениеDer Rückweg, das sieht sie sofort, wird zu einem langen, mühseligen Aufstieg. Vorsichtig klettert sie auf den ungefügen Steinen des Saumpfads in die Höhe und ist ganz Nachdenken: die Strapazen, das Kind, die Lebensmittel, die sie nicht hat kaufen können, dieses Tal, das ihr mal feindlich, mal freundlich erscheint, die Zeit, die sie hier verbringen muss. Und in das Klettern schleicht sich das enttäuschende Gefühl, beim Einkaufen versagt zu haben, wieder ein Schuldgefühl, in dem sich ihr Unbehagen bei der Begegnung mit dieser neuen Realität widerspiegelt. Sie ist nicht mehr im komfortablen Faenza, sondern plagt sich auf einem Maultierpfad über die Berge.
Rinaldo, der das unpassende Flachlandfahrrad schiebt, dessen Kette bei jedem Stoß laut im Schutzblech rasselt, bemerkt Lucias fragenden Ausdruck und möchte ihn richtig deuten: »Dies hier war die Straße der Romei …«
»Wie bitte?«, fragt die Frau des Bahnhofsvorstehers Tini geistesabwesend.
»Ich sagte, dies war die Straße der Romei«, abermals sieht er Verständnislosigkeit, Lucias gerunzelte Stirn, und möchte sich so klar wie möglich ausdrücken: »Die Romei waren die Pilger damals, die Leute, die nach Rom gingen. Darum heißen sie so.«
Die Romei waren die Pilger damals, Lucia kaut den Satz wieder und weiß nicht recht, warum. Ein Tritt im Bauch entlockt ihr einen Ausdruck der Überraschung, ihre Hand fährt zur halbmondförmigen Rundung, das besorgte Streicheln. Romeo hat endlich seinen Namen gehört und geantwortet, aber das – auch das – sollte erst später verstanden werden.
»Wo kauft man den Käse? Und die Milch?«
»Kuhmilch?«
»Natürlich, Kuhmilch.«
Der zweite Stationsvorsteher blieb stehen und nutzte die Gelegenheit, um sich den Schweiß vom Fahrradschieben abzuwischen.
»Von den Checchi in Piandolci.«
»Dann gehen wir nach Piandolci.«
Rinaldo blieb nicht viel hinzuzufügen. Die Maultierpfade, wo man heute keine Pilger mehr sah, hießen eben deswegen so, weil Maultiere über sie wanderten, und diese schöne Frau erschien ihm eigensinnig wie jene Tiere. Mit einer eigensinnigen Frau zu diskutieren, nein, das kam nicht infrage, erst recht nicht, wenn es die Frau seines Vorgesetzten war, um Himmels willen, nein. Sie würde schon verstehen, was es bedeutete, bis nach Piandolci zu gehen. Alles, außer einem angenehmen Spaziergang.
Unterhalb des Viadukts bog Rinaldo nach links in einen Seitenweg ab, schmaler und von niedrigen, regelmäßigen Trockenmauern gestützt. Erst folgte der Weg dem Bächlein in der Talsohle, dann begann er in engen Serpentinen anzusteigen. Die Vegetation auf dem grasbewachsenen Berghang wurde spärlicher, im gleichen Maße nahmen die Hitze und mit der Hitze die Fliegenschwärme und der umherziehende Gestank der Kuhfladen zu. Die beiden gingen langsam, gemessenen Schritts voran, begleitet vom Schlagen der Kette und Pipitos verspieltem Vor und Zurück, und als sie aus dem Wald kamen, fanden sie sich mitten auf einer ziemlich belebten Weide wieder.
Wenn das Fahrrad für die Kühe eine Neuheit darstellte, zeigten sie es nicht. Kühe, Tiere mit einer stoischen Philosophie, bringt man nicht so leicht zum Staunen, ungerührt rupften sie weiter Gras, verscheuchten Trauben von Fliegen mit Schwanzschlägen und Ohrenzucken, und die beiden Gestalten, der Hund und das Fahrrad wurden mit friedlicher Nachgiebigkeit ignoriert.
Pipito, der noch nie eine Kuh gesehen hatte, ließ der instinktiven Regung, sich ihnen zu nähern, ein umsichtiges Abwägen ihrer Größe vorausgehen und entschied dann, sich in der Nähe seines Frauchens wachsam, aber still zu verhalten.
Die Häuser von Piandolci lagen sonnenbeschienen am oberen Rand der Weiden, zwei Gebäude aus dem Stein, der im Sommer vom Südwestwind und im Winter vom Schnee angenagt wird. Das Bellen des Hundes machte die Bewohner auf die Ankömmlinge aufmerksam, und sofort kamen die beiden Frauen heraus, die man schon unten im Tal gesehen hatte, dazu ein Mann mit gelblichem Strohhut.
Der gesellige Pipito lief los, den Bruder zu begrüßen, und das Aufeinandertreffen wurde sofort zu einem befriedigenden, gegenseitigen Beschnüffeln der Genitalien. Nachdem ihre Hunde sich in dieser Form ausgewiesen hatten, gingen die Menschen aufeinander zu und begannen zu sprechen.
»Ihr seid die Signora von heute …«, hob die Frau an, die in Lucias Augen die Tochter sein musste.
»Schwanger!«, bemerkte die andere, vermutlich die Mutter. »Ihr dürft Euch nicht so abplagen … Los, rein ins Haus und setzt Euch hin!«
Der Ton war gebieterisch und wissend, Lucia, erhitzt vom Aufstieg, weigerte sich nicht. Der Mann mit dem Hut sagte kein Wort, die Daumen in die Taschen seiner abgewetzten Weste geklemmt, und alle gingen in das größere der beiden Häuser. Hier wurden sie von einer trockenen Luft aus Kühle und Schatten empfangen, einem großen Raum mit rußgeschwärztem Kamin, einem langen Tisch mit gedrechselten Beinen und neben dem Wandregal, wo der Wasserkrug stand, einem von der Decke baumelnden Fliegenpapier.
»Das ist die Frau des neuen Stationsvorstehers …«, sagte die Tochter zum Mann, und erst jetzt sah Lucia seine Augen aus trübem Weiß. Sie erschrak, noch nie in ihrem Leben hatte sie einen Blinden gesehen, und ihr erster Gedanke, logisch in seiner Widersinnigkeit, ging zu dem, was ihre Mutter ihr oft geraten hatte: »Vermeide Gelüste und Schrecken, wenn du willst, dass das Kind gesund geboren wird.«
Denn es hieß, und man glaubte daran, dass furchtsames Zusammenschrecken und die natürliche Lust aufs Essen den Fötus verändern konnte, und erklärte sich so Krankheiten wie die Hasenscharte, den Blutschwamm und anderes. Lucia überfiel die irrationale Vorstellung, ein blindes Kind zur Welt zu bringen, ihr Herz klopfte schneller, ein starker Schwindel erfasste sie, und sie sank noch erschöpfter auf einen Stuhl.
»Was hab ich Euch gesagt …«, bemerkte die Frau leise. »Sie sind’s nicht gewohnt …«, womit sie den noch unbekannten Stationsvorsteher in ihr Urteil einschloss. Doch Gerüchte verbreiten sich schnell, und tatsächlich war die Nachricht von den Neuankömmlingen schon in dieses Labyrinth aus Tälern vorgedrungen.
Lucia blickte sich um und gewahrte bitterste Armut. Sie zeigte sich im spärlichen Mobiliar, in den gekalkten, schwarz angelaufenen Wänden, in dem verloren wirkenden Bild eines Hochzeitspaars, in der Petroleumlampe, die über dem Tisch hing. Sie fasste sich ein Herz, nahm ein Glas Wasser von Rinaldo an und begann, in bemüht unbefangenem Ton zu sprechen.
»Ich habe mir gedacht, ob Ihr vielleicht Käse zu verkaufen habt, außerdem Eier und auch Milch.«
Die Familie Checchi hatte Käse zu verkaufen, außerdem Eier und auch Milch.
Der blinde Mann, der sich bewegte, als sähe er besser als die anderen, holte einen Laib Käse, der nach Kräutern duftete, aus dem Käsekeller, dazu ein übrig gebliebenes Viertel. Davon schnitt er mit geübten Bewegungen eine dünne Scheibe ab, ließ sie auf das hölzerne Hackbrett fallen und sprach sein erstes Wort:
»Kostet.«
Weich, saftig, pikant. Da konnten nicht einmal die Schafskäse aus Castelraniero mithalten.
»Mit der Milch könnte man es so machen …«, fuhr der Mann in freundlichem Ton fort. »Man bringt Euch jeden Abend eine Flasche, frisch gemolken. Und wenn ihr entbunden habt, bringt man Euch so viel Milch, wie gebraucht wird. Butter würde Euch guttun, die gibt Kraft …«
Die Überraschungen wurden immer zahlreicher für Lucia Assirelli: der sehende Blinde, der Kräutergeschmack des Käses, das Angebot, ins Haus zu liefern, sogar Butter. Ihre Frage kam spontan, es konnte keine andere sein: »Wie viel verlangt Ihr denn?«
Da machte die Tochter, bis jetzt stumme Zuhörerin, einen Schritt, dann noch einen auf den Alten zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er nickte, zeigte ein schüchternes, betrübtes Lächeln, schüttelte den Kopf.
»Eure Schuhe genügen, wenn Ihr einverstanden seid.«
So kehrten sie mit einem gewissen Überfluss in den Bütten und einem Paar genagelter Holzschuhe anstelle der Stadtschühchen zurück.
Lucia würde nie vergessen, was für ein Gesicht die mutmaßliche Tochter gemacht hatte, als sie mit ihren schwieligen, harten Füßen die weichen Stadtschuhe anprobierte. Doch sie passten genau, und die Freude, eine kindliche, spontane Freude, hatte sich im Blick ihrer braunen Augen konzentriert. Nein, Lucia würde die Frau nicht vergessen, denn sie hatte sich das Kopftuch abgenommen und den Zopf dunkler Haare gezeigt, Haare einer Heranwachsenden, die mit der verbrannten Haut einer alten Frau kontrastierten, und während des Abstiegs dachte Lucia an diesen Widerspruch.
Nicht nur daran. Die Armut der Familie Checchi hatte sie getroffen, sie hatte sich – auch wegen der Schuhe – als reiche, privilegierte Frau gefühlt. Dabei lebten sie und Giovannino nur von seinem Gehalt, jetzt das eines Stationsvorstehers, dessen Amt ihnen zum Glück auch Anrecht auf ein Haus gab, sonst hätten sie ihre Eltern um Hilfe bitten müssen. Lucia erschien es unglaublich, dass man im Jahr 1935 so arme Menschen sah.
Unterdessen hatte Giovannino mehrere Züge aus Ronta und einen Güterwagentransport aus Crespino abgefertigt. Da es wenig Verkehr und keine Passagiere gab, er sich aber mit seiner Arbeitsstätte vertraut machen wollte, hatte seine Beschäftigung aus einsamen Erkundungsgängen auf dem Gelände um den Bahnhof bestanden, und er war sich vorgekommen wie Pipito. Er hatte den achteckigen Wasserturm besichtigt und war hinter einem kurzen Tunnel auf das Rangiergleis gestoßen. Weiter am Hauptgleis entlang voranschreitend, entdeckte er wenig später auf halber Höhe des Hangs ein Haus, das auf einer Seite in großen Ziffern die Zahl Fünfzigvierhundertfünfzehn trug – das Bahnwärterhaus mit der Kilometrierung des nach den Waldkäuzen benannten Allocchi-Tunnels, fast vier Kilometer in den mergeligen Eingeweiden des Gebirgszugs der Giogana.
Sein einsames Umherwandern führte Giovannino in die friedliche Stille dieser Gegend und vor das Panorama des Tals, wo er in der Ferne, jenseits des Sturzbachs, Gestalten erblickte, die ein Kornfeld mähten. Deutlich erkannte er den einsamen Mähdrescher vom Vortag und überlegte, welch große Anstrengung nötig gewesen war, ihn bis hier hinauf zu bringen, wo man nicht die Spur einer richtigen Straße sah. Obwohl fortwährend ein leichter Wind wehte, übertrieb die Hitze, Giovannino fühlte, wie Schweißtropfen seinen Rücken hinabrannen und in der Unterhose endeten. Er hatte nicht einmal seine Mütze abgenommen, darum sah er aus wie ein Offizier, der seine Truppen inspiziert – obwohl es hier an Truppen nur ihn gab, in kerzengerader Haltung, und der Rest war Stille.
Aber Stille war dem Bahnhofsvorsteher nicht unlieb, und er hatte sich vielleicht auch dank ihres Schweigens in Lucia verliebt. In diesem Tal erschien ihm die Stille freilich schwer zu ertragen, denn sie war ein Schweigen von Vergessenen, von nicht existierenden Menschen. Mit Erstaunen registrierte er, dass er sich in diesem Ort schon alteingesessen fühlte, dabei waren seit ihrer Ankunft nicht einmal vierundzwanzig Stunden vergangen. Darum beschloss er, sich dem Bahnwärter vorzustellen, ein Arbeitsbesuch, um mit seinen Untergebenen vertraut zu werden.
Als das Haus am Hang etwa dreißig Meter entfernt vor ihm liegt, erblickt er eine Frau. Auf dem Absatz der Eingangstreppe stehend, spricht sie mit jemandem, den er nicht sieht, ihre Worte kommen tonlos und ununterscheidbar bei ihm an. Kurz darauf erkennt er, dass es sich um die Witwe Fanciullacci handelt, die Frau, die am Vortag aus dem Zug gestiegen ist, die mit dem Eierkorb, immer noch gekrümmt wie eine Sichel, und sie stößt sinnlose Worte aus. Giovannino zögert, macht ungleiche Schritte schräg gegen den Hang, bleibt stehen. Er könnte alles Mögliche machen, sogar einen Salto mortale, aber ihm wird bewusst, dass sie ihn nicht bemerken würde, und stumm kehrt er zum Tunnel zurück.
Am Bahnhof trafen sie aufeinander.
Rinaldo, Lucia und Pipito in Begleitung des beladenen Fahrrads, Giovannino mit dem roten Zylinder auf dem Kopf. Sie trafen am Bahnhof aufeinander, als hätten sie sich verabredet, und Giovanninos Blick fiel auf die Füße seiner Frau, die genagelten Holzschuhe, mit denen Lucia anders ging, mehr wie eine Frau aus dem Volk.
Noch bevor sie den Mund aufmachten, bevor sie Worte wechselten, erfassten beide schon die kleinen Veränderungen des anderen, und das war das Wunder ihrer Beziehung: sich aus dem Bauch heraus verstehen, intuitiv die Stimmung des anderen erfassen. Giovannino, der Offizier ohne Truppen, Lucia, die Städterin mit Holzpantinen, und noch fehlten zweiundneunzig Tage bis zur Geburt von Romeo Tini. Zweiundneunzig Sommertage, und noch konnte viel geschehen.
Der zweite Stationsvorsteher erbot sich, den Einkauf in die Wohnung zu bringen, und begann die Bütten des Fahrrads auszuräumen, das sich dem mehrfachen Befremden zum Trotz als durchaus nützlich erwiesen hatte. Lucia ließ ihn gewähren, es verlangte sie danach, sich aufs Bett zu legen, um den Bauch und das Kind ein paar Minuten lang ausruhen zu lassen, und Giovannino sah zu, wie die Einkäufe aus diesen Zauberhüten hervorkamen. Da er sich nutzlos fühlte, griff auch er nach etwas, und als die Operation abgeschlossen war und Rinaldo sich ordnungsgemäß zurückgezogen hatte, ging er zu Lucia.
Die Familie Tini hatte ihre eigenen Matratzen mitgebracht, zwei Matratzen wie sich’s gehört, eine Seite mit Wolle gefüllt, die andere, für den Sommer, mit Rosshaar. Das Bett aber hatten sie im Haus vorgefunden, wie fast das gesamte Mobiliar. Ein hohes Bett aus Gusseisen, ein bequemes Bett, das auch in delikaten Momenten nur ein leises Knarren von sich gab. Lucia hörte die Bewegungen ihres Mannes, murmelte mit geschlossenen Augen: »Komm her, ich muss dir etwas sagen«, und sprach.
Erzählen konnte sie gut. In allen Einzelheiten zeichnete sie den Abstieg auf dem Maultierpfad nach, beschrieb die Begegnung mit den Checchi, den Laden, der nur das verkaufte, was hier nicht erzeugt wurde, den Aufstieg nach Piandolci, die Armut des Hauses, den blinden Mann und ihr plötzliches Zusammenschrecken, die junge Alte, den Tausch der Schuhe. Dann schwieg sie, und Giovannino fühlte sich ermächtigt, von seinen einsamen Territorien zu sprechen, den fernen Gestalten, die das Korn mit der Sichel mähten, der Witwe Fanciullacci und ihrem Reden in den Wind.
»Wo kommt unser Sohn zur Welt?«
Es war nicht klar, wer diese geflüsterte Frage gestellt hatte, Giovannino oder seine Frau. Sie wurde nicht beantwortet, denn sie gehörte zu den Fragen, auf die man keine Antwort erwartet. In Wahrheit empfanden sie dieses Kind in der Tiefe ihrer Seele als das Abenteuer, das sie vom heimlichen, uneingestandenen Eindruck einer Nutzlosigkeit des Lebens befreien würde, ja, sie empfanden das Kind als Grund für ihr eigenes Leben, und da zählten die Probleme, die unvermeidlich kommen würden, wenig. Es war ihrer beider Geschenk an die Welt, dachte Lucia, und dafür würden sie jede Art Schwierigkeit auf sich nehmen.
Lucias Hand glitt leicht über die Steppdecke, berührte die ihres Mannes, drückte sie und wurde gedrückt. In diesem Kontakt spürten sie eine wachsende Kraft, die sie tröstete und keine Worte brauchte. Sie waren nicht allein und wussten, dass sie ein Versprechen, eine Wirklichkeit füreinander waren. In diesem gegenseitigen Händedruck spürte sie das Kinderherz ihres Mannes und er die treue Gefährtin, die er brauchte. Nein, Worte waren nicht nötig, und eine unbestimmbare Zeit lang verharrten sie in der Leichtigkeit ihres Traums.