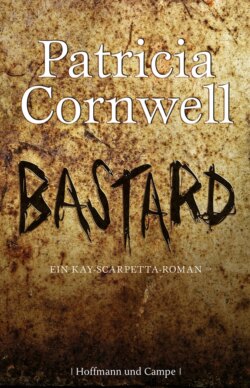Читать книгу Bastard - Patricia Cornwell - Страница 13
5
ОглавлениеSchneeflocken tanzen wie wild gewordene Motten vor unseren Landescheinwerfern und dem Luftzug unseres Rotors, während wir auf den Holzkarren aufsetzen. Die Kufen berühren vorsichtig die Oberfläche und gehen dann in die Knie, als das Gewicht der Maschine sich verteilt und vier Scheinwerferpaare vom Sicherheitstor neben dem Flughafengebäude auf uns zukommen.
Langsam bewegen sich die Scheinwerfer über die Rampe und beleuchten das dichte Schneetreiben. Ich erkenne die Umrisse von Bentons grünem Porsche Cayenne. Der Suburban und der Range Rover, beide schwarz, sind mir auch vertraut. Im Gegensatz zum vierten Auto, einer eleganten, dunklen Limousine mit verchromtem Kühlergrill. Anscheinend sind Lucy und Marino heute getrennt gefahren und haben ihre Autos beim Flughafenpersonal hinterlassen, was Sinn ergibt. Meine Nichte ist stets vor allen anderen am Flugplatz, um den Helikopter startklar zu machen und ihn vom Pitotrohr an der Front bis zur Halterung am Leitwerksträger zu überprüfen. Ich habe sie schon seit einer Weile nicht mehr so erlebt, und während wir zwei Minuten lang im Leerlauf abwarten, bevor sie die Systeme abstellt, versuche ich, mir das letzte Mal ins Gedächtnis zu rufen. So hoffe ich herauszufinden, was hier gespielt wird. Denn sie erzählt es mir einfach nicht.
Sie wird schweigen, solange es ihr in den Kram passt, und es gibt keine Möglichkeit, ihr Informationen zu entlocken, die sie noch nicht preisgeben will, was im Extremfall auch nie heißen kann. Lucy liebt Heimlichtuerei und verstellt sich leidenschaftlich gern, anstatt zu sich zu stehen. Das war schon früher in ihrer Kindheit so. Ein Geheimnis zu haben verleiht ihr Macht, und sie liebt Dramen, Risiken und Gefahren. Je bedrohlicher, desto besser. Bis jetzt hat sie mir nur verraten, dass es sich bei dem veralteten Roboter in der Wohnung des Toten um einen Transportroboter namens MORT handelt, der vor einiger Zeit für die Leichenbergung auf dem Schlachtfeld, mit anderen Worten: zum Abtransport von Toten im Krieg, eingesetzt werden sollte. MORT war ein Projekt, gegen das ich vor Jahren heftig opponiert habe. Doch der seltsame Umstand, dass sich so ein Ding in der Wohnung des Toten befindet, erklärt Lucys Verhalten nicht.
Wann hat sie mir schon einmal solche Angst gemacht – nicht, dass das das einzige Mal gewesen wäre –, weil ich befürchtete, sie könnte im Gefängnis landen? Vor sieben oder acht Jahren, sage ich mir, als sie aus Polen zurückkam. Dort war sie an einer Mission von FBI-Agenten in Zusammenarbeit mit Interpol beteiligt. Bis heute weiß ich nicht, worum genau es ging. Ich habe keine Ahnung, wie viel sie mir verraten würde, wenn ich sie stark genug bedrängte. Aber ich werde es nicht tun. Ich habe nämlich beschlossen, was die besagte Aktion angeht, lieber im Dunkeln zu tappen. Was ich weiß, ist genug. Mehr als genug. So würde ich niemals über Lucys Gefühle, ihre Gesundheit oder ihr allgemeines Wohlbefinden sprechen. Jedes einzelne Molekül von ihr ist mir wichtig. Doch mit einigen verschlungenen und geheimen Seiten ihres Lebens ist es eine andere Sache. Für sie und mich ist es besser, wenn ich bei manchen Dingen nicht nachhake. Es gibt Geschichten, die nicht erzählt werden wollen.
Während der letzten Stunde unseres Flugs nach Hanscom Field ist sie immer geistesabwesender und ungeduldiger, aber gleichzeitig übertrieben wachsam geworden. Insbesondere die Wachsamkeit ist eine Eigenart, die ich nur zu gut kenne; sie ist eine Waffe, die sie dann zückt, wenn sie sich bedroht fühlt und in die gewisse Stimmung gerät, vor der ich mich früher gefürchtet habe. Beim Auftanken in Oxford, Connecticut, hat sie den Helikopter keine einzige Sekunde aus den Augen gelassen. Außerdem hat sie den Tankwagen beobachtet. Ich musste im kalten Wind die Aufpasserin spielen, als sie ins Flughafengebäude lief, um zu bezahlen, denn sie traut Marino den Wachdienst, wie sie es ausgedrückt hat, nicht zu. Sie hat mir erklärt, dass er, als sie auf dem Flug nach Dover in Wilmington, Delaware, aufgetankt haben, so sehr mit Telefonieren beschäftigt gewesen sei, dass er sich weder um die Sicherheit noch um das geschert habe, was um ihn herum geschah.
Sie sagt, sie habe ihm durchs Fenster dabei zugeschaut, wie er redend und gestikulierend auf dem Vorfeld hin und her lief. Zweifellos war er damit beschäftigt, Briggs von dem Toten zu berichten, der angeblich noch lebte, als man ihn in meine Kühlkammer eingesperrt hatte. Kein einziges Mal habe sich Marino zum Hubschrauber umgedreht, empört sich Lucy. Er habe es nicht einmal bemerkt, als ein anderer Pilot auf die Maschine zugeschlendert sei, um sie sich aus der Nähe anzuschauen, in die Hocke ging, das Nachtsichtgerät und die Nightsun-Scheinwerfer inspizierte und dann durch die Plexiglasscheibe in die Kabine starrte. Marino habe völlig vergessen, dass die Türen und der Tank nicht verriegelt waren und dass es unmöglich ist, die Kabine zu sichern. Man kann die Triebwelle, den Motor und die Gangschaltung, also die lebenswichtigen Organe eines Hubschraubers, erreichen, indem man einfach ein paar Klappen öffnet.
Ein wenig Wasser im Tank genügt für einen Flammabriss und ein Motorversagen in der Luft. Wenn man zum Beispiel den Behälter, der die Hydraulikflüssigkeit enthält, mit einer kleinen Prise eines Fremdstoffs, zum Beispiel Erde, Öl oder Wasser, verunreinigt, fallen die Kontrollhebel aus wie die Servolenkung eines Autos – nur mit ernsthafteren Folgen, weil man sich siebenhundert Meter hoch in der Luft befindet. Wer eine wirkliche Katastrophe auslösen will, verschmutzt Treibstoff und Hydraulikflüssigkeit und erzeugt auf diese Weise gleichzeitig einen Flammabriss und einen Hydraulikausfall. Lucy hat mir – die Gegensprechanlage war während des Flugs auf »Besatzung« gestellt, damit Marino nicht mithörte – die grausigen Einzelheiten geschildert. Besonders fatal würde es sich nach Einbruch der Dunkelheit erweisen, wenn eine an sich schon heikle Notlandung noch dadurch erschwert wird, dass man nicht sieht, was sich unter einem befindet. Man kann nur hoffen, dass es weder Bäume noch Stromleitungen oder andere Hindernisse sind.
Natürlich ist das Anbringen eines Sprengsatzes der Sabotageakt, den sie am meisten fürchtet. Sprengstoffe und ihre Anwendung beschäftigen sie ohnehin sehr. Ständig grübelt sie darüber nach, wer sie gegen uns einsetzen könnte, einschließlich der amerikanischen Regierung, falls es gewissen Leuten in den Kram passt. Nachdem ich diesen Vortrag eine Weile über mich hatte ergehen lassen, hat sie mich noch mehr geängstigt, indem sie mir erklärte, wie mühelos sich so ein Sprengsatz unter dem Gepäck oder einer Fußmatte im hinteren Teil des Helikopters verstecken ließe, so dass er bei der Explosion den Treibstofftank unter den Rücksitzen zerreißen würde. Dann verwandelt sich der Hubschrauber in ein Krematorium, fügte sie hinzu, was mich wieder an den Soldaten im Humvee und die Hasstirade seiner leidgeprüften Mutter am Telefon erinnert hat. Den Großteil des Fluges hing ich bedrückenden Gedanken nach, denn jede geschilderte Katastrophe ruft deutliche Bilder meiner eigenen Fälle in mir wach. Ich weiß, wie Menschen sterben. Und ich weiß auch genau, was in diesem Fall mit mir passieren würde.
Lucy stellt die Zündung ab und zieht die Rotorbremse. Als der Rotor stoppt, öffnet sich die Fahrertür von Bentons Wagen. Die Innenbeleuchtung geht nicht an. Das wird sie auch in den anderen Geländefahrzeugen auf der Rampe nicht tun, da Polizisten und FBI-Agenten ihre Marotten haben. Sie sitzen nie mit dem Rücken zur Tür. Sie schnallen sich nur sehr ungern an. Und sie haben etwas gegen Innenbeleuchtung in ihren Autos. Man hat ihnen eingebläut, Hinterhalte und Gurte, die sie an der Flucht hindern könnten, zu meiden. Außerdem wollen sie sich nicht in beleuchtete Zielscheiben verwandeln. Sie sind wachsam. Allerdings nicht so wachsam wie Lucy in den letzten Stunden.
Benton nähert sich dem Helikopter und wartet neben dem Karren, die Hände in den Taschen einer alten schwarzen Lammfelljacke, die ich ihm vor vielen Jahren zu Weihnachten geschenkt habe. Der Wind zaust sein silbergraues Haar. Groß und schlank hebt er sich vor der verschneiten Nacht ab. Seine Züge sind im Spiel aus Licht und Schatten klar zu erkennen. Wenn ich ihn nach einer langen Trennung wiedersehe, betrachte ich ihn stets mit den Augen einer Fremden und fühle mich wieder von ihm angezogen wie bei unserer ersten Begegnung vor vielen Jahren in Virginia. Damals war ich der neue Chief Medical Examiner, die erste Frau in den USA, die einem so großen rechtsmedizinischen Institut vorstand. Er war eine Legende beim FBI, der berühmteste Profiler und Leiter der damaligen Abteilung für Verhaltensforschung in Quantico. Als er in meinen Konferenzsaal spaziert kam, fühlte ich mich plötzlich befangen und verunsichert, und das hatte nichts mit den Serienmorden zu tun, die wir gerade erörterten.
»Kennst du diesen Typen?«, flüstert er mir ins Ohr, als wir uns umarmen. Er küsst mich sanft auf die Lippen, und ich rieche den holzigen Duft seines Rasierwassers und spüre das weiche Leder seiner Jacke an der Wange.
Dann schaue ich an ihm vorbei und den Mann an, der aus der Limousine steigt. Inzwischen kann ich erkennen, dass es ein dunkelblauer oder schwarzer Bentley ist, dessen V12-Motor leise schnurrt. Der Mann ist groß und übergewichtig, hat schlaffe Wangen und einen schütteren Haarkranz, der im Wind flattert. Bekleidet ist er mit einem langen Mantel. Er hat den Kragen bis über die Ohren hochgeschlagen und trägt Handschuhe. Höflich Abstand haltend, gibt er sich so diskret wie der Chauffeur eines britischen Adligen. Allerdings spüre ich, dass er uns beobachtet. Benton scheint ihn sehr zu interessieren.
»Sicher wartet er auf jemand anders«, stelle ich fest, als der Mann zwischen Benton und dem Helikopter hin und her blickt.
»Kann ich Ihnen helfen?« Benton tritt auf ihn zu.
»Ich suche Dr. Scarpetta.«
»Und warum suchen Sie Dr. Scarpetta?« Benton verhält sich zwar freundlich, aber auch bestimmt und unzugänglich.
»Ich soll etwas hier abgeben. Man hat mir gesagt, die betreffende Person befände sich in diesem Helikopter oder erwarte ihn hier.«
»Was kann ich für Sie tun?«
»Ich habe den Auftrag, Dr. Scarpetta etwas persönlich auszuhändigen. Sind das vielleicht Sie?« Der Fahrer sieht zu, wie Lucy und Marino meine Sachen aus der Passagierkabine und dem Gepäckraum holen. Ich bin für ihn nicht vorhanden, und er würdigt mich keines Blickes. Offenbar bin ich nur die Frau des hochgewachsenen, attraktiven Mannes mit dem silbergrauen Haar. Der Fahrer hält Benton für Dr. Scarpetta und glaubt, der Helikopter gehöre ihm.
»Am besten sorgen wir dafür, dass Sie so schnell wie möglich aufbrechen können, bevor wir noch einen Schneesturm bekommen«, sagt Benton und steuert auf den Bentley zu, so dass der Fahrer keine andere Wahl hat, als ihm zu folgen. »Soweit ich gehört habe, rechnet man mit zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter Neuschnee. Aber ich fürchte, es wird noch mehr werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Was für ein Winter! Woher kommen Sie? Nicht von hier. Irgendwo aus dem Süden. Ich tippe mal auf Tennessee.«
»Das merken Sie noch nach siebenundzwanzig Jahren? Muss wohl weiter an meinem Nordstaatenakzent arbeiten. Nashville.« Er öffnet die Beifahrertür und beugt sich in den Wagen.
Ich warte auf der Rampe, wo Benton mich stehengelassen hat. Ich weiß, dass ich ihm nicht zum Bentley folgen darf, habe jedoch keine Lust, in unserem Auto zu sitzen, solange ich keine Ahnung habe, wer der Mann ist, was er abgeben soll oder woher er die Information hat, dass eine Person namens Scarpetta entweder mit einem Hubschrauber in Hanscom landet oder ihn dort erwartet und wann das sein wird. Der Erste, der mir einfällt, ist Jack Fielding. Er ist sicher über meine Reisepläne informiert, und ich habe einen Blick auf mein iPhone geworfen. Anne und Ollie haben auf meine SMS geantwortet und befinden sich bereits im CFC. Aber Fielding hat sich nicht gemeldet. Was ist nur los mit ihm? Etwas liegt da im Argen, anscheinend etwas Ernstes. Sicher handelt es sich nicht nur um ein weiteres Beispiel seiner üblichen Verantwortungslosigkeit, Gleichgültigkeit oder Sprunghaftigkeit. Hoffentlich fühlt er sich wohl, ist weder krank noch verletzt und hat auch keinen Streit mit seiner Frau. Ich beobachte, wie Benton etwas in die Jackentasche steckt. Er geht sofort zu seinem Cayenne. Das ist eine Botschaft an mich: Steig ein und stell auf der Rampe keine Fragen. Gerade ist etwas geschehen, das ihm trotz seines lockeren und freundlichen Gesprächs mit dem Fahrer nicht gefällt.
»Was ist passiert?«, erkundige ich mich, während wir gleichzeitig die Türen schließen. Marino öffnet die Heckklappe und fängt an, meine Kartons und Taschen ins Auto zu schieben.
Benton schaltet die Heizung ein und antwortet nicht, als meine übrigen Sachen verladen werden. Dann kommt Marino zur Beifahrerseite und klopft mit dem Fingerknöchel an die Scheibe.
»Wer zum Teufel war das?« Er schaut zum Bentley hinüber. Der Schnee fällt in dicken Flocken, sammelt sich auf dem Schirm seiner Baseballkappe und schmilzt auf seiner Brille.
»Wussten viele Leute, dass du und Lucy heute nach Dover wolltet?« Beim Sprechen lehnt Benton die Schulter an meine.
»Der General. Und Captain Avallone, als ich versucht habe, anzurufen und Doc Scarpetta etwas ausrichten zu lassen. Und gewisse Leute in unserem Institut. Warum?«
»Sonst niemand? Vielleicht eine beiläufige Bemerkung gegenüber den Sanitätern oder der Polizei von Cambridge?«
Marino hält inne und überlegt. Kurz verändert sich seine Miene. Er ist nicht sicher, wem er es erzählt hat. Jetzt versucht er, sich zu erinnern, und geht in Gedanken seine Optionen durch. Falls er leichtsinnig war, wird er es nicht zugeben. Schließlich hat er sich oft genug Vorwürfe wegen seiner Redseligkeit anhören müssen und vermutlich keine Lust auf eine weitere Standpauke. Wie man gerechtigkeitshalber außerdem einräumen muss, hatte er keinen Grund, anzunehmen, dass es sich bei seinem und Lucys Flug nach Delaware, um mich abzuholen, um eine vertrauliche Information handelt. Mein Aufenthalt dort war schließlich kein Staatsgeheimnis. Morgen hätte ich ohnehin nach Hause kommen sollen.
»Kein Problem, wenn du es jemandem gesagt hast.« Anscheinend denkt Benton dasselbe wie ich. »Ich möchte nur herausfinden, woher der Bote wusste, wann der Helikopter landet, mehr nicht.«
»Was für ein Bote fährt mit einem Bentley herum?«, fragt Marino.
»Offenbar einer, dem man eure Reiseroute und auch die Hecknummer des Helikopters mitgeteilt hat«, entgegnet Benton säuerlich.
»Fielding, dieser Schwachkopf! Was zum Teufel bildet er sich ein? Der Typ ist total durchgeknallt.« Marino nimmt die Brille ab und findet dann nichts, um sie zu putzen. Sein Gesicht wirkt ohne die alte Nickelbrille seltsam nackt. »Ich habe gegenüber ein paar Leuten erwähnt, dass du schon heute und nicht erst morgen zurückkommst. Ich meine, natürlich waren einige im Bilde, und zwar wegen unseres Problems mit dem blutenden Toten und so«, wendet er sich an mich. »Aber Fielding ist derjenige, der genau über deine Pläne informiert war. Und er kennt auch Lucys Helikopter, denn er war schon an Bord. Mist, du wirst noch Augen machen«, fügt er mit Grabesstimme hinzu.
»Wir unterhalten uns im Büro.« Benton will, dass er den Mund hält.
»Was zum Teufel wissen wir über ihn? Was führt er im Schilde, verdammt? Es wird langsam Zeit, dass du aufhörst, ihn in Schutz zu nehmen. Umgekehrt tut er es nämlich eindeutig nicht«, sagt Marino zu mir.
»Wir sollten später darüber sprechen«, entgegnet Benton drohend.
»Der will dich reinlegen«, meint Marino zu mir.
»Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.« Bentons Tonfall wird schneidend.
»Er ist scharf auf deinen Job. Oder vielleicht gönnt er ihn dir einfach nicht.« Marino betrachtet mich, steckt die Hände in die Taschen seiner Lederjacke und tritt vom Fenster zurück. »Willkommen daheim, Doc.« Schneeflocken wehen ins Wageninnere und landen feuchtkalt auf meinem Gesicht und Hals. »Es ist gut, daran erinnert zu werden, wem du wirklich trauen kannst, oder?« Er starrt mich an, während ich das Fenster schließe.
An den Tragflächen der geparkten Flugzeuge blinken rotweiße Antikollisionslämpchen, als wir langsam über die Rampe zum Sicherheitstor rollen, das gerade aufgegangen ist.
Der Bentley fährt hindurch, wir folgen. Ich stelle fest, dass er Kennzeichen aus Massachusetts hat, auf denen nicht das Wort Fahrdienst eingestanzt ist. Das heißt, dass der Wagen nicht einer Autovermietung gehört. Das wundert mich nicht. Bentley sind selten, insbesondere in dieser Gegend, wo die Menschen, auch die Besitzer von Privatflugzeugen, zurückhaltend und umweltbewusst sind. Ich sehe nur selten einen Bentley oder Rolls-Royce. Die meisten fahren Toyota oder Saab. Wir passieren das Verwaltungsgebäude von Signature, einer der wenigen Fluggesellschaften im zivilen Teil des Flugplatzes. Ich lege die Hand auf Bentons Jackentasche aus weichem Wildleder, ohne den cremeweißen Briefumschlag zu berühren, der ein winziges Stück herauslugt.
»Möchtest du mir nicht endlich erklären, was das gerade war?« Offenbar hat man ihm einen Brief übergeben.
»Niemand hätte wissen dürfen, dass du gerade gelandet bist. Auch nichts über dich persönlich oder deinen Aufenthalt. Und damit basta«, entgegnet Benton. Seine Miene und seine Stimme sind hart. »Anscheinend hat sie im CFC angerufen, und Jack hat es ihr erzählt. Sie hat ganz sicher dort angerufen, und wer außer Jack käme in Frage?«
Wie er es ausspricht, klingt es nicht nach einer Frage. Ich habe keine Ahnung, worauf er anspielt.
»Ich begreife nicht, warum er oder überhaupt jemand mit ihr gesprochen hat, verdammt«, fährt Benton fort. Allerdings bin ich überzeugt, dass er sehr wohl versteht, wovon er redet. Sein Tonfall sagt nämlich das genaue Gegenteil aus. Ich merke ihm an, dass er nicht einmal überrascht ist.
»Wer?« Ich habe nämlich keine Ahnung. »Wer hat im CFC angerufen?«
»Johnny Donahues Mutter. Offenbar ist das ihr Fahrer.« Er zeigt auf den Wagen vor uns.
Die Scheibenwischer quietschen, als sie über die Scheibe gleiten und den Schnee beiseiteschieben, der sich beim Auftreffen auf das Glas in Matsch verwandelt. Ich betrachte die Rücklichter des Bentley und versuche, mir auf Bentons Worte einen Reim zu machen.
»Wir sollten uns das Ding einmal anschauen.« Damit meine ich das Kuvert in seiner Tasche.
»Es ist ein Beweisstück und sollte im Labor untersucht werden«, erwidert er.
»Ich will aber wissen, was es ist.«
»Heute Morgen bin ich mit Johnnys Begutachtung fertig geworden«, erklärt Benton. »Mir ist bekannt, dass seine Mutter einige Male im CFC angerufen hat.«
»Woher?«
»Johnny hat es mir gesagt.«
»Ein Psychiatriepatient sagt dir etwas. Und das ist für dich eine zuverlässige Information?«
»Ich habe seit seiner Einweisung insgesamt fast sieben Stunden mit ihm verbracht und glaube nicht, dass er einen Mord auf dem Gewissen hat. Es gibt da zwar eine ganze Reihe von Dingen, die ich ihm nicht glaube. Allerdings halte ich es auf der Grundlage dessen, was ich weiß, für gut möglich, dass seine Mutter im CFC anruft.«
»Sie kann doch nicht ernsthaft annehmen, dass wir den Fall Mark Bishop mit ihr erörtern würden.«
»Heutzutage halten die Menschen jede Information für öffentliches Eigentum, auf das sie ein Recht haben«, meint er, und es ist nicht seine Art, Mutmaßungen anzustellen oder sich in Allgemeinplätzen zu ergehen. »Mrs. Donahue hat ein Problem mit Jack«, ergänzt Benton.
»Johnny hat dir erzählt, seine Mutter hätte ein Problem mit Jack. Und wie kommt sie dazu, sich ein Urteil über ihn zu bilden?«
»Über einige Dinge darf ich nicht sprechen.« Er blickt starr geradeaus und fährt auf der verschneiten Straße weiter. Es schneit immer heftiger. Die Flocken fallen schneller, wirbeln im Lichtkegel der Scheinwerfer und prasseln gegen die Scheibe.
Ich merke es Benton an, wenn er mir etwas verheimlicht. Für gewöhnlich stört es mich nicht. Doch im Moment bin ich versucht, heimlich den Umschlag aus seiner Tasche zu ziehen und mir anzuschauen, was jemand, vermutlich Mrs. Donahue, mir mitzuteilen hat.
»Hast du sie kennengelernt oder mit ihr gesprochen?«, frage ich Benton.
»Bis jetzt habe ich es geschafft, das zu vermeiden, obwohl sie seit seiner Einweisung mehrere Male im Krankenhaus angerufen hat, um mich aufzuspüren. Aber ich darf nicht mit ihr reden. Es gibt so viele Dinge, über die ich nicht reden darf, und mir ist klar, dass du das verstehst.«
»Wenn Jack oder sonst jemand ihr Einzelheiten über Mark Bishop erzählt hat, haben wir ein Riesenproblem«, antworte ich. »Ich habe zwar Verständnis für deine Zurückhaltung oder glaube es wenigstens, doch ich habe ein Recht, zu erfahren, ob er das getan hat.«
»Ich hatte keine Ahnung, wie gut du im Bilde bist oder ob Jack etwas zu dir gesagt hat«, entgegnet er.
»Worüber genau?«
Ich kann mich nicht genau erinnern, wann ich zuletzt mit Fielding gesprochen habe. Unsere Unterhaltungen, so sie denn stattfanden, waren kurz und sachlich. Als ich über die Feiertage einige Tage lang zu Hause war, habe ich ihn nicht gesehen. Er war verreist, wie es hieß, mit seiner Familie, aber ich bin nicht sicher. Fielding hat vor vielen Monaten aufgehört, mir irgendwelche Einzelheiten über sein Privatleben mitzuteilen.
»Insbesondere in diesem Fall, dem Fall Mark Bishop«, fährt Benton fort. »Hat Jack kurz nach der Tat mit dir darüber geredet?«
Am 30. Januar, einem Samstag, hat der sechsjährige Mark Bishop im etwa eine Stunde entfernten Salem im Garten gespielt, als ihm jemand Nägel in den Kopf schlug.
»Nein«, erwidere ich. »Hat er nicht.«
Als der Junge ermordet wurde, war ich in Dover. Fielding hat den Fall übernommen, was ich ziemlich ungewöhnlich fand. Er hatte schon immer ein Problem damit, Kinder zu obduzieren, sich aber aus mir unbekannten Gründen entschieden, diesmal eine Ausnahme zu machen, was mich sehr erschreckt hat. Früher pflegte Fielding sich zu verdrücken, wenn eine Kinderleiche unterwegs zum Autopsiesaal war. Deshalb war es reichlich merkwürdig, dass er sich um den Fall Mark Bishop gekümmert hat. Inzwischen bereue ich, dass ich nicht nach Hause gekommen bin, denn das war mein erster Gedanke, den ich eigentlich in die Tat hätte umsetzen sollen. Doch ich wollte mit meinem Stellvertreter nicht genauso umspringen wie Briggs mit mir, indem ich ihm mangelndes Vertrauen signalisierte.
»Ich habe mir die Sache gründlich angesehen, sie jedoch nicht mit Jack erörtert. Allerdings habe ich ihm unmissverständlich klargemacht, dass ich ihm im Notfall unter die Arme greifen würde.« Ich spüre, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen. Ich hasse es, wenn ich mich so verhalte. »Offiziell war es sein Fall. Ich war nicht hier.« Obwohl ich weiß, dass es wie eine faule Ausrede klingt, muss ich es aussprechen und ärgere mich über mich selbst.
»Mit anderen Worten: Jack hat nicht versucht, dich über die Ergebnisse – oder besser seine Ergebnisse – aufzuklären«, stellt Benton fest.
»Vergiss nicht, wo ich war und dass ich alle Hände voll zu tun hatte«, halte ich ihm vor Augen.
»Ich behaupte ja nicht, dass es deine Schuld ist, Kay.«
»Was soll meine Schuld sein? Und was meinst du mit seinen Ergebnissen?«
»Mich würde interessieren, ob du Jack danach gefragt hast oder ob er dir möglicherweise aus dem Weg gegangen ist.«
»Du weißt ja, wie er auf tote Kinder reagiert. Ich habe ihm eine Nachricht hinterlassen, er könne den Fall auch einem anderen Rechtsmediziner übertragen, aber Jack hat es selbst erledigt. Das hat mich überrascht, doch so war es nun einmal. Wie schon gesagt, habe ich sämtliche Unterlagen überprüft. Seinen Bericht, den Polizeibericht, die Laborberichte und so weiter und so fort.«
»Also hast du offenbar wirklich keine Ahnung, was gespielt wird.«
»Anscheinend gehst du davon aus.«
Benton schweigt.
»Soll das heißen, es gibt noch mehr als das Geständnis des jungen Donahue?«, versuche ich es noch einmal. »Natürlich habe ich die Nachrichten gesehen. Und wenn ein Student aus Harvard ein solches Verbrechen gesteht, wird natürlich überall darüber berichtet. Du willst vermutlich darauf hinaus, dass man mir bis jetzt bestimmte Einzelheiten vorenthalten hat.«
Wieder antwortet Benton nicht. Ich male mir aus, wie Fielding mit Donahues Mutter gesprochen hat. Durchaus möglich, dass er ihr verraten hat, wo ich mich heute Abend aufhalten würde. Daraufhin hat sie ihren Fahrer beauftragt, mir einen Umschlag auszuhändigen. Allerdings schien dieser Fahrer nicht zu wissen, dass Dr. Scarpetta eine Frau ist. Ich betrachte Bentons schwarze Lammfelljacke. In der Dunkelheit kann ich undeutlich die Kante des weißen Umschlags in seiner Jackentasche ausmachen.
»Warum sollte jemand aus deinem Institut mit der Mutter des Menschen sprechen, der das Verbrechen gestanden hat?« Bentons Frage klingt eher wie eine Feststellung. Rhetorisch. »Vielleicht gibt es ja eine logische Erklärung, auf welchem Weg sie es erfahren hat. Eine, die nicht mit Jack zusammenhängt. Ich bemühe mich, für alles offen zu sein.«
Er klingt aber ganz und gar nicht danach, sondern eher, als glaubte er, Fielding habe einen Grund gehabt, es Mrs. Donahue zu sagen. Allerdings kann ich mir auch nicht annähernd keinen denken. Außer Marino hat mit seiner Bemerkung von vorhin recht gehabt, Fielding lege es darauf an, dass ich meinen Job verlöre.
»Wir beide kennen die Antwort.« Mein selbstbewusster Tonfall macht mir klar, was ich Jack Fielding alles zutraue. »Soweit ich weiß, ist in den Nachrichten nichts darüber gekommen. Und selbst wenn Mrs. Donahue es so erfahren hat, hat ihr das doch keinen Hinweis auf die Hecknummer von Lucys Helikopter geliefert. Auch nicht darauf, dass ich mit einem Helikopter in Hanscom landen werde und wann.«
Als Benton weiter in Richtung Cambridge fährt, tobt draußen ein Schneesturm. Die Flocken werden kleiner, und ein böiger Wind peitscht das Auto und bringt es zum Schwanken. Die Nacht ist wechselhaft und trügerisch.
»Nur, dass der Fahrer dich mit mir verwechselt hat«, füge ich hinzu. »Das habe ich daran erkannt, wie er dich behandelt hat. Er hat dich für Dr. Scarpetta gehalten. Dabei muss Johnny Donahues Mutter doch wissen, dass ich kein Mann bin.«
»Schwer zu sagen, was sie weiß«, erwidert Benton. »In diesem Fall ist Fielding der zuständige Rechtsmediziner, nicht du. Wie du bereits angemerkt hast, hast du nichts damit zu tun. Offiziell bist du nicht verantwortlich.«
»Als Chief Medical Examiner bin ich letztlich immer verantwortlich. Im Grunde genommen fallen alle Autopsien in Massachusetts in meine Zuständigkeit. Also habe ich doch etwas damit zu tun.«
»So habe ich es nicht gemeint, aber ich bin froh, dass du es selbst aussprichst.«
Natürlich hat er das nicht gemeint. An das, was er mir wirklich sagen wollte, möchte ich lieber gar nicht denken. Ich war fort. Man hat von mir erwartet, in Dover zu sein und gleichzeitig in Abwesenheit das CFC an den Start zu bringen. Vielleicht war das zu viel verlangt. Vielleicht hat man mein Scheitern von vornherein mit eingeplant.
»Das soll heißen, dass du seit der Eröffnung des CFC von der Bildfläche verschwunden warst«, fährt Benton fort. »Verschwunden in der Nachrichtensperre.«
»Absichtlich«, entgegne ich. »Beim Rechtsmedizinischen Institut des Militärs hält man nicht viel von Öffentlichkeitsarbeit.«
»Natürlich war es absichtlich. Ich mache dir keinen Vorwurf.«
»Briggs’ Absicht.« Ich spreche das aus, worauf Benton vermutlich hinauswill.
Er traut Briggs nicht über den Weg. Das hat er noch nie. Ich habe es bis jetzt immer auf Eifersucht geschoben. Briggs ist ein sehr mächtiger und gefährlicher Mann, während Benton sich seit seinem Abschied vom FBI weder mächtig noch gefährlich gefühlt hat. Außerdem haben Briggs und ich eine gemeinsame Vergangenheit. Er ist einer der wenigen Menschen in meinem Leben, die ich schon länger kenne als Benton.
»Der AFME wollte nicht, dass du Interviews zum Thema CFC gibst oder öffentlich über irgendwelche Vorgänge in Dover sprichst, ehe das Institut nicht eröffnet war und du deinen Lehrgang beendet hattest«, fügt Benton hinzu. »Deshalb hast du eine geraume Weile nicht im Rampenlicht gestanden. Ich überlege gerade, wann du zuletzt bei CNN aufgetreten bist. Es ist mindestens ein Jahr her.«
»Zufälligerweise sollte ich heute Abend zum ersten Mal wieder vor die Kamera. Und genauso zufällig wurde der Termin bei CNN abgesagt. Er ist schon zum dritten Mal abgesagt worden, ebenso wie sich meine Rückkehr immer wieder verschoben hat.«
»Ja. Ziemlich viele Zufälle.«
Möglicherweise sägt Briggs ja ganz bewusst an meinem Ast. Es wäre doch ein toller Trick, mich auf eine wichtigere Aufgabe, die wichtigste in meinem bisherigen Leben, vorzubereiten und mich gleichzeitig systematisch unsichtbar zu machen. Mich zum Schweigen zu bringen. Mich letztlich loszuwerden. Allein die Vorstellung ist erschreckend. Ich fasse es nicht.
»Du musst herauskriegen, wer diese Zufälle arrangiert hat«, verkündet Benton. »Damit will ich nicht behaupten, dass Briggs unser Machiavelli ist. Er ist nicht das Pentagon an sich, sondern nur ein Rädchen in einem sehr großen Getriebe.«
»Ich weiß, wie sehr du ihn verabscheust.«
»Es ist der Apparat, den ich verabscheue. Aber er wird immer da sein. Du musst nur dafür sorgen, dass du ihn durchschaust, um nicht von ihm vereinnahmt zu werden.«
Schnee prasselt gegen die Windschutzscheibe, während wir vorbei an offenen Feldern und durch dichte Wälder fahren. Rechts von uns fließt ein Bach dicht an der Leitplanke vorbei, als wir eine Brücke überqueren. Sicher ist die Luft kälter hier. Die Schneeflocken sind klein und gefroren, und das Wetter ändert sich alle paar Meter, was ich ziemlich beunruhigend finde.
»Mrs. Donahue ist darüber im Bilde, dass der Chief Medical Examiner und Leiter des CFC, ein Mensch namens Dr. Scarpetta, Jacks Boss ist«, meint Benton. »Das muss so sein, denn sie hat sich immerhin die Mühe gemacht, dir etwas per Boten zu schicken. Aber vielleicht ist das ja alles, was sie weiß«, fasst er zusammen.
»Lass uns das Ding anschauen.« Ich will das Kuvert.
»Es gehört ins Labor.«
»Sie weiß, dass ich Jacks Boss bin, denkt aber, ich sei ein Mann.« Das klingt absurd, ist jedoch möglich. »Sie hätte mich nur zu googeln brauchen.«
»Es gibt auch Leute, die nicht googeln.«
Ich halte mir vor Augen, wie leicht ich vergesse, dass auf dieser Welt noch immer Menschen leben, die nicht auf dem neuesten Stand der Technik sind – selbst solche, die einen Chauffeur beschäftigen und einen Bentley besitzen. Die Rücklichter des Wagens sind weit vor uns auf der schmalen, zweispurigen Straße zu sehen. Sie werden immer kleiner und entfernen sich.
»Hast du dem Chauffeur deinen Ausweis gezeigt?«, frage ich.
»Was glaubst du?«
Natürlich würde Benton so etwas nicht tun. »Also hat er keinen Verdacht geschöpft, dass du nicht ich sein könntest.«
»Ich habe ihn in dem Glauben gelassen.«
»Wahrscheinlich wird Mrs. Donahue jetzt weiterhin denken, dass Jack für einen Mann arbeitet. Merkwürdig, dass Jack ihr zwar erklärt hat, wie man mich findet, allerdings ohne einen Hinweis, woran der Fahrer mich erkennen kann. Er hätte ihr wenigstens mitteilen können, dass ich eine Frau bin. Offenbar hat er sich sogar die verräterischen Pronomen gespart. Wirklich eigenartig. Keine Ahnung, warum.« Unsere Theorie überzeugt mich nicht. Ich finde sie irgendwie nicht plausibel.
»Mir war gar nicht klar, dass du solche Zweifel an Jack hast. Nicht, dass sie nicht gerechtfertigt wären.« Benton versucht, mir etwas zu entlocken. Das ist der FBI-Agent in ihm. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr so erlebt.
»Ich hatte, was ihn angeht, nur mein übliches Bauchgrimmen und habe wie immer die Augen vor den Problemen verschlossen«, antworte ich. »Die Informationen reichten nicht, um sich mehr Sorgen zu machen als sonst.« Auf diese Weise möchte ich Benton auffordern, mir die fraglichen Informationen zu geben, falls er sie besitzt. Du musst vor mir keine Geheimnisse haben.
Aber er hat sie. Schweigend starrt er geradeaus, so dass sich sein Profil scharf von der Armaturenbrettbeleuchtung abhebt. So ist es bei uns schon immer. Am Anfang unserer Beziehung stand ein Ehebruch, denn Benton war damals mit einer anderen Frau verheiratet. Wir wissen beide, wie man seine Mitmenschen täuscht. Ich bin nicht stolz darauf und wünschte, es wäre beruflich nicht nötig. Insbesondere nicht in diesem Augenblick. Benton übt sich in Heimlichtuerei, während ich die Wahrheit hören will. Und muss.
»Schau, wir beide wissen, wie er ist. Und ja, ich war seit der Eröffnung des CFC untergetaucht«, fahre ich fort. »Ich war in einer anderen Welt und habe mein Bestes getan, um alles aus der Entfernung zu organisieren und gleichzeitig achtzehn Stunden am Tag zu schuften. Ich hatte nicht einmal Zeit, mit meinen Mitarbeitern zu telefonieren. Wir haben nur elektronisch kommuniziert und E-Mails und PDF-Dateien ausgetauscht. Gesehen habe ich kaum jemanden. Ich hätte Jack unter diesen Umständen niemals die Leitung übertragen dürfen. Indem ich ihn wieder eingestellt und dann die Stadt verlassen habe, habe ich uns allen genau die Suppe eingebrockt, die wir jetzt auslöffeln müssen. Du hast mich gewarnt, und du warst nicht der Einzige.«
»Du wolltest einfach nicht sehen, dass dieser Mann ein ernsthaftes Problem darstellt«, merkt Benton in einem Tonfall an, der mich noch mehr aus dem Konzept bringt. »Obwohl du ausreichend Erfahrung mit ihm gemacht hast. Wenn wir uns mit einer Sache nicht abfinden können, weil sie unerträglich für uns ist, werden alle Beweise der Welt nichts daran ändern. Du schaffst es nicht, ihm gegenüber objektiv zu sein, Kay, und ich bin nicht sicher, ob ich den Grund verstehe.«
»Du hast recht, und ich ärgere mich über mich selbst.« Ich räuspere mich, damit meine Stimme zu zittern aufhört. »Und es tut mir leid.«
»Ich weiß nur nicht, ob ich je dahinterkommen werde.« Benton wirft mir einen Seitenblick zu. Er hat beide Hände am Steuer. Wir sind allein auf einer verschneiten, schlechtbeleuchteten Straße und fahren durch die winterliche Dunkelheit. Der Bentley vor uns ist nicht mehr zu sehen. »Ich verurteile dich nicht.«
»Er setzt sein Leben in den Sand und braucht mich jetzt wieder.«
»Es ist nicht deine Schuld, dass er sein Leben in den Sand setzt, außer du verschweigst mir etwas. Aber eigentlich wäre es auch in diesem Fall nicht dein Fehler. Menschen ruinieren ihr Leben nämlich selbst. Sie haben dazu keine Hilfe nötig.«
»Das stimmt nicht ganz. Was ihm als Kind zugestoßen ist, hat er sich nicht ausgesucht.«
»Auch das ist nicht deine Schuld«, wendet Benton ein, als wüsste er mehr über Fieldings Vergangenheit als die wenigen Einzelheiten, die ich kenne und ihm anvertraut habe. Ich habe stets darauf geachtet, meine Mitarbeiter, insbesondere Fielding, nicht auszuhorchen. Denn ich bin gut genug über die Tragödien seiner Jugendjahre im Bilde, um zu erspüren, worüber er nicht sprechen möchte.
»Mir ist klar, wie dumm das klingt«, füge ich hinzu.
»Nicht dumm. Es ist nur ein Drama, das immer wieder dasselbe Ende nehmen wird. Ich habe nie ganz begriffen, warum du dich verpflichtet fühlst, dabei mitzuspielen. Außerdem habe ich den Eindruck, dass etwas geschehen ist. Etwas, das du mir nie erzählt hast.«
»Ich erzähle dir alles.«
»Wir wissen, dass das für uns beide nicht stimmt.«
»Vielleicht sollte ich mich einfach an die Toten halten.« Ich höre, wie verbittert ich klinge. Der Widerwille sickert durch die Barrieren, die ich den Großteil meines Lebens so sorgfältig errichtet habe. Vielleicht habe ich ja verlernt, ohne sie zu existieren.
»Sag so etwas nicht«, erwidert Benton leise.
»Mit Jack wird es keine Schwierigkeiten mehr geben. Dieses Drama ist vorbei, das verspreche ich dir. Vorausgesetzt, er hat es nicht schon selbst beendet, indem er seinen Job hingeworfen hat. Das hat er nämlich schon öfter getan. Er muss gefeuert werden.«
»Er ist nicht du, war es nie und wird es auch niemals sein. Außerdem ist er nicht dein Kind, verdammt.« Benton hält die Lage für einfacher, als sie ist.
»Ich muss ihm kündigen«, beharre ich.
»Er ist ein sechsundvierzigjähriger Rechtsmediziner, der weder das in ihn gesetzte Vertrauen verdient hat noch sonst irgendetwas, das du für ihn tust.«
»Du bist also fertig mit ihm.«
»Du bist fertig mit ihm. Ich fürchte, es stimmt, und du wirst ihm kündigen müssen«, sagt Benton, als wäre die Entscheidung bereits gefallen und läge nicht bei mir. »Weshalb hast du so ein schlechtes Gewissen?« In seinem Tonfall und Verhalten ist etwas, das ich nicht zu fassen bekomme. »Damals in Richmond, als du angefangen hast, mit ihm zusammenzuarbeiten. Warum das schlechte Gewissen?«
»Tut mir leid, dass ich so viele Probleme verursache«, weiche ich seiner Frage aus. »Ich habe das Gefühl, alle enttäuscht zu haben. Entschuldige, dass ich nicht hier war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich es bedaure. Ich übernehme die Verantwortung für Jack und lasse nicht zu, dass es so weitergeht.«
»Für manche Dinge solltest du nicht die Verantwortung übernehmen. Du kannst nichts dagegen tun, und ich werde dich immer wieder daran erinnern. Aber wahrscheinlich wirst du trotzdem glauben, dass es deine Schuld ist«, verkündet mein Mann, der Psychologe.
Ich möchte nicht erörtern, was meine Schuld ist und was nicht, weil ich nicht darüber reden kann, warum ich so unvernünftig bin, Jack Fielding weiter die Treue zu halten. Als ich aus Südafrika zurückkam, war Jack Fielding meine Buße. Er verkörperte die sozialen Arbeitsstunden, zu denen ich mich zur Strafe verurteilt hatte. Verzweifelt sehnte ich mich danach, ihm etwas Gutes zu tun, weil ich überzeugt war, allen anderen Schaden zugefügt zu haben.
»Ich schaue es mir an.« Damit meine ich den Inhalt von Bentons Jackentasche. »Ich kann einen Brief lesen, ohne Spuren zu zerstören, und ich muss wissen, was Mrs. Donahue mir geschrieben hat.«
Vorsichtig hole ich den Umschlag heraus und halte ihn an den Ecken fest. Ich stelle fest, dass die Lasche mit grauem Isolierband zugeklebt ist, das eine in altmodischer Fraktur eingeprägte Adresse zum Teil verdeckt. Die Straße liegt im Bostoner Stadtteil Beacon Hill unweit des Public Garden und ganz in der Nähe des Backsteinhauses, das Benton und ich früher besessen haben und das sich schon seit Generationen im Besitz seiner Familie befand. Vorn auf dem Kuvert steht in geschwungenen, mit Tinte geschriebenen Buchstaben Dr. Kay Scarpetta: Vertraulich. Ich achte darauf, nichts mit bloßen Händen zu berühren, insbesondere nicht das Klebeband, das eine ausgezeichnete Quelle für Fingerabdrücke, DNA und mikroskopische Spuren ist. Auf porösen Flächen wie Papier kann man latente Fingerspuren durch Chemikalien wie Ninhydrin sichtbar machen. Ich überlege.
»Hast du ein Messer zur Hand?« Ich lege den Umschlag auf meinen Schoß. »Und ich muss mir deine Handschuhe ausleihen.«
Benton greift über mich hinweg und öffnet das Handschuhfach, in dem ein Leatherman-Multifunktionsmesser, eine Taschenlampe und ein Bündel Servietten liegen. Dann nimmt er ein Paar Hirschlederhandschuhe aus den Jackentaschen. Meine Hände versinken zwar darin, aber ich möchte weder meine Fingerabdrücke hinterlassen noch die einer anderen Person verwischen. Da die Sicht nach draußen so schlecht ist und immer mehr abnimmt, schalte ich die Lampe zum Lesen von Landkarten nicht an. Stattdessen leuchte ich mit der Taschenlampe und stecke eine kleine Klinge in eine Ecke des Kuverts.
Nachdem ich den Umschlag oben aufgeschlitzt habe, hole ich zwei gefaltete cremefarbene Briefpapierbogen heraus. Sie sind von hoher Qualität und mit einem Wasserzeichen versehen. Ich kann nicht genau erkennen, was es darstellt. Offenbar ein Emblem oder Familienwappen. Im Briefkopf steht dieselbe Adresse in Beacon Hill. Die beiden Seiten sind mit der Schreibmaschine in einer Kursivschrift getippt worden, wie ich sie schon seit Jahren, vielleicht seit einem Jahrzehnt, nicht mehr gesehen habe. Ich lese den Brief laut vor.
Dr. Scarpetta,
hoffentlich können Sie mir diese in Ihren Augen sicherlich unpassende und aufdringliche Geste meinerseits verzeihen. Doch ich bin eine Mutter und so verzweifelt, wie eine Mutter es nur sein kann.
Mein Sohn Johnny hat ein Verbrechen gestanden, das er meines Wissens nach nicht begangen hat und auch nicht hat begehen können. Zugegeben, er hatte in jüngster Zeit Schwierigkeiten, weshalb wir für ihn ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Dennoch hat er nie ernsthafte Verhaltensstörungen gezeigt, nicht einmal, als er als schüchterner und schikanierter Fünfzehnjähriger das Studium in Harvard aufnahm. Falls er zu Nervenzusammenbrüchen neigen sollte, hätte es meiner Ansicht nach damals geschehen müssen. Schließlich war er das erste Mal von zu Hause fort und besaß nicht die üblichen gesellschaftlichen Fähigkeiten, um Kontakt mit seinen Mitmenschen zu knüpfen und Freunde zu finden. Bis zum vergangenen Herbstsemester seines letzten Studienjahres schlug er sich erstaunlich wacker, bis sich seine Persönlichkeit dramatisch veränderte. Aber er hat niemanden ermordet!
Dr. Benton Wesley, Berater beim FBI und Beschäftigter des McLean Hospital, weiß sehr viel über die Vergangenheit und die Entwicklungsschwierigkeiten meines Sohnes und hat vielleicht die Möglichkeit, diese Einzelheiten mit Ihnen zu erörtern, da er offenbar nicht dazu bereit war, mit Ihrem Assistenten Dr. Fielding darüber zu sprechen. Johnnys Geschichte ist lang und kompliziert, und ich hielte es für wichtig, dass Sie sie sich anhören. Ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, dass er am vergangenen Montag ins McLean eingeliefert wurde, da man ihn als Gefahr für sich selbst eingestuft hat. Er hatte niemandem Schaden zugefügt und auch keine derartigen Absichten geäußert. Dann, aus heiterem Himmel, gestand er plötzlich ein so grausames und entsetzliches Verbrechen und wurde daraufhin sofort in die geschlossene Abteilung für geisteskranke Straftäter verlegt. Jetzt frage ich Sie, wie es möglich ist, dass die Behörden seinen albernen und wirren Geschichten so schnell Glauben schenken konnten.
Ich muss mit Ihnen sprechen, Dr. Scarpetta. Ich weiß, dass Ihr Institut die Obduktion des kleinen Jungen, der in Salem starb, durchgeführt hat, und halte es für vernünftig, eine zweite Meinung einzuholen. Sicher ist Ihnen bekannt, dass es sich bei dem Mord laut Dr. Fieldings Untersuchungsergebnissen um eine vorsätzliche, sorgfältig geplante und kaltblütige Hinrichtung, den Initiationsritus einer satanistischen Sekte, handelte. Eine derartige Gräueltat passt überhaupt nicht zu dem üblichen Umgang meines Sohnes mit anderen Menschen. Außerdem hatte er noch nie Kontakt mit irgendwie gearteten Sekten. Es ist eine empörende Unterstellung, dass seine Schwäche für Bücher und Filme, die Horror, das Übernatürliche oder Gewalt zum Thema haben, ihn dazu verleitet haben könnten, diese Neigung »auszuleben«.
Johnny leidet am Asperger-Syndrom. Er ist in manchen Bereichen außergewöhnlich begabt, in anderen hingegen völlig überfordert. Er hat sehr starre Gewohnheiten und Verhaltensmuster, von denen er niemals abweicht. Am 30. Januar war er wie jeden Samstagvormittag zwischen zehn und eins mit der Person, die ihm am nächsten steht, einer ausgesprochen intelligenten Doktorandin namens Dawn Kincaid, im Bisquit beim Brunch. Deshalb hat er am frühen Nachmittag, als der arme kleine Junge getötet wurde, unmöglich in Salem sein können.
Johnny verfügt über die bemerkenswerte Fähigkeit, sich auch die unwichtigste Kleinigkeit merken und sie nachplappern zu können. Deshalb steht für mich fest, dass seine Aussage gegenüber den Behörden direkt mit dem zusammenhängt, was man ihm über den Fall erzählt hat und was in den Nachrichten berichtet wurde. Anscheinend hält er sich (aus für mich unerfindlichen Gründen) wirklich für schuldig und behauptet sogar, eine »Stichwunde« an seiner linken Hand rühre daher, dass die Nagelpistole losgegangen sei, als er den kleinen Jungen damit beschossen habe. Natürlich ist das frei erfunden. Er hat sich die Verletzung selbst zugefügt, und zwar mit einem Steakmesser, einer der vielen Gründe, warum wir ihn überhaupt ins McLean gebracht haben. Offenbar ist mein Sohn fest entschlossen, sich für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, schwer bestrafen zu lassen, und wie es aussieht, wird sein Wunsch in Erfüllung gehen.
Nachfolgend finden Sie die Nummern, unter denen Sie mich erreichen können. Ich hoffe, dass Sie Verständnis für meine Lage haben und sich baldmöglichst mit mir in Verbindung setzen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Erica Donahue