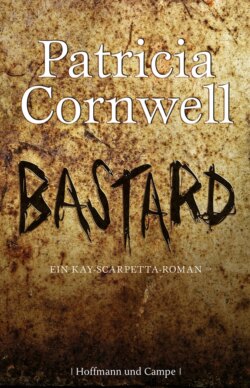Читать книгу Bastard - Patricia Cornwell - Страница 9
3
ОглавлениеIch bemerke, dass der Transporter stehengeblieben ist. Marino und Lucy steigen aus. Wir parken vor der John B. Wallace Civil Air Facility. Ich bleibe sitzen und beobachte weiter die Geschehnisse auf dem Bildschirm des iPads, während Lucy und Marino anfangen, meine Sachen auszuladen.
Kalte Luft weht durch die offene Heckklappe herein. Ich frage mich, warum der Mann beschlossen hat, Sock in Norton’s Woods auszuführen, beinahe in Somerville. Weshalb ausgerechnet hier und nicht in der Nähe seiner Wohnung? War er mit jemandem verabredet? Ein schwarzes Eisentor füllt den Bildschirm. Es steht einen Spalt offen, und seine Hand öffnet es weiter. Ich bemerke, dass er dicke schwarze Handschuhe angezogen hat, die wie Motorradhandschuhe aussehen. Friert er an den Händen, oder hat er andere Gründe? Womöglich hat er doch üble Absichten. Vielleicht plant er ja, die Pistole zu benutzen. Ich stelle mir vor, wie er den Schlitten einer 9-Millimeter-Pistole zurückschiebt und abdrückt. Mit dicken Handschuhen an den Händen? Es ergibt keinen Sinn.
Ich höre, dass er die Plastiktüte aufschüttelt. Als er nach unten schaut, sehe ich sie und erhasche einen Blick auf einen Gegenstand, der offenbar eine winzige Holzschachtel ist. Zur Aufbewahrung von Marihuana, denke ich. Einige dieser Schachteln bestehen aus Zedernholz und sind sogar mit einem winzigen Hygrometer ausgestattet, wie ein Humidor. Mir fällt die bernsteinfarbene Glaspfeife auf dem Schreibtisch in seiner Wohnung ein. Vielleicht führt er seinen Hund gern in Norton’s Woods aus, weil der Park abgelegen und für gewöhnlich menschenleer ist. Außerdem ist er für die Polizei kaum von Interesse, wenn sich nicht gerade ein Prominenter hier aufhält oder eine wichtige Veranstaltung stattfindet, so dass Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden. Vielleicht kommt er ja gern hierher, um einen Joint zu rauchen. Er pfeift Sock heran, bückt sich und nimmt ihm die Leine ab. »Na, alter Junge, kennst du unser Plätzchen noch? Zeig mir unser Plätzchen«, höre ich ihn sagen. Er fügt noch etwas hinzu, allerdings so gedämpft, dass ich es nicht richtig verstehe. Es klingt wie »Und für dich«, gefolgt von »Möchtest du eins schicken …?« oder »Wirst du eins schicken …?«. Auch nach zweimaligem Abspielen weiß ich noch immer nicht, was er meint. Vermutlich liegt es daran, dass er sich vorbeugt und in den Kragen seiner Jacke spricht.
Mit wem redet er? Ich kann niemanden in der Nähe erkennen. Nur den Hund und die behandschuhten Hände. Dann wechselt die Kameraeinstellung. Der Mann richtet sich auf, und ich habe wieder Blick auf den Park: Bäume, Bänke und auf der einen Seite ein gepflasterter Weg, der an dem Gebäude mit dem grünen Dach entlangführt. Ich erkenne auch einige Personen und schließe aus ihren dicken Wintersachen, dass sie keine Hochzeitsgäste sind, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach im Park spazieren gehen wie der Mann. Sock trottet ins Gebüsch, um seine Notdurft zu verrichten, während sein Herr weiter in den idyllischen, von alten Ulmen und grünen Bänken geprägten Park hineinschlendert.
Er pfeift. »Hey, alter Junge, komm mit.«
An den schattigen Stellen und rings um die Rhododendronbüsche liegt tiefer, von totem Laub, Steinen und zerbrochenen Zweigen durchsetzter Schnee, der in mir morbide Gedanken an heimlich verscharrte Leichen, abgelöste Haut und verwitterte, abgenagte und verstreute Knochen wachruft. Der Mann beobachtet, schaut sich um, und die versteckte Kamera richtet sich auf das aus drei Schichten bestehende grüne Metalldach des Gebäudes aus Glas und Holz, das ich von der Sonnenterrasse von meinem und Bentons Haus aus sehen kann. Als der Mann sich umdreht, erkenne ich im Erdgeschoss eine Tür, die ins Freie führt. Die Kamera nimmt eine grauhaarige Frau auf, die vor dieser Tür steht. Sie trägt ein Kostüm und einen langen braunen Ledermantel und telefoniert.
Der Mann pfeift. Seine Schritte knirschen auf dem mit Granitkieseln bestreuten Pfad, als er zu Sock hinübergeht, um die Hinterlassenschaft des Hundes einzusammeln. I get so lost, sometimes days pass and this emptiness fills my heart …, singt Peter Gabriel. Ich erinnere mich an den jungen Soldaten mit demselben Namen, der in seinem Humvee verbrannt ist, und rieche ihn, als hätte sich sein Gestank tief im Inneren meiner Nase gehalten. Dann denke ich an seine Mutter und ihre Trauer und Wut am Telefon, als sie mich heute Morgen anrief. Rechtsmediziner kann zuweilen ein undankbarer Beruf sein, denn hin und wieder behandeln mich die Hinterbliebenen, als ob ich den Tod ihres geliebten Angehörigen persönlich verschuldet hätte. Ich versuche mir das vor Augen zu halten. Du bist nicht gemeint.
Die behandschuhten Hände schütteln wieder die Plastiktüte aus. Es ist eine, wie man sie auf dem Markt bekommt. Und dann geschieht etwas. Die Hand des Mannes fährt zu seinem Kopf, und ich höre ein Klappern, als sie gegen den Kopfhörer prallt. Es ist, als wollte er nach etwas schlagen. »Was zum …? Hey …!«, ruft er atemlos und erschrocken. Vielleicht ist es auch ein Schmerzensschrei. Aber ich kann nichts und niemanden sehen. Nur Wald und einige Gestalten in der Ferne, allerdings weder Mann noch Hund. Ich spule die Aufnahme zurück und spiele sie noch einmal ab. Unvermittelt erscheint seine schwarz behandschuhte Hand im Bild, und er stößt die Worte »Was zum …? Hey …!« hervor. Ich komme zu dem Schluss, dass er überrascht und verärgert klingt, so als hätte ihn etwas getroffen, dass ihm die Luft wegbleibt.
Wieder spiele ich das Video ab und spitze die Ohren. Meiner Ansicht nach ist sein Tonfall empört, vielleicht ein wenig ängstlich, ja, und Schmerzen sind auch dabei, wie bei einem Menschen, der auf einem belebten Gehweg mit dem Ellbogen gestoßen oder heftig angerempelt wird. Im nächsten Moment wirbeln die Wipfel der Bäume um ihn herum. Schiefersplitter kommen ins Bild und werden größer, als der Mann mit einem dumpfen Geräusch auf den Pfad fällt. Entweder liegt er auf dem Rücken, oder er hat den Kopfhörer verloren. Auf dem Bildschirm erscheinen kahle Äste und ein grauer Himmel. Dann rauscht der Saum eines langen schwarzen Mantels vorbei, als jemand schnell davongeht. Erneut ein lautes, scharrendes Geräusch, und das Bild wechselt noch einmal. Kahle Äste und ein grauer Himmel, allerdings andere Äste, die durch die Ritzen einer grünen Bank zu erkennen sind. Alles geschieht sehr schnell.
Unbeschreiblich schnell. Die Stimmen und Geräusche von Menschen werden lauter.
»Jemand soll einen Krankenwagen rufen!«
»Ich glaube, er atmet nicht mehr.«
»Ich habe kein Telefon dabei. Ruf du den Krankenwagen!«
»Hallo? Es hat … äh, ja, in Cambridge. Ja, Massachusetts. Herrgott! Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich. Das ist ja nicht zu fassen! Ja, ja, ein Mann. Er ist zusammengebrochen und atmet offenbar nicht mehr … Norton’s Woods, an der Ecke Irving Street und Bryant … Ja, jemand versucht es mit Herzmassage. Ich bleibe am Apparat … Ich bleibe dran. Ja, ich meine, ich weiß nicht … Sie will wissen, ob er immer noch nicht atmet. Nein, nein, er atmet nicht! Er bewegt sich nicht! Ich habe nicht gesehen, wie es passiert ist. Als ich mich umgedreht habe, lag er auf dem Boden. Ganz plötzlich.«
Ich drücke auf Pause und steige aus. Es ist kalt und sehr windig, als ich in den Terminal haste. Es ist ein kleines Gebäude mit Toiletten, einem Sitzbereich und einem alten Fernsehgerät, das gerade eingeschaltet ist. Ich sehe mir eine Weile die Nachrichten auf Fox an und spule dabei das Video auf dem iPad vor, während Lucy am Empfangstisch lehnt und mit einer Kreditkarte die Landegebühr bezahlt. Inzwischen bin ich sicher, dass der Kopfhörer, die Kamera nach oben gerichtet, unter einer Bank gelandet ist. Das XM-Radio spielt Dark lady laughed and danced and lit the candles one by one … Die Musik ist jetzt lauter, weil der Kopfhörer nicht mehr am Kopf des Mannes anliegt. Es ist ziemlich absurd, Cher singen zu hören.
Stimmen, sie klingen drängend und aufgeregt. Ich höre Schritte und das entfernte Heulen einer Sirene. Unterdessen plaudert meine Nichte mit einem älteren Mann, einem Kampfpiloten im Ruhestand, der nun, wie er ihr bereitwillig erläutert, in Teilzeit im Verwaltungsgebäude des Flugplatzes arbeitet.
»… in Vietnam. Das wäre dann eine F-4 gewesen, richtig?«, meint Lucy.
»Ja, und eine Tomcat. Das war die letzte Maschine, die ich geflogen habe. Aber die Phantom war noch bis in die achtziger Jahre im Einsatz. Wenn man sie richtig wartet, sind sie nicht kaputtzukriegen. Schauen Sie sich nur an, wie lange es die C-5 schon gibt. In Israel haben sie, glaube ich, noch immer ein paar Phantom. Vielleicht auch im Iran. Die, die in den USA noch übrig sind, verwendet man als unbemannte Maschinen, als Drohnen. Ein tolles Flugzeug. Haben Sie je eins gesehen?«
»In Belle Chasse, Louisiana, auf dem Luftstützpunkt der Marine. Ich war mit meinem Helikopter dort, um nach dem Wirbelsturm Katrina zu helfen. Man hat bei der Orkanbekämpfung versucht, mit einer Phantom ins Auge des Hurrikans hineinzufliegen.« Der Mann nickt.
Der Bildschirm des iPads wird schwarz. Der Kopfhörer hat nichts mehr aufgezeichnet. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass er ein Stück entfernt unter der Bank gelandet ist, als der Mann zu Boden stürzte. Der Bewegungsmelder hat nicht mehr genug Aktivität aufgefangen und ihn deshalb in den Ruhezustand versetzt. Das wundert mich. Auf welche Weise genau hat der Mann den Kopfhörer verloren, und wie ist das Gerät unter die Bank geraten? Vielleicht wurde es von jemandem mit dem Fuß weggestoßen. Entweder zufällig von einem Helfer oder absichtlich von dem Menschen, der den Toten ausspioniert hat. Ich denke an den vorbeirauschenden Saum des schwarzen Mantels und spule in Etappen weiter vor. Dabei nehme ich eine Einstellung nach der anderen unter die Lupe und spitze die Ohren. Doch bis 16 Uhr 37 bleibt es still. Plötzlich fangen Bäume und Himmel an, wild zu schwanken, große, nackte Hände füllen den Bildschirm, und Papier knistert, als der Kopfhörer in einer braunen Tüte verstaut wird. »… auf jeden Fall die Colts«, verkündet eine Stimme. »Die Saints können einpacken. Sie haben …« Dann wird es dunkel. Die Stimmen werden leiser. Schließlich Schweigen.
Ich entdecke die Fernbedienung auf der Armlehne eines der Sofas im Terminal, schalte auf CNN, sehe mir die Nachrichten an und lese das am unteren Bildschirmrand mitlaufende Schriftband. Marino kommt aus der Toilette und tut, als bemerke er mich nicht. Entweder schmollt er, oder er bereut seinen Fehler und ist verlegen. Ich will ihm nicht verzeihen, dass er Briggs das Video gemailt und dass er überhaupt mit ihm gesprochen hat. Wenn ich Marino ausnahmsweise einmal nicht verzeihe, lernt er vielleicht endlich etwas daraus. Allerdings ist mein Problem, dass es mir nie gelingt, ihm oder anderen Menschen, die mir etwas bedeuten, ernsthaft böse zu sein. Katholische Schuldgefühle. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich werde schon wieder weich, und meine Entschlossenheit schwindet. Ich kann es förmlich spüren, während ich, auf der Suche nach Nachrichten, die sich womöglich schädlich auf das CFC auswirken, durch die Sender schalte. Marino geht zu Lucy hinüber und kehrt mir den Rücken zu.
Ich wende mich vom Fernseher ab. Für den Moment bin ich überzeugt, dass die Medien nichts von der Leiche ahnen, die mich in meinem Autopsiesaal in Cambridge erwartet. Eine Sensation wie diese würde sicher Schlagzeilen machen, sage ich mir. Mein iPhone würde heißlaufen. Briggs hätte bestimmt schon davon gehört und sich dazu geäußert. Selbst Fielding hätte mich darauf aufmerksam gemacht. Nur dass Fielding sich noch immer nicht bei mir gemeldet hat. Wieder versuche ich ihn anzurufen. Er geht nicht ans Mobiltelefon und ist auch nicht im Büro. Natürlich nicht. So lange arbeitet er nämlich nie. Also wähle ich seine Privatnummer in Concord und erreiche wieder nur den Anrufbeantworter.
»Jack? Ich bin es, Kay.« Ich hinterlasse ihm noch einmal eine Nachricht. »Wir starten gleich in Dover. Könntest du mir eine SMS oder E-Mail mit den neuesten Erkenntnissen schicken? Wie ich annehme, hat Ermittler Law nicht zurückgerufen. Wir warten noch immer auf die Fotos. Hast du Informationen über einen vermissten Hund, einen Greyhound? Er gehörte dem Opfer, heißt Sock und wurde zuletzt in Norton’s Woods gesehen.« Meine Stimme klingt angespannt. Fielding geht mir aus dem Weg, und das nicht zum ersten Mal. Er ist ein Meister darin, spurlos zu verschwinden, was nicht weiter verwundert, denn schließlich hat er es schon oft genug getan. »Gut, dann versuche ich es nach der Landung wieder. Wahrscheinlich erwartest du uns im Büro so gegen halb zehn oder zehn. Ich habe Anne und Ollie Nachrichten geschickt. Könntest du dich vielleicht darum kümmern, dass sie auch da sind? Wir müssen das noch heute Nacht erledigen. Wärst du außerdem so gut, dich bei der Polizei von Cambridge nach dem Hund zu erkundigen? Sicher hat er einen Mikrochip …«
Es klingt albern, dass ich mich in das Thema Sock verbeiße. Was zum Teufel soll Fielding über den Hund wissen? Er hat sich ja nicht einmal die Mühe gemacht, persönlich zum Tatort zu fahren. Und Marino hat recht: Jemand hätte es tun sollen.
Lucys Bell 407 ist schwarz und hat getönte Heckscheiben. Während sie Türen und Gepäckraum aufschließt, peitscht ein Wind gegen die Rampe.
Ein Windsack zeigt steif nach Norden, wie ein waagerechter Verkehrskegel, was ein gutes und ein schlechtes Zeichen ist. Wir werden den Wind im Rücken haben, allerdings auch eine Schlechtwetterfront mit schweren Regenfällen, Schneeregen und Schnee. Marino fängt an, meine Sachen zu verstauen, während Lucy den Helikopter umrundet und Antennen, statische Stabilität, Rotoren, Notfloße, die Stickstoffflaschen, um sie aufzublasen, den Leitwerksträger aus Aluminiumlegierung, Getriebegehäuse, Hydraulikpumpe und Hydraulikbehälter überprüft.
»Wenn ihn jemand ausspioniert, ihn heimlich gefilmt und dann bemerkt hat, dass er tot ist, hat diese Person etwas mit der Sache zu tun«, sage ich unvermittelt zu ihr. »Wäre in diesem Fall nicht anzunehmen, dass der Betreffende die vom Kopfhörer aufgezeichneten Videos per Fernbedienung gelöscht oder sie wenigstens von Festplatte und SD-Karte beseitigt hätte? Würde so ein Mensch nicht sichergehen wollen, dass wir die Aufnahmen nicht finden, anstatt uns die Anhaltspunkte frei Haus zu liefern?«
»Kommt drauf an.« Lucy umfasst einen Griff am Rumpf, steckt die Fußspitze in eine eingebaute Stufe und klettert hinauf.
»Wenn du die Täterin wärst?«, beharre ich.
»Wenn ich die Täterin wäre?« Sie löst Schließen und Bolzen und öffnet eine Luke in der leichten Außenhaut aus Aluminium. »Solange ich sicher sein kann, dass nichts Wichtiges oder Belastendes aufgenommen wurde, würde ich nichts löschen.« Mit einer kleinen, aber starken SureFire-Taschenlampe untersucht sie Motor und Aufhängung.
»Warum nicht?«
Ehe sie antworten kann, nähert sich Marino. »Ich geh noch mal verschwinden«, sagt er zu niemandem im Besonderen. »Wenn sonst noch jemand muss, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.« Als ob er der Chefsteward wäre, der uns daran erinnert, dass es im Helikopter keine Toilette gibt. Offenbar möchte er bei mir um gut Wetter bitten.
»Danke, alles bestens«, antworte ich ihm. Er überquert die Rampe und kehrt zum Terminal zurück.
»Wenn ich die Täterin wäre, hätte ich nach dem Tod des Mannes Folgendes getan.« Lucy lässt den grellen Lichtstrahl weiter über Schläuche und Kabel gleiten und vergewissert sich, dass nichts locker oder beschädigt ist. »Ich hätte die Videos sofort heruntergeladen, indem ich mich in die Webcam einlogge. Und falls ich nichts Besorgniserregendes entdeckt hätte, hätte ich alles gelassen, wie es ist.«
Sie klettert noch ein Stück höher, um Hauptrotor, Mast und Taumelscheibe zu untersuchen. Ich warte, bis sie wieder unten ist. »Warum?«, frage ich dann.
»Überleg mal.«
Ich umrunde mit ihr den Helikopter, damit sie auf der anderen Seite hinaufsteigen und nach dem Rechten sehen kann. Sie scheint meine Fragen beinahe komisch zu finden, so als läge die Antwort auf der Hand.
»Wenn die Videos nach dem Tod des Opfers gelöscht werden, heißt das, dass wir es ganz sicher mit einem Verbrechen zu tun haben, richtig?«, stellt sie fest und leuchtet sorgfältig unter die Haube.
Danach springt sie hinunter auf die Rampe.
»Natürlich hat er die Filme nach seinem Tod nicht selbst löschen können«, meine ich erst jetzt, denn ich möchte sie nicht ablenken, damit sie sich beim Herumklettern auf dem Helikopter, insbesondere in der Nähe des Rotormasts, nicht noch verletzt. »Und deshalb würdest du die Videos nicht anrühren, falls du den Mann ausspioniert hättest und wüsstest, dass er tot ist oder dass du ihn selbst umgebracht hast.«
»Wenn ich ihn ausspioniert und verfolgt hätte, um ihn zu töten? Nein, natürlich nicht. Ich würde die letzten Videoaufnahmen auf der Festplatte belassen. Und den Kopfhörer würde ich auch nicht vom Tatort entfernen.« Wieder leuchtet sie mit der starken Taschenlampe den Rumpf ab. »Denn sicher haben ihn Leute im Park oder auf dem Weg dorthin mit dem Kopfhörer gesehen, weshalb man sich fragen würde, wo das Ding jetzt steckt. Es ist nämlich ziemlich groß und auffällig.«
Wir gehen um die Nase des Helikopters herum.
»Außerdem müsste ich mit dem Kopfhörer auch das Satellitenradio mitnehmen. Dazu wäre ich gezwungen, in seiner Jackentasche herumzuwühlen, um es herauszuholen. Das kostet Zeit und ist recht aufwendig, wenn er am Boden liegt. Und ich würde riskieren, dass mich jemand dabei beobachtet. Und was ist mit den älteren Dateien, die irgendwo gespeichert sind, vorausgesetzt, er wurde bereits seit einer Weile ausspioniert? Wie würden wir es uns erklären, wenn wir zu Hause auf seinem Computer oder auf einem Server Videos fänden, es jedoch nirgends ein Aufnahmegerät gibt? Kennst du den Spruch?« Sie öffnet eine Wartungsluke über dem Pitotrohr und leuchtet hinein. »Jedes Verbrechen zieht ein zweites nach sich. Auf die Tat selbst folgt der Versuch, sie zu vertuschen. Also ist es klüger, Kopfhörer und Videodateien nicht anzurühren und die Polizei oder Leute wie dich und mich in dem Glauben zu wiegen, er habe sich selbst gefilmt, was ja auch Marino annimmt. Doch ich bezweifle es.«
Sie schließt die Batterie wieder an. Ihre Begründung, warum sie sie abklemmt, sobald sie den Helikopter, ganz gleich wie lange, aus den Augen lässt, lautet, dass jemand ins Cockpit eindringen und mit ein wenig Glück durch Herumspielen an den Hebeln und Schaltern versehentlich den Motor starten könnte. Bei abgeklemmter Batterie ist das nicht möglich. Selbst wenn Lucy in Eile ist, führt sie vor dem Start eine gründliche Überprüfung durch, insbesondere falls der Helikopter unbewacht war, selbst auf einem Militärstützpunkt. Allerdings entgeht mir nicht, dass sie alles noch sorgfältiger untersucht als sonst. So, als hätte sie einen Verdacht oder ein ungutes Gefühl.
»Alles in Ordnung?«, frage ich sie. »Alles startklar?«
»Darüber vergewissere ich mich ja gerade«, entgegnet sie, und ich spüre, dass sie mich abwimmeln will. Sie hat Geheimnisse.
Lucy traut niemandem. Und das sollte sie auch nicht. Ich hätte einigen Leuten auch nicht trauen dürfen, und zwar von Anfang an. Menschen, die andere beeinflussen und belügen und vorgeben, es für eine gute Sache zu tun. Für eine richtige, gottgewollte oder gerechte Sache. Noonie Pieste und Joanne Rule wurden im Bett erstickt, vermutlich mit einem Kissen. Deshalb hat ihr Gewebe nicht auf die Verletzungen reagiert. Die sexuellen Übergriffe, die mit einer Machete und Glasscherben beigebrachten Schnittwunden, ja selbst das Fesseln an die Stühle – all das geschah erst nach ihrem Tod. Nach Ansicht der Verantwortlichen eine gottgewollte, gerechte Sache. Eine beispiellose Ungeheuerlichkeit, und sie sind ungeschoren davongekommen. Bis zum heutigen Tag wurden sie nicht zur Rechenschaft gezogen. Grüble nicht darüber nach. Schau nach vorn, nicht zurück.
Ich öffne die linke vordere Tür und klettere eine Kufe hinauf. Der Wind zerrt an mir. Nachdem ich mich an der Steigerungssteuerung und an der Blattverstellung vorbeigezwängt und auf dem linken Sitz Platz genommen habe, schließe ich meinen Vierpunktgurt. Ich höre, wie Marino die Tür hinter mir aufmacht. Er bewegt sich geräuschvoll und raumgreifend, und ich spüre, wie der Helikopter unter seinem Gewicht in die Knie geht, als er wie immer hinten einsteigt. Selbst wenn er allein mit Lucy fliegt, darf er nicht vorn sitzen. Dort befinden sich nämlich Kontrollhebel, an die er versehentlich stoßen oder die er, ohne nachzudenken, als Armlehne benutzen könnte. Er ist und bleibt ein Elefant im Porzellanladen.
Lucy steigt ebenfalls ein und beginnt mit der nächsten Sicherheitsüberprüfung. Ich helfe ihr, indem ich die Checkliste halte und sie gemeinsam mit ihr durcharbeite. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, die verschiedenen Maschinen zu fliegen, die Lucy im Lauf der Jahre besessen hat. Ich möchte auch nicht ihre Motorräder oder ihre schnellen italienischen Autos fahren. Aber ich bin eine gute Copilotin und kenne mich mit Landkarten und Navigation aus. Ich weiß, wie man Funkgeräte auf die richtige Frequenz einstellt oder Rufzeichen und andere Informationen in den Transponder oder das Chelton Flight System eingibt. Im Notfall könnte ich den Helikopter wohlbehalten landen, auch wenn das bestimmt kein schöner Anblick wäre.
»Über-Platz-Schalter aus«, gehe ich weiter die Liste durch.
»Ja.«
»Unterbrecher an.«
»Richtig.« Lucys geschickte Finger berühren alles, was sie kontrolliert, während wir die laminierte Liste abarbeiten.
Sie schaltet kurz die Ladedruck-Pumpen ein und stellt den Steuerknüppel auf Leerlauf.
»Rechts alles klar.« Sie schaut aus dem Seitenfenster.
»Links alles klar.« Ich blicke auf die dunkle Rampe hinaus und betrachte das kleine Gebäude mit seinen erleuchteten Fenstern und eine Piper Club, die, in einem Sicherheitsabstand vertäut, im Schatten parkt. Ihre Plane flattert im Wind.
Als Lucy auf den Startknopf drückt, beginnt der Rotor, zunächst langsam und schwerfällig, sich zu drehen. Bald jedoch rattert er schneller als ein Herzschlag, und ich denke an den Mann, an seine Angst und das, was ich den drei Wörtern, die er gerufen hat, habe entnehmen können.
»Was zum …? Hey …!«
Was hat er empfunden? Was gesehen? Den Saum eines schwarzen Mantels. Eines weiten, schwarzen Mantels, der vorbeirauschte? Wessen Mantel? Ein Wollmantel oder ein Trenchcoat? Ein Pelzmantel war es nicht. Wer ist der Träger dieses langen schwarzen Mantels? Jemand, der nicht stehengeblieben ist, um dem Mann zu helfen.
»Was zum …? Hey …!« Ein erschrockener Schmerzensschrei.
Immer wieder lasse ich die Szene Revue passieren. Der abrupte Wechsel des Kamerawinkels. Im nächsten Moment richtete sich die Linse direkt nach oben auf kahle Äste und einen grauen Himmel. Dann der Saum des langen schwarzen Mantels, der eine Sekunde lang auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wer würde einfach um einen Mann in Not herumgehen, als ob er ein lebloser Gegenstand wie ein Fels oder ein Baumstamm wäre? Was ist das für ein Mensch, der einen Mann, der sich an die Brust greift und zusammenbricht, kaltblütig ignoriert? Der Täter vielleicht. Oder eine Person, die sich aus irgendeinem Grund nicht einmischen will. So wie Zeugen eines Unfalls oder einer Gewalttat, die sich blitzschnell aus dem Staub machen, um nicht in die Ermittlungen hineingezogen zu werden. Mann oder Frau? Habe ich Schuhe gesehen? Nein, nur den flatternden Saum des Mantels. Darauf folgte ein Klappern, und andere kahle Äste, betrachtet durch die Unterseite einer grünen Bank, kamen in Sicht. Hat die Person im langen schwarzen Mantel den Kopfhörer mit dem Fuß unter die Bank gestoßen, damit die Kamera nicht aufnehmen konnte, was dann geschah?
Ich muss mir die Videoaufzeichnung gründlicher anschauen, aber das ist jetzt nicht möglich. Das iPad liegt im Gepäckraum, und außerdem fehlt die Zeit dafür. Der Rotor durchschneidet die Luft, und der Generator läuft. Lucy und ich setzen unsere Kopfhörer auf. Sie betätigt einige Hebel über ihrem Platz: Avioniksteuerung und Navigationsinstrumente. Ich stelle die Gegensprechanlage auf Besatzung, damit Marino nichts hört, während Lucy mit dem Fluglotsen spricht. Die Scheinwerfer und die Landungslichter spiegeln sich auf dem Asphalt und verfärben ihn weiß, als wir auf die Starterlaubnis des Towers warten. Ich tippe Zieldaten ins GPS, das bewegliche Display mit der Karte und ins Chelton Flight System ein, korrigiere die Höhenmesser, vergewissere mich, dass die digitale Treibstoffanzeige mit der Tankuhr übereinstimmt, und erledige die meisten Handgriffe mindestens zweimal, weil Lucy eine unbedingte Anhängerin von Wiederholungen ist.
Der Tower gibt uns frei. Wir schweben in niedriger Höhe zur Startbahn, steigen mit Kurs auf Nordosten und überqueren auf tausend Fuß den Delaware River. Das vom Wind aufgepeitschte dunkle Wasser sieht aus wie zähflüssiges, geschmolzenes Metall. Kleinen Feuern gleich, funkeln die Lichter der Häuser durch die Bäume.