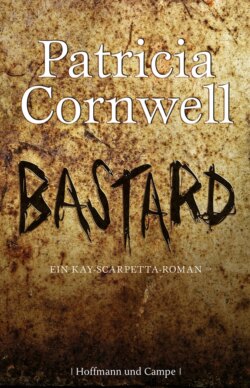Читать книгу Bastard - Patricia Cornwell - Страница 7
2
ОглавлениеLucy und Marino haben mein Zimmer verlassen. Meine Koffer, Rucksäcke und Kartons sind fort. Es ist nichts mehr übrig, und das Zimmer sieht aus, als wäre ich nie hier gewesen. Ich fühle mich so allein wie schon seit Jahren, ja vielleicht Jahrzehnten nicht mehr.
Ich schaue mich ein letztes Mal um und vergewissere mich, dass nichts vergessen worden ist. Mein Blick wandert an der Mikrowelle vorbei zu dem kleinen Kühlschrank mit Gefrierfach, der Kaffeemaschine, den Fenstern mit Aussicht auf den Parkplatz und Briggs’ erleuchteter Suite. Ein schwarzer Himmel spannt sich über einen menschenleeren Golfplatz. Dichte Wolken ziehen über den länglichen Mond, so dass er immer wieder aufleuchtet und erlischt wie eine Signallampe. So, als wollte er mir mitteilen, was sich auf dem Pfad nähert und ob ich stehenbleiben oder weitergehen soll. Die Sterne kann ich nicht erkennen. Ich mache mir Sorgen, dass das schlechte Wetter schneller aufziehen könnte, herangetragen von demselben starken Südwind, der auch die großen Flugzeuge mit ihrer traurigen Fracht bringt. Eigentlich sollte ich mich beeilen, aber der Badezimmerspiegel und das Gesicht darin lenken mich ab. Ich halte inne, um mich im grellen Schein der Neonröhre zu betrachten. Wer bist du jetzt? Wer bist du wirklich?
Meine blauen Augen, das kurze blonde Haar, das markante Gesicht und die Figur haben sich kaum verändert. Ich komme zu dem Schluss, dass ich mich unter Berücksichtigung meines Alters bemerkenswert gut gehalten habe. Ich habe den Aufenthalt in fensterlosen Räumen aus Beton und Stahl unbeschadet überstanden. Vieles davon ist genetisch, ein ererbter Überlebenswille in einer Familie, in der es so tragisch zugegangen ist wie in einer Oper von Verdi. Die Scarpettas stammen von robusten Norditalienern mit ausgeprägten Gesichtszügen, heller Haut, blondem Haar und kräftigen Muskeln und Knochen ab, mit Körpern, die sich hartnäckig dem Leid und auch dem Raubbau durch Laster widersetzen, die mir die meisten Menschen niemals zutrauen würden. Allerdings kann ich diese Neigungen nicht leugnen, die Schwäche für Essen, Trinken und alles Körperliche, ganz gleich, wie zerstörerisch es auch sein mag. Ich sehne mich nach Schönheit und habe tiefe Gefühle, bin allerdings auch ein wenig aus der Art geschlagen. Ich kann gnadenlos und herrschsüchtig sein, unbeweglich und starr, angelernte Verhaltensweisen, die für mich überlebenswichtig sind. Sie wurden weder mir noch jemandem in meiner aufbrausenden und zu Dramen neigenden Familie in die Wiege gelegt. So viel weiß ich über meine Herkunft. Was den Rest angeht, bin ich mir nicht so sicher.
Meine Vorfahren waren Bauern oder arbeiteten bei der Eisenbahn. Doch in den letzten Jahren hat meine Mutter Künstler, Philosophen, Märtyrer und alle möglichen anderen Exoten in den Familienstammbaum aufgenommen, denn sie treibt jetzt Ahnenforschung. Wenn man ihr glauben kann, bin ich ein Nachkomme der Handwerker, die den Hochaltar, das Chorgestühl und die Mosaiken in der St.-Markus-Basilika und das Deckenfresko in der Chiesa dell’Angelo San Raffaele geschaffen haben. Außerdem habe ich einige Pater und Mönche unter meinen Ahnen und bin seit kurzem – basierend auf Fakten, die ich nicht kenne – entfernt mit dem Maler und Mörder Caravaggio sowie über drei Ecken mit Giordano Bruno verwandt, der zur Zeit der Inquisition in Rom wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.
Meine Mutter wohnt noch immer in ihrem kleinen Haus in Miami und hat sich der Aufgabe verschrieben, aus mir schlau zu werden. Ihres Wissens nach bin ich die einzige Medizinerin in der Familie, und sie begreift nicht, warum ich mich für Patienten entschieden habe, die bereits tot sind. Weder meine Mutter noch meine einzige Schwester Dorothy haben eine Vorstellung davon, wie stark ich von einer schweren Jugend geprägt bin, die hauptsächlich daraus bestand, einen sterbenskranken Vater zu pflegen und anschließend im Alter von zwölf Jahren die Verantwortung für unseren Haushalt zu übernehmen. Also bin ich sowohl von meiner Vorgeschichte als auch von meiner Ausbildung her sozusagen Expertin für Leid und Schmerz. Und aus unerklärlichen Gründen ende ich stets als Leitfigur oder als Sündenbock. Ausnahmslos.
Ich schließe die Tür des Zimmers, das nicht nur sechs Monate lang, sondern eigentlich länger mein Zuhause gewesen ist. Briggs ist es gelungen, mich daran zu erinnern, woher ich komme und wohin ich will. Es ist ein Weg, der schon lange vor dem vergangenen Juli vorgezeichnet worden ist. Er begann bereits im Jahr 1987, als ich erkannte, dass ich in den Staatsdienst wollte, und nicht wusste, wie ich die während des Medizinstudiums angehäuften Schulden abbezahlen sollte. Und so habe ich zugelassen, dass eine Banalität wie Geld und ein Laster wie Ehrgeiz alles unwiederbringlich veränderten, und zwar nicht zum Guten, nein, vielmehr zum Allerschlechtesten. Doch ich war jung und idealistisch. Ich war stolz und wollte mehr, ohne zu ahnen, dass mehr für einen unersättlichen Menschen stets weniger ist.
Da ich die Klosterschule ebenso wie Cornell und die Juristische Fakultät der Georgetown University mit einem Vollstipendium besuchen durfte, hätte ich unbelastet von Kreditverpflichtungen ins Berufsleben eintreten können. Aber ich lehnte das Angebot der Bowman Gray School of Medicine ab, weil ich unbedingt an der Johns Hopkins University studieren wollte. Noch nie zuvor hatte ich mir etwas so gewünscht, und da ich das Studium ohne jegliche finanzielle Unterstützung aufnahm, stand ich nach dem Abschluss vor einem astronomischen Schuldenberg. Meine einzige Rettung war ein Stipendium des Militärs, mit dem sich auch einige meiner Kommilitonen, wie vor mir Briggs, über Wasser gehalten hatten. Ich lernte ihn in den Anfangstagen meiner beruflichen Laufbahn kennen, als man mich dem Pathologischen Institut der Streitkräfte zuteilte. Briggs wiegte mich in dem Glauben, ich könne in aller Seelenruhe im Walter Reed Army Medical Center in Washington, D.C., militärische Autopsieberichte überprüfen. Wenn meine Schulden erst einmal abbezahlt seien, stünde mir eine feste Stelle in der zivilen Rechtsmedizin offen.
Womit ich nicht gerechnet hatte, war Südafrika im Dezember 1987, Sommer auf diesem weit entfernten Kontinent. Noonie Pieste und Joanne Rule, Dokumentarfilmerinnen und etwa in meinem Alter, waren an Stühle gefesselt, geschlagen und mit dem Messer traktiert worden. Dann hatten die Täter den beiden Frauen zerbrochene Flaschen in die Vagina gestoßen und ihnen die Luftröhre herausgerissen. Morde aus Rassenhass, verübt an zwei jungen Amerikanerinnen. »Sie fliegen nach Kapstadt«, wies Briggs mich an. »Um den Fall zu untersuchen und die Leichen zu überführen.« Propaganda des Apartheidregimes. Lügen und noch mehr Lügen. Warum die beiden und warum ich?
Auf dem Weg die Treppe hinunter in die Vorhalle versuche ich, nicht daran zu denken. Weshalb erinnere ich mich überhaupt? Doch ich kenne den Grund. Seit ich heute Morgen am Telefon angeschrien und beschimpft worden bin, stehen mir die Ereignisse von vor zwanzig Jahren wieder klar vor Augen. Die verschwundenen Autopsieberichte und mein durchwühltes Gepäck. Die Gewissheit, dass man mir ans Leben wollte, ein Unfall zur rechten Zeit, ein Selbstmord oder ein inszenierter Mord wie der an den beiden Frauen, die ich so deutlich vor mir sehe wie damals. Bleich und steif auf Stahltischen. Ihr Blut floss durch Rinnen auf dem Boden eines Autopsiesaals, der so miserabel ausgestattet war, dass wir die Schädeldecken mit Handsägen öffnen mussten. Es gab kein Röntgengerät, und ich musste meine eigene Kamera mitbringen.
Ich gebe meinen Schlüssel an der Rezeption ab und lasse mein Telefonat mit Briggs Revue passieren. Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich weiß nicht, warum ich die Wahrheit nicht sofort erkennen konnte, und ich denke an seinen abweisenden Tonfall und seine kühle Gleichgültigkeit, als ich ihn durch die Fensterscheibe beobachtet habe. Ich habe ihn schon öfter so reden gehört, doch für gewöhnlich wendet er sich dann an andere, und es geht um ein Problem, dessen Tragweite seine Befugnisse übersteigt. Hier ist mehr im Spiel als nur seine persönliche Meinung über mich. Es ist nicht nur eine Frage seiner typisch berechnenden Art und unserer von tragischen Ereignissen überschatteten Vergangenheit.
Jemand übt Druck auf ihn aus, und zwar nicht der Pressesprecher noch sonst irgendwer in Dover, sondern jemand, der eine Etage höher sitzt. Ich bin sicher, dass Briggs sich mit Washington abgesprochen hat, nachdem Marino nicht den Mund hat halten können. Warum musste er nur die wildesten Mutmaßungen verbreiten, bevor ich Gelegenheit hatte, auch nur ein Wort zu äußern? Marino hätte niemals über den Fall in Cambridge oder über mich sprechen dürfen. Damit hat er eine Lawine losgetreten, deren Ursache und Folgen er nicht versteht. Überhaupt versteht er eine ganze Menge nicht. Er war nie beim Militär, hat nie für die Bundesregierung gearbeitet und ist in Sachen internationale Politik völlig ahnungslos. Marino besitzt nicht das geringste Gespür für Macht von der Art, die eine Präsidentschaftswahl zum Kippen bringen oder einen Krieg vom Zaun brechen kann.
Ohne Zustimmung des Verteidigungsministeriums hätte Briggs niemals vorgeschlagen, eine Militärmaschine nach Massachusetts zu schicken, um eine Leiche abzuholen. Eine Entscheidung wurde getroffen, und zwar eine, in der ich nicht vorkomme. Draußen auf dem Parkplatz steige ich in den Transporter. Ich bin so wütend, dass ich Marino keines Blickes würdige.
»Erzähl mir mehr über das Satellitenradio«, wende ich mich an Lucy, weil ich der Sache auf den Grund kommen und herausfinden will, was Briggs weiß – oder was man ihm weisgemacht hat.
»Ein Sirius Stiletto«, antwortet Lucy vom dunklen Rücksitz aus, während ich die Heizung hochdrehe, weil Marino stets schwitzt und wir anderen deshalb frieren müssen. »Im Grunde genommen nur ein Speichermedium für Dateien plus Stromquelle. Natürlich kann man es als tragbares Satellitenradio benutzen, was es eigentlich auch ist. Aber der Kopfhörer ist sehr interessant, kein Meisterwerk zwar, doch technisch gut umgesetzt.«
»Es sind eine stecknadelkopfgroße Kamera und ein Mikro eingebaut«, ergänzt Marino beim Fahren. »Deshalb glaube ich, dass unser Toter ein Spion war. Er muss doch gewusst haben, dass ein audiovisuelles Aufnahmegerät in seinem Kopfhörer steckt.«
»Vielleicht hat er es tatsächlich nicht gemerkt. Jemand hätte ihm nachschnüffeln können, ohne dass er etwas davon ahnte«, sagt Lucy zu mir, und ich spüre, dass sie und Marino bereits über dieses Thema gestritten haben. »Das Loch befindet sich zwar oben am Bügel, allerdings an der Kante, wo man es kaum sieht. Und selbst wenn, würde man nicht unbedingt an eine schnurlose Kamera, kleiner als ein Reiskorn, ein ebenso winziges Mikrofon und einen Bewegungsmelder denken, der sich nach neunzig Sekunden in den Ruhezustand versetzt, falls sich nichts tut. Der Typ ist mit einer Mini-Webcam herumgelaufen, die ihre Aufnahmen auf der Festplatte des Radios und außerdem auf einer SD-Karte mit acht Gigabyte Speicherplatz gesichert hat. Es ist zu früh, um zu sagen, ob er es wusste – mit anderen Worten also, ob er das Ding selbst gebastelt hat. Mir ist klar, dass Marino davon ausgeht. Aber ich bin mir da nicht so sicher.«
»Gehört die SD-Karte zum Standardzubehör des Radios, oder wurde sie nachträglich eingebaut?«, erkundige ich mich.
»Nachträglich. Also eine ganze Menge Speicherplatz. Mich würde interessieren, ob die Dateien in regelmäßigen Abständen auf einen anderen Rechner heruntergeladen wurden, zum Beispiel auf seinen Computer zu Hause. Wenn wir den in die Finger kriegen, erfahren wir vielleicht, was hier gespielt wird.«
Damit will Lucy sagen, dass uns die bis jetzt von ihr gesichteten Videodateien nicht viel weiterhelfen. Außerdem vermutet sie, dass der Tote zu Hause einen Computer, möglicherweise sogar mehrere, stehen hat. Allerdings hat sie noch keinen Hinweis darauf entdeckt, wo er gewohnt hat oder wer er ist.
»Die Aufnahmen auf Festplatte und SD-Karte lassen sich nur bis zum 5. Februar zurückverfolgen, also bis zum letzten Freitag«, fährt sie fort. »Ob das heißt, dass die Überwachung gerade erst begonnen hat, kann ich nicht feststellen. Wahrscheinlicher ist, dass die Dateien heruntergeladen und dann von der Festplatte und der SD-Karte gelöscht wurden, denn sie brauchen ziemlich viel Speicherplatz. Deshalb handelt es sich hier vermutlich nur um die Aufnahmen aus jüngster Zeit, was jedoch nicht bedeuten muss, dass es nicht noch andere gibt.«
»Dann werden die Videoaufzeichnungen sicher von einem fremden Rechner heruntergeladen.«
»So würde ich es wenigstens machen, wenn ich die Spionin wäre«, erwidert Lucy. »Ich würde mich in die Webcam einloggen und herunterladen, was mir gefällt.«
»Was ist mit Beobachtungen in Echtzeit?«, frage ich.
»Wenn jemand ihn ausspioniert hat, konnte sich derjenige in die Webcam einklinken und ihm bei allem zuschauen.«
»Um ihm nachzustellen? Ihn zu beschatten?«
»Das wäre einer der Gründe. Vielleicht auch, um Informationen über ihn zu sammeln oder ihm nachzuschnüffeln. Wie es manche Leute tun, wenn sie glauben, dass ihr Partner sie betrügt. Alles, was du dir vorstellen kannst, ist auch möglich.«
»Dann könnte er auch seinen eigenen Tod gefilmt haben.« Ich spüre, wie ein Funke Hoffnung in mir aufsteigt, obwohl mich die Vorstellung gleichzeitig bestürzt. »Ich füge hinzu, unwissentlich, weil wir noch mit zu vielen Unbekannten zu tun haben. Wir können zum Beispiel nicht sagen, ob er ein Selbstmörder ist und seinen eigenen Tod absichtlich aufgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt möchte ich noch nichts ausschließen.«
»Ein Selbstmörder ist er auf gar keinen Fall«, protestiert Marino.
»Zu diesem Zeitpunkt sollten wir noch nichts ausschließen«, wiederhole ich.
»Oder ein Amokläufer«, meint Lucy. »Wie an der Columbine High School oder in Fort Hood. Vielleicht wollte er in Norton’s Woods so viele Menschen wie möglich mitnehmen und sich anschließend selbst umbringen. Aber etwas ist dazwischengekommen und hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.«
»Wie haben es mit zu vielen Unbekannten zu tun«, beharre ich.
»Im Magazin der Glock waren siebzehn Schuss, eine Patrone steckte in der Kammer«, erklärt Lucy. »Eine Menge Munition. Eindeutig genug, um jemandem die Hochzeit zu verderben. Wir müssen rauskriegen, wer geheiratet hat und wer die Gäste waren.«
»Die meisten Selbstmordattentäter haben zusätzliche Magazine bei sich«, entgegne ich. Ich weiß alles über die Amokläufe in Fort Hood, an der Virginia Tech und den viel zu vielen anderen Orten, wo Täter, ungeachtet der Identität ihrer Opfer, das Feuer auf ihre Mitmenschen eröffnet haben. »Für gewöhnlich haben solche Leute massenweise Munition und Ersatzwaffen dabei, wenn sie einen Amoklauf planen. Aber ich stimme dir zu. Die American Academy of Arts and Sciences ist sehr bekannt. Deshalb sollten wir die Namen des Brautpaars und der Gäste in Erfahrung bringen.«
»Was die Aufnahmen angeht, gibt es gute und nicht so gute Nachrichten.« Lucy streckt die Hand über die Sitzlehne und reicht mir ihr iPad. »Die gute Nachricht ist, wie ich bereits sagte, dass offenbar nichts gelöscht worden ist. Zumindest nicht in jüngster Zeit. Falls ihn jemand überwacht und dann zu seinem Ableben beigetragen hat, hätte diese Person sich doch in den E-Mail-Account eingeklinkt und Festplatte und SD-Karte gesäubert, ehe Leute wie wir einen Blick darauf werfen.«
»Warum dann nicht gleich das verdammte Radio mitsamt Kopfhörer vom Tatort entfernen?«, wendet Marino ein. »Das heißt, falls der Typ wirklich beschattet und verfolgt und von dem, der ihn beobachtet hat, kaltgemacht worden ist. Nun, ich würde mir als Täter einfach Kopfhörer und Radio schnappen und in aller Seelenruhe weiterspazieren. Deshalb würde ich jede Wette abschließen, dass er selbst gefilmt hat. Ich halte es für absolut unwahrscheinlich, dass es ein anderer war. Und außerdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass dieser Bursche irgendein krummes Ding vorhatte. Ganz gleich, wozu er die Spionageausrüstung auch benutzt haben mag, er war der Einzige, der davon wusste. Dumm ist nur, dass es keine Aufnahmen vom Täter gibt, also von dem Kerl, der ihn umgenietet hat. Und das ist wichtig. Warum hat die Kamera im Kopfhörer es nicht gefilmt, wenn er beim Gassigehen von jemandem überfallen worden ist?«
»Der Kopfhörer hat deshalb nichts gefilmt, weil der Mann den Täter nicht gesehen hat«, erwidert Lucy. »Er hat ihn nicht angeschaut.«
»Ausgehend von der Annahme, dass eine andere Person für seinen Tod verantwortlich ist«, halte ich den beiden vor Augen.
»Richtig«, stimmt Lucy zu. »Der Kopfhörer zeichnet alles auf, worauf der Träger den Blick richtet. Die Kamera auf seinem Scheitel zeigt nach vorn wie ein drittes Auge.«
»Dann hat der Killer sich von hinten angeschlichen«, folgert Marino. »Und es ging so schnell, dass das Opfer keine Chance mehr hatte, sich umzudrehen. Entweder das, oder wir haben es mit einem Scharfschützen zu tun. Vielleicht wurde er ja aus großer Entfernung erschossen. Zum Beispiel mit einem Giftpfeil. Gibt es nicht Gifte, die Blutungen auslösen? Das mag an den Haaren herbeigezogen sein, doch solcher Mist geschieht hin und wieder. Erinnert euch an den KGB-Spion, der mit einem Regenschirm gestochen wurde. Die Spitze war mit Rizin getränkt. Es geschah an einer Bushaltestelle, und niemand hat etwas gemerkt.«
»Der Mann war ein bulgarischer Dissident, der für die BBC gearbeitet hat. Ob es ein Regenschirm war, steht bis heute nicht fest. Und du verirrst dich ohne Landkarte immer tiefer im Wald«, entgegne ich.
»Außerdem fällt man von Rizin nicht auf der Stelle tot um«, ergänzt Lucy. »Die meisten Gifte wirken nicht so schnell. Nicht einmal Zyanid. Ich glaube nicht, dass er vergiftet wurde.«
»Meine Erfahrung als Polizist ist meine Landkarte«, meint Marino zu mir. »Ich setze meine Fähigkeiten im Schlussfolgern ein. Man nennt mich nicht umsonst Sherlock.« Mit seinem kräftigen Zeigefinger tippt er sich an die Baseballkappe.
»Kein Mensch nennt dich Sherlock«, ertönt Lucys Stimme vom Rücksitz.
»Deine Beiträge sind nicht sehr hilfreich«, sage ich bestimmt und betrachte seine massige Gestalt am Steuer und seine riesigen Pranken auf dem Lenkrad, das, selbst wenn er sein sogenanntes Kampfgewicht hat, seinen Bauch streift.
»Bist du nicht diejenige, die mir immer predigt, ich sollte über den Tellerrand hinausschauen?« Sein Tonfall ist schneidend und rechtfertigend.
»Ratespielchen bringen uns nicht weiter, und Punkte miteinander zu verbinden, die womöglich die falschen sind, ist Leichtsinn, und das weißt du ganz genau«, sage ich zu ihm.
Marino hatte schon immer einen Hang zu voreiligen Schlussfolgerungen, doch seit er die Stelle in Cambridge angenommen hat und wieder für mich arbeitet, ist es noch schlimmer geworden. Ich schiebe es auf die ständige Präsenz des Militärs in unserem Leben, die so allgegenwärtig ist wie die gewaltigen Transportmaschinen, die tief über Dover hinwegfliegen. Genau genommen gebe ich Briggs die Schuld. Marino vergöttert diesen mächtigen Forensiker, der außerdem General in der Army ist, auf eine geradezu lächerliche Art und Weise. Meine Verbindungen zum Militär haben ihn hingegen nie gekümmert. Er hat sie nicht einmal zur Kenntnis genommen, weder als Teil meiner Vergangenheit, noch als ich nach den Anschlägen vom 11. September wieder in den aktiven Dienst versetzt wurde. Marino hat meine Beziehungen zur Regierung schon immer ignoriert und tut so, als wären sie nicht vorhanden.
Er blickt starr geradeaus. Die Scheinwerfer eines herannahenden Autos beleuchten sein Gesicht, das Missstimmung und die für ihn so typische Verständnislosigkeit ausdrückt. Ich könnte ihn bemitleiden, denn ich möchte nicht abstreiten, dass ich ihn gernhabe. Aber nicht jetzt. Nicht unter diesen Umständen. Er soll nicht merken, wie aufgebracht ich bin.
»Was hast du Briggs sonst noch mitgeteilt – abgesehen von deinen Theorien?«, erkundige ich mich bei Marino.
Als er nicht antwortet, tut es Lucy für ihn. »Briggs hat dieselben Aufnahmen gesehen, die ich dir jetzt zeigen werde«, erwidert sie. »Es war nicht meine Idee, und ich habe sie ihm auch nicht gemailt, nur um das klarzustellen.«
»Was genau hast du ihm nicht gemailt?« Allerdings weiß ich es bereits, und mein Entsetzen wächst. Marino hat Briggs Beweise zukommen lassen. Obwohl es mein Fall ist, hat Briggs die Informationen als Erster erhalten.
»Er hat nachgefragt«, erklärt Marino, als ob das ein triftiger Grund wäre. »Was hätte ich ihm denn sagen sollen?«
»Gar nichts. Du hast über meinen Kopf hinweg gehandelt. Es ist nicht sein Fall«, entgegne ich.
»Ja, nun, eigentlich schon«, meint Marino. »Er wurde vom Gesundheitsminister ernannt, was heißt, dass er praktisch vom Präsidenten selbst eingestellt worden ist. Also steht er, wenn man es so betrachtet, in der Hierarchie über allen Anwesenden in diesem Auto.«
»General Briggs ist nicht der Chief Medical Examiner von Massachusetts, und du arbeitest nicht für ihn, sondern für mich.« Ich lege mir meine Worte sorgfältig zurecht und versuche, so ruhig und gelassen zu klingen, wie ich es auch tue, wenn ein feindseliger Verteidiger mich im Zeugenstand auseinandernehmen will. Oder wenn Marino kurz vor einem Wutausbruch steht. »Der Tätigkeitsbereich des CFC ist nicht klar umrissen. In gewissen Situationen kann es Fälle übernehmen, für die eigentlich die Bundesbehörden zuständig sind. Das mag manchmal ein wenig verwirrend sein. Unser Institut ist eine Gemeinschaftsinitiative der Regierungen von Bundesstaat und Bund, dem Massachusetts Institute of Technology und Harvard. Da dieses Konzept noch nie da gewesen ist, birgt es seine Fallstricke. Und genau deshalb hättest du die Angelegenheit mir überlassen sollen, anstatt mich zu übergehen.« Ich bemühe mich um einen sachlichen Ton. »General Briggs verfrüht, um nicht zu sagen, überstürzt in den Fall einzuweihen kann nämlich dazu führen, dass die Dinge eine Eigendynamik entwickeln. Aber was geschehen ist, ist geschehen.«
»Was soll das heißen? Was geschehen ist?« Marino hört sich schon weniger selbstbewusst an. Ich bemerke einen besorgten Unterton, werde ihm allerdings nicht aus der Patsche helfen. Er soll über den Zwischenfall nachdenken, denn er hat ihn schließlich zu verantworten.
»Und wie lauten die nicht so guten Nachrichten?« Ich drehe mich zu Lucy um.
»Schau selbst«, erwidert sie. »Das sind die letzten drei Aufnahmen und ein paar kurze andere Schnipsel.«
Das Display des iPads leuchtet hell und bunt in der Dunkelheit. Ich berühre das Symbol der ersten Videodatei, die Lucy ausgesucht hat. Der Film beginnt. Nun sehe ich das, was auch der Tote am gestrigen Tag um 15 Uhr 04 gesehen hat: einen schwarzweißen Greyhound, zusammengerollt auf einem blauen Sofa in einem Wohnzimmer mit Fichtenholzparkett und einem blauroten Teppich.
Die Kamera bewegt sich mit dem Mann, weil er sie am Kopfhörer trägt. Dabei nimmt das Gerät die folgenden Gegenstände auf: einen mit ordentlich gestapelten Büchern und Papieren bedeckten Couchtisch und etwas, das wie spezielles Zeichenpapier für Architekten oder Ingenieure aussieht, mit einem Bleistift darauf. Dazu ein Fenster mit geschlossenen Fensterläden aus Holz, ein Schreibtisch mit zwei großen Flachbildschirmen, zwei silberne MacBooks, ein Telefon, möglicherweise ein iPhone auf einer Ladestation, eine Pfeife aus bernsteinfarbenem Glas in einem Aschenbecher, eine Stehlampe mit grünem Schirm, ein Hundebett aus Fleece und herumliegende Spielzeuge. Ich erhasche einen Blick auf eine Tür mit einem Riegel. An den Wänden hängen gerahmte Fotos und Poster, die zu schnell vorbeigleiten, als dass ich Einzelheiten erkennen könnte. Ich werde sie später genauer betrachten.
Bis jetzt gibt es nichts, was mir verraten würde, wer der Mann ist oder wo er wohnt. Allerdings scheint es die kleine Wohnung oder vielleicht auch das Haus eines Menschen zu sein, der Tiere liebt, in finanziell gesicherten Verhältnissen lebt und großen Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legt. Der Mann, vorausgesetzt, es sind seine Wohnung und sein Hund, bewegt sich intellektuell und technologisch auf hohem Niveau, ist kreativ und organisiert, raucht vermutlich Marihuana und hat sich für ein Haustier entschieden, das ein anspruchsvoller Hausgenosse ist, kein Vorzeigeobjekt, sondern ein Geschöpf, das in einem früheren Leben Grausamkeiten erdulden musste. Ich habe Mitleid mit dem Hund und frage mich, was wohl aus ihm geworden ist.
Sanitäter und Polizei hätten einen hilflosen Windhund sicher nicht allein und einsam in Norton’s Woods dem neuenglischen Wetter überlassen. Benton hat mir gesagt, heute Morgen seien es in Cambridge minus zehn Grad gewesen und es soll zu schneien anfangen, bevor die Nacht zu Ende ist. Möglicherweise befindet sich der Hund ja inzwischen in der Feuerwache, wo er gut gefüttert und rund um die Uhr versorgt wird. Oder ein Ermittler hat ihn mit nach Hause genommen. Allerdings könnte es auch sein, dass niemand den Hund als Eigentum des Toten erkannt hat.
»Was ist mit dem Greyhound passiert?« Ich muss die Frage einfach stellen.
»Keine Ahnung«, erwidert Marino zu meiner Bestürzung. »Bis heute Morgen, als Lucy und ich uns denselben Film angesehen haben wie du jetzt, wusste niemand von seiner Existenz. Die Sanitäter erinnern sich nicht an einen frei herumlaufenden Windhund, auch wenn sie nicht direkt Ausschau nach einem gehalten haben. Aber das Tor zu Norton’s Woods war bei ihrer Ankunft geöffnet. Wie du sicher weißt, wird es nie abgeschlossen und steht deshalb meistens weit offen.«
»Er wird den Frost nicht überleben. Wie konnte kein Mensch bemerken, dass das arme Tier ohne Leine umherirrt? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der Hund nicht mindestens einige Minuten im Park hin und her gerannt ist, bevor er durch das offene Tor verschwand. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass ein Hund nicht einfach aus dem Wald und auf die Straße flüchtet, wenn sein Herrchen plötzlich zusammenbricht.«
»Viele Leute nehmen ihre Hunde von der Leine und lassen sie in Parks wie Norton’s Woods frei laufen«, wendet Lucy ein. »So mache ich es wenigstens mit Jet Ranger.«
Jet Ranger ist ihr betagter Bulldoggenrüde. Ich würde seine Fortbewegung nicht unbedingt als Laufen bezeichnen.
»Also ist es vielleicht niemandem aufgefallen, weil es nichts Ungewöhnliches war«, fügt sie hinzu.
»Außerdem wurden die Leute sicher ein wenig davon abgelenkt, dass da ein Typ aus heiterem Himmel tot umgefallen ist«, stellt Marino das Offensichtliche fest.
Ich mustere die Unterkünfte der Soldaten entlang der schlechtbeleuchteten Straße und die Flugzeuge, die, strahlend und riesenhaft wie Planeten, am bewölkten dunklen Himmel schweben. Was ich da gerade gehört habe, ergibt für mich keinen Sinn. Mich wundert, dass der Hund nicht in der Nähe seines Herrn geblieben ist. Vielleicht ist er ja in Panik geraten oder wurde aus einem anderen Grund nicht bemerkt.
»Der Hund taucht sicher wieder auf«, spricht Marino weiter. »In einer Gegend wie dieser werden die Leute einen allein umherirrenden Windhund nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Bestimmt ist er bei einem der Nachbarn oder einem Studenten. Falls der Typ allerdings umgelegt wurde, hat der Täter den Hund möglicherweise mitgenommen.«
»Wieso?«, wundere ich mich.
»Wie du schon sagtest, sollten wir für alles offen sein«, erwidert er. »Woher wissen wir, ob der Mörder nicht in der Nähe war und alles beobachtet hat? Und in einem günstigen Augenblick hat er sich dann mit dem Hund davongemacht und getan, als wäre es seiner.«
»Aber warum?«
»Er könnte ein Beweisstück sein, das auf irgendeine Weise zum Täter führt«, schlägt er vor. »Ein Hinweis auf seine Identität. Vielleicht war es auch nur ein Spiel. Nervenkitzel. Ein Souvenir. Keine Ahnung, zum Teufel. Aber du wirst in der Videoaufzeichnung erkennen, dass dem Hund irgendwann die Leine abgenommen wurde. Und dreimal darfst du raten: Man hat sie nie gefunden. Sie wurde nicht mit dem Kopfhörer und der Leiche eingeliefert.«
Der Hund heißt Sock. Auf dem Display des iPads bewegt sich der Mann vorwärts, schnalzt mit der Zunge und fordert Sock zum Aufstehen auf. »Komm, Sock«, lockt er ihn in einem angenehmen Bariton. »Los, du fauler Hund. Es ist Zeit für einen Spaziergang und einen Schiss.« Ich nehme einen leichten Akzent wahr, vielleicht ein britischer oder australischer. Es könnte auch ein südafrikanischer sein, was wirklich ein merkwürdiger Zufall wäre. Ich muss aufhören, an Südafrika zu denken. Konzentrier dich auf das, was du vor dir hast, befehle ich mir, während Sock vom Sofa springt. Ich stelle fest, dass er kein Halsband trägt. Sock, nach dem Namen zu urteilen vermutlich ein Rüde, ist mager. Seine Rippen treten leicht hervor, was typisch für Greyhounds ist. Außerdem ist er ausgewachsen und offenbar alt. Eines seiner Ohren hat einen unregelmäßigen Rand, als wäre es eingerissen worden. Ich bin sicher, dass er von der Hunderennbahn gerettet wurde, und frage mich, ob er wohl mit einem Mikrochip ausgestattet ist. Wenn ja und falls wir ihn finden, wissen wir dann, woher er stammt und wer ihn adoptiert hat.
Zwei Hände kommen ins Bild, als der Mann sich bückt und Sock eine rote Leine um den langen, schmal zulaufenden Hals legt. Ich bemerke eine Uhr aus silbernem Metall mit einem Entfernungsmesser am Rand und sehe Gelbgold aufblitzen. Möglicherweise ein College-Ring. Falls der Ring mit der Leiche eingeliefert wurde, hilft er uns vielleicht weiter, sofern er graviert ist. Die Hände wirken schmal, mit schlanken Fingern. Die Haut ist leicht gebräunt. Ich erhasche einen Blick auf eine dunkelgrüne Jacke, eine weite schwarze Cargohose und die Spitze eines abgewetzten braunen Wanderstiefels.
Die Kamera richtet sich auf die Wand über dem Sofa. An der wurmstichigen Vertäfelung aus Kastanienholz kommt der untere Rand eines Metallrahmens in Sicht. Als der Mann sich aufrichtet, ist ein Poster oder Kunstdruck zu sehen. Ich kann die Reproduktion der mir vertrauten Zeichnung näher betrachten und erkenne die Skizze von Leonardo da Vinci aus dem 16. Jahrhundert, die ein Gerät mit Flügeln, eine Flugmaschine, darstellt. Meine Gedanken wandern in die Vergangenheit. Wann genau war es? Im Sommer vor den Anschlägen vom 11. September. Ich habe mit Lucy eine Ausstellung in der Londoner Courtauld Gallery besucht. Leonardo der Erfinder. Viele spannende Stunden haben wir damit verbracht, Vorträgen der weltweit angesehensten Wissenschaftler zu lauschen und dabei da Vincis Entwürfe von Kriegsmaschinen zu Wasser und zu Land, seiner Luftschraube, der Tauchausrüstung, dem Fallschirm, der riesigen Armbrust, dem sich selbst antreibenden Wagen und dem Roboterritter zu betrachten.
Das große Genie der Renaissance vertrat die Überzeugung, dass Kunst Wissenschaft und Wissenschaft Kunst sei. Die Lösung aller Probleme ließe sich in der Natur finden, wenn man nur sorgfältig und aufmerksam genug hinschaue und wirklich nach der Wahrheit suche. Diese Grundsätze habe ich meiner Nichte den Großteil ihres Lebens über zu vermitteln versucht. Immer wieder habe ich ihr erklärt, dass unsere Umgebung uns Lektionen erteilt, falls wir bescheiden, still und mutig sind. Der Mann, den ich auf dem kleinen Gerät in meiner Hand beobachte, kennt die Antworten, die ich suche. Sprich mit mir. Wer bist du, und was ist geschehen?
Er nähert sich der Tür, die mit einem vorgeschobenen Riegel gesichert ist. Plötzlich ändern sich Perspektive und Kameraeinstellung, und ich frage mich, ob er den Kopfhörer zurechtgerückt hat. Vielleicht hatte er ihn nicht richtig über den Ohren und wollte vor dem Aufbruch Musik einschalten. Er geht an einem wie ein technisches Gerät aussehenden, zusammengeschustert wirkenden Gegenstand vorbei. Möglicherweise eine aus Metallschrott gebastelte groteske Skulptur. Ich halte den Film an, vermag das Objekt jedoch nicht richtig zu erkennen. Wenn ich mir ein wenig Zeit gönnen kann, werde ich das Video wieder und wieder abspielen, jede Einzelheit gründlich unter die Lupe nehmen und nötigenfalls Lucy bitten, die Bilder elektronisch schärfer zu stellen. Doch jetzt muss ich den Mann und seinen Hund zu dem bewaldeten Grundstück, keinen Block von Bentons und meinem Haus entfernt, begleiten. Ich muss Zeugin der Ereignisse werden. In wenigen Minuten wird er sterben. Zeig es mir, und ich werde die Wahrheit in Erfahrung bringen. Lass dir von mir helfen.
Der Mann und der Hund steigen in einem schummrig beleuchteten Treppenhaus vier Stockwerke hinunter. Ihre Schritte auf dem blanken Holz klingen leicht und schnell. Dann treten die beiden auf eine laute, belebte Straße hinaus. Die Sonne steht tief am Himmel. Schneeflecken sind mit einer schwarzen Schmutzkruste bedeckt und erinnern mich an zerquetschte Oreo-Kekse. Wenn der Mann nach unten schaut, sehe ich nasse Pflastersteine, Asphalt und außerdem Sand und Salz, gestreut wegen des Schnees. Autos und Menschen bewegen sich ruckartig und machen Sprünge, als er den Kopf wendet und sich beim Gehen umblickt. Im Hintergrund spielt Musik. Annie Lennox im Satellitenradio. Ich nehme nur so viel von der Außenwelt wahr, wie durch den Kopfhörer dringt und vom Mikrofon im Bügel aufgefangen wird. Offenbar hat der Mann das Radio auf volle Lautstärke gestellt, was nicht ratsam ist, weil man es dann nicht bemerkt, wenn sich jemand von hinten nähert. Warum macht er sich keine Gedanken darüber, was sich in seiner Umgebung abspielt, obwohl er doch so besorgt um seine Sicherheit ist, dass er seine Wohnungstür doppelt verriegelt und eine Waffe trägt?
Aber die Leute sind heutzutage leichtsinnig. Selbst Menschen, die in einem vernünftigen Rahmen Vorsicht walten lassen, überfrachten ihre Konzentrationsfähigkeit in einer ans Lächerliche grenzenden Art und Weise. Sie schreiben SMS und fragen ihre E-Mails ab, während sie Auto fahren, gefährliche Maschinen bedienen oder eine belebte Straße überqueren. Beim Radfahren oder Skaten, ja sogar am Steuerknüppel eines Flugzeugs wird telefoniert. Ich sehe dasselbe wie der Mann und stelle fest, dass er die Concord Avenue entlanggeht. Er und Sock schreiten rasch aus und passieren Mietshäuser aus rotem Backstein, das Polizeipräsidium von Harvard und die dunkelrote Markise des Sheraton Commander Hotel gegenüber vom Cambridge Common. Also wohnt er ganz in der Nähe des Common in einem älteren Mietshaus mit mindestens vier Stockwerken.
Es wundert mich, dass er mit Sock nicht in den Common geht. Der Park ist bei Hundebesitzern sehr beliebt. Doch er und sein Windhund setzen ihren Weg fort, vorbei an Statuen, Kanonen, Laternenmasten, kahlen Eichen, Bänken und an neben Parkuhren am Straßenrand abgestellten Autos. Ein gelbes Taxi jagt ein dickes Eichhörnchen, und Annie Lennox singt No more I love you’s … I used to have demons in my room at night … Ich bin Augen und Ohren des Mannes und sehe und höre das, was der Kopfhörer aufnimmt. Nichts weist darauf hin, dass er über die versteckte Kamera und das Mikrofon im Bilde ist oder überhaupt an derartige Dinge denkt.
Außerdem habe ich nicht den Eindruck, dass er böse Absichten hegt oder jemanden ausspionieren will, während er seinen Hund spazieren führt. Nur dass er eine halbautomatische Glock mit achtzehn Schuss 9-Millimeter-Munition unter seiner grünen Jacke trägt. Warum? Ist er unterwegs, um jemanden zu erschießen, oder hat er die Waffe zur Selbstverteidigung bei sich? Und wenn ja, wovor hat er Angst? Vielleicht ist es ja einfach nur eine Angewohnheit von ihm, mit einer Waffe in der Tasche herumzulaufen. Manche Leute tun das eben, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Aber weshalb hat er die Seriennummer der Glock abgefeilt? Oder hat ein anderer es getan? Ich überlege, ob die im Kopfhörer versteckten Aufnahmegeräte vielleicht ein privates Experiment von ihm oder Teil eines Forschungsprojekts sind. Cambridge und Umgebung sind ein Mekka der technischen Innovation, einer der Gründe, warum das Verteidigungsministerium, der Staat Massachusetts, Harvard und das MIT einverstanden waren, das CFC in einem Gebäude des Biotechnischen Instituts im Memorial Drive am Nordufer des Charles River anzusiedeln. Möglicherweise war der Mann ja Doktorand, Informatiker oder Ingenieur. Ich betrachte die ruckartigen und verwackelten Aufnahmen auf dem Bildschirm des iPads, die die Mather Court Apartments, einen Spielplatz, die Garden Street und die windschiefen, verwitterten Grabsteine des Old Burying Ground zeigen.
Auf dem Harvard Square wendet er sich dem Zeitungskiosk an der Crimson Corner zu. Er scheint mit dem Gedanken zu spielen, hinzugehen, vielleicht, um aus dem ausgesprochen breitgefächerten Angebot, das Benton und ich so lieben, eine Zeitung auszuwählen. Das hier ist unser Stadtviertel, das wir auf der Suche nach Kaffee, exotischen Speisen, Büchern und Zeitungen durchstreifen. Der New Yorker, die Los Angeles Times, die Chicago Tribune, das Wall Street Journal und, wenn es einen nicht stört, dass die Nachrichten schon ein paar Tage alt sind, Zeitungen aus London, Berlin und Paris. Manchmal stoßen wir auch auf ein Exemplar von La Nazione oder L’Espresso. Ich lese Artikel über Florenz und Rom vor, wir studieren die Mietangebote für Villen und träumen davon, zu leben wie die Einheimischen und die Ruinen und Museen, die italienische Landschaft und die Küste von Amalfi zu erkunden.
Der Mann bleibt auf dem belebten Gehweg stehen und hat es sich offenbar anders überlegt. Er und Sock trotten über die Straße, und ich weiß inzwischen, wohin sie wollen. Zumindest glaube ich das. In der Quincy Street geht es nach links. Mittlerweile schreiten sie noch schneller aus, und der Mann hat eine Plastiktüte in der Hand, als könnte Sock es sich nicht mehr sehr lange verkneifen. Vorbei an der modernen Lamont Library, dem Harvard Faculty Club, einem dem georgianischen Stil nachempfundenen Backsteingebäude, dem Fogg Museum und der gotischen Church of New Jerusalem. In der Kirkland Avenue biegen sie rechts ab. Wir sind zu dritt. Ich begleite sie, als sie auf die Irving Street zusteuern und sich dort nach links wenden. Bis zu Norton’s Woods und Bentons und meinem Haus sind es nur wenige Minuten. Im Satellitenradio läuft Five for Fighting … even heroes have the right to bleed …
Meine Beklommenheit wächst mit jedem Schritt, als wir uns dem Moment nähern, in dem der Mann stirbt und der Hund sich in der bitteren Kälte verläuft. Ich will es verzweifelt verhindern, und ich gehe mit ihnen, als würde ich sie zur Schlachtbank führen, denn im Gegensatz zu ihnen weiß ich, was gleich geschehen wird. Ich möchte sie dazu bringen, anzuhalten und umzukehren. Dann erscheint links von uns das Haus, dreistöckig und weiß, mit schwarzen Fensterläden und einem Schieferdach. Amerikanischer Klassizismus, erbaut im Jahr 1824 von einem Transzendentalisten, der mit den Schriftstellern Ralph Waldo Emerson und später Henry David Thoreau befreundet war. Innen ist das Haus, Bentons und mein Haus, mit originalen Holzteilen, Stuck, verputzten Decken und freiliegenden Balken ausgestattet. Auf Höhe der Treppenabsätze befinden sich prachtvolle französische Buntglasfenster, die Tierszenen darstellen und im Sonnenlicht funkeln wie Edelsteine. In der schmalen, gepflasterten Auffahrt erkenne ich einen Porsche 911. Abgaswolken quellen aus dem verchromten Auspuff.
Benton rangiert den Sportwagen rückwärts. Die Heckleuchten funkeln wie feurige Augen, als er bremst, um einen Mann mit Hund vorbeizulassen. Der Mann wendet den Kopfhörer Benton zu. Vielleicht bewundert er den Porsche, ein schwarzes Turbo-Cabriolet mit Allradantrieb, das Benton stets blank poliert wie Lackleder. Ich frage mich, ob er sich an den jungen Mann mit der weiten grünen Jacke und dem weißen Greyhound erinnert und ob sie ihm überhaupt aufgefallen sind. Aber ich kenne Benton. Er wird anfangen zu grübeln und vermutlich genauso wenig von dem Mann und seinem Hund loskommen wie ich. Ich überlege, was Benton gestern getan hat. Am späten Nachmittag hat er kurz in einem Büro im McLean Hospital vorbeigeschaut, weil er vergessen hatte, die Fallakte des Patienten, über den er heute ein Gutachten anfertigen soll, nach Hause mitzunehmen. Das Kleine-Welt-Phänomen: ein junger Mann und sein alter Hund, die bald für immer auseinandergerissen werden, und mein Mann, allein im Auto und auf dem Weg ins Krankenhaus, um eine vergessene Akte zu holen. Ich beobachte, wie sich die Dinge entwickeln, als wäre ich Gott. Wenn es sich wirklich so anfühlt, Gott zu sein, ist es sicher ein schrecklicher Zustand. Ich weiß, was geschehen wird, und bin absolut machtlos dagegen.