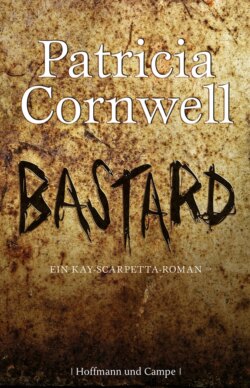Читать книгу Bastard - Patricia Cornwell - Страница 5
1
ОглавлениеIn der Umkleidekabine für Mitarbeiterinnen werfe ich meinen schmutzigen OP-Anzug in den Eimer für kontaminierte Wäsche und ziehe meine restlichen Sachen und die Arztpantoffeln aus. Dabei frage ich mich, ob das Namensschild Colonel Scarpetta an meinem Spind wohl entfernt werden wird, sobald ich morgen früh nach Neuengland zurückgekehrt bin. Dieser Gedanke gefällt mir gar nicht. Denn eigentlich will ich nicht weg von hier.
Trotz der harten Ausbildung und der traurigen Tatsache, dass ich im Auftrag der amerikanischen Regierung täglich mit dem Tod zu tun hatte, hat das Leben auf dem Luftwaffenstützpunkt Dover auch seine Vorteile. Mein Aufenthalt ist erstaunlich ereignislos, ja sogar angenehm verlaufen. Ich werde es vermissen, vor Morgengrauen in meinem spartanisch eingerichteten Zimmer aufzustehen, in eine Cargohose, ein Polohemd und Stiefel zu schlüpfen und durch Dunkelheit und Kälte quer über den Parkplatz zum Clubhaus am Golfplatz zu gehen, einen Kaffee zu trinken und etwas zu essen und anschließend mit dem Auto in ein Rechtsmedizinisches Institut zu fahren, in dem ich nichts zu sagen habe. Solange ich für den Armed Forces Medical Examiner (AFME), den obersten Rechtsmediziner der Streitkräfte, tätig bin, übe ich keine Leitungsfunktion aus. Eine ganze Reihe von Leuten steht in der Hierarchie über mir, weshalb ich nicht befugt bin, Entscheidungen von größerer Tragweite zu fällen, vorausgesetzt, ich werde überhaupt gefragt. Ein himmelweiter Unterschied zu Massachusetts, wo sich alle auf mich verlassen.
Es ist Montag, der 8. Februar. Die Wanduhr über den blitzblanken weißen Waschbecken zeigt 16:33. Die Zahl blinkt rot wie ein Warnsignal. In knapp neunzig Minuten soll ich bei CNN vor der Kamera stehen, um zu erklären, was ein forensischer Pathologieradiologe ist, warum ich mich dazu habe ausbilden lassen und welche Rolle der Luftwaffenstützpunkt in Dover, das Verteidigungsministerium und das Weiße Haus dabei spielen. Ich bin inzwischen eine Mischung aus Rechtsmedizinerin und Reservistin beim AFME. Seit den Anschlägen vom 11. September, dem amerikanischen Einmarsch im Irak und dem Truppeneinsatz in Afghanistan – um mich für die Sendung vorzubereiten, gehe ich in Gedanken die einzelnen Punkte durch, die ich nicht vergessen darf – ist die Grenze zwischen dem militärischen und zivilen Bereich wohl für immer durchlässig geworden. Nur eines der Beispiele, die ich vielleicht anführen werde: Im letzten November wurden innerhalb von achtundvierzig Stunden dreizehn gefallene Soldaten aus dem Nahen Osten eingeflogen. Ebenso viele Tote wurden aus Fort Hood, Texas, hergebracht. Das Massensterben beschränkt sich also nicht mehr nur auf das eigentliche Schlachtfeld. Das Schlachtfeld kann überall sein: unser Zuhause, unsere Schulen, unsere Kirchen und Passagiermaschinen, die Orte, wo wir arbeiten, einkaufen und Urlaub machen.
Ich krame in meinem Kosmetikkoffer und sortiere dabei noch einmal im Kopf meine Anmerkungen zu Themen wie 3D-bildgebende Radiologie, Magnetresonanztomographie und Computertomographie im Autopsiesaal. Außerdem darf ich nicht versäumen, zu betonen, dass mein neues Institut in Cambridge, Massachusetts, zwar als erste zivile Einrichtung in den Vereinigten Staaten virtuelle Autopsien durchführt, Baltimore jedoch als Nächstes folgen wird – ein Trend der Zukunft also. Die traditionelle Obduktion, bei der man munter drauflosschneidet, anschließend fotografiert und hofft, dass man weder etwas vergessen noch selbst Spuren hinterlassen hat, wird dank entsprechender moderner Technologien erheblich effizienter und genauer werden. Und genau so sollte es auch sein.
Ich bedaure, dass ich heute Abend nicht in World News auftreten werde, denn eigentlich würde ich dieses Gespräch lieber mit Diane Sawyer führen. Dass ich so häufig bei CNN zu sehen bin, bringt nämlich ein Problem mit sich: Wer zu bekannt ist, wird oft nicht mehr ernst genommen. Daran hätte ich früher denken müssen. Das Interview könnte, wie mir plötzlich einfällt, ins Persönliche abgleiten, eine Gefahr, die ich gegenüber General Briggs hätte erwähnen sollen. Ebenso den Zwischenfall am heutigen Vormittag, als die aufgebrachte Mutter eines toten Soldaten mich am Telefon beschimpft, mich der Diskriminierung beschuldigt und gedroht hat, sich mit ihren Beschwerden über mich an die Medien zu wenden.
Metall auf Metall, es knallt wie ein Schuss, als ich die Tür meines Spinds schließe. In der Hand einen Plastikkorb mit Olivenöl-Pflegeshampoo, einem Peeling aus fossilen Meeresalgen, einem Damenrasierer, einer Dose Rasiergel für empfindliche Haut, Flüssigseife, einem Waschlappen, einer Mundspülung, Zahnbürste, Nagelbürste und einem parfümierten Neutrogena-Öl, gehe ich über die hellbraunen Fliesen, die sich unter meinen nackten Füßen stets kühl anfühlen. In einer offenen Kabine baue ich meine Sachen in Reih und Glied auf dem gekachelten Sims auf und stelle das Wasser so heiß ein, wie ich es gerade noch aushalte. Ein harter Strahl prasselt auf mich herunter, während ich meinen Körper bewege, damit er mich auch überall erreicht. Erst hebe ich den Kopf, dann blicke ich zu Boden auf meine blassen Füße. In der Hoffnung, dadurch meine angespannten Muskeln ein wenig zu lockern, lasse ich das Wasser meinen Nacken und meinen Hinterkopf bearbeiten. Dabei überlege ich, was ich heute Abend anziehen soll.
General Briggs – oder John, wie ich ihn nenne, wenn wir allein sind – möchte, dass ich Fliegerkleidung oder besser noch die blaue Uniform der Air Force trage. Ich bin dagegen und plädiere für Zivil, denn so kennen mich die Zuschauer von den meisten Fernsehinterviews her. Am besten ein schlichtes, dunkles Kostüm, eine elfenbeinfarbene Bluse mit Kragen und die dezente Breguet-Uhr mit Lederarmband, ein Geschenk meiner Nichte Lucy. Nicht die Blancpain mit dem überdimensionalen schwarzen Zifferblatt und der Keramikfassung, ebenfalls von Lucy, die ein Faible für technisch aufwendige und teure Uhren hat. Keine Hose, sondern Rock und Pumps, damit ich nicht bedrohlich und zugänglich wirke, ein Trick, den ich vor langer Zeit im Gerichtssaal gelernt habe. Aus mir unbekannten Gründen wollen die Geschworenen meine Beine sehen, während ich tödliche Verletzungen und die qualvollen letzten Lebensminuten eines Opfers in allen drastischen anatomischen Einzelheiten schildere. Briggs wird mit meiner Garderobe unzufrieden sein. Doch wie ich ihm gestern Abend – im Fernsehen lief Baseball – bei ein paar Drinks erklärt habe, sollte ein Mann einer Frau nicht sagen, was sie anzuziehen hat. Außer er hieße Ralph Lauren.
Ein Luftzug durchdringt den Dampf in meiner Duschkabine, und ich glaube jemanden gehört zu haben. Sofort fühle ich mich gestört. Es könnte jede x-Beliebige sein. Eine Militärangehörige – Ärztin oder nicht –, die berechtigt ist, sich in dieser streng zugangsbeschränkten Einrichtung aufzuhalten, auf die Toilette muss, ein Desinfektionsmittel braucht oder sich umziehen möchte. Ich denke an die Kolleginnen, mit denen ich gerade im großen Autopsiesaal zusammen war, und habe den Verdacht, dass es wieder einmal Captain Avallone ist. Sie hat sich den Großteil des Vormittags während der Computertomographie wie eine Klette an mich geheftet, als ob ich nach all den Lehrgängen nicht wüsste, wie man diese Untersuchung durchführt. Den restlichen Tag ist sie um meinen Arbeitsplatz geschlichen. Bestimmt ist sie gerade hereingekommen. Ich bin sogar ziemlich sicher, und ich spüre, wie Abneigung in mir aufsteigt. Verschwinde.
»Dr. Scarpetta?«, ruft ihre vertraute Stimme, die ohne Ausdruck und Leidenschaft ist und mich überallhin zu verfolgen scheint. »Ein Anruf für Sie.«
»Ich habe gerade erst angefangen zu duschen«, überschreie ich das laute Wasserrauschen.
Auf diese Weise will ich ihr mitteilen, dass sie mich in Ruhe lassen soll. Bitte, ein kleines bisschen Privatsphäre. Ich möchte jetzt weder Captain Avallone noch sonst jemanden sehen. Und das liegt nicht daran, dass ich nackt bin.
»Tut mir leid, Ma’am. Aber Pete Marino will Sie unbedingt sprechen.« Ihre gefühllose Stimme kommt näher.
»Dann muss er eben warten«, erwidere ich.
»Er sagt, es sei wichtig.«
»Können Sie ihn nicht fragen, was er will?«
»Er sagt nur, dass es wichtig ist, Ma’am.«
Ich verspreche, ihn so bald wie möglich zurückzurufen. Vermutlich klinge ich unhöflich, aber ich kann nicht immer charmant sein, auch wenn ich die besten Absichten habe. Pete Marino ist der Ermittler, mit dem ich mein halbes Leben lang zusammengearbeitet habe. Hoffentlich ist zu Hause nichts Schlimmes geschehen. Nein, wenn es ein Notfall wäre, würde er dafür sorgen, dass ich es sofort erführe. Wenn meinem Mann Benton oder Lucy etwas zugestoßen wäre oder es im Cambridge Forensic Center, zu dessen Leiterin ich ernannt worden bin, ein ernstes Problem gegeben haben sollte, hätte Marino mir nicht einfach ausrichten lassen, dass er am Apparat und dass es wichtig sei.
Ich öffne weit den Mund, um den Geschmack nach verwesendem und verbranntem Menschenfleisch loszuwerden, der sich in meiner Kehle festgesetzt hat. Die Dampfwellen treiben mir den Gestank der Leiche, an der ich heute gearbeitet habe, bis tief in die Nebenhöhlen; Moleküle verfaulender Biomasse wirbeln um mich herum durch die Dusche. Ich schrubbe mir die Fingernägel mit antibakterieller Seife aus einer Flasche. Dasselbe Mittel benutze ich auch fürs Geschirr oder um an einem Tatort meine Stiefel zu desinfizieren. Dann putze ich Zähne, Zahnfleisch und Zunge mit Listerine-Mundspülung. Ich reinige mir die Nasenlöcher, so tief, wie ich hineinkomme, schrubbe jeden Zentimeter meiner Haut ab und wasche mir anschließend nicht nur einmal, sondern zweimal die Haare. Doch der Geruch ist immer noch da. Es gelingt mir einfach nicht, ihn loszuwerden.
Der tote Soldat, um den ich mich gerade gekümmert habe, hieß Peter Gabriel, wie der Rockstar, nur dass dieser Peter Gabriel Private First Class, also Gefreiter, in der Army und noch nicht einmal einen Monat in der nordwestafghanischen Provinz Badghis im Einsatz gewesen ist, als ein am Straßenrand deponierter Sprengsatz – zusammengebastelt aus einem Stück Abwasserrohr aus Plastik, vollgestopft mit C4-Plastiksprengstoff und verschlossen mit einer Kupferplatte – die Panzerung seines Humvee durchdrang, so dass es im Fahrzeuginneren geschmolzene Metallteile hagelte. PFC Gabriel hat mich den Großteil meines letzten Tages hier in diesem riesigen, hochtechnisierten Institut in Anspruch genommen. Der AFME befasst sich häufig mit Fällen, bei denen die Öffentlichkeit nie an uns denken würde: dem Attentat auf John F. Kennedy, den jüngsten DNA-Analysen der Zaren-Familie Romanow und der Mannschaft der C.S.S. H.L. Hunley, des konföderierten U-Boots, das während des Bürgerkriegs gesunken ist. Wir sind eine elitäre, aber kaum bekannte Truppe, deren Anfänge bis ins Jahr 1862 und ins Army Medical Museum zurückreichen, dessen Chirurgen den tödlich verwundeten Abraham Lincoln behandelt und später obduziert haben. Alles Dinge, die ich bei CNN erwähnen sollte. Ich muss das Positive hervorheben und vergessen, was Mrs. Gabriel mir an den Kopf geworfen hat. Ich bin weder ein Ungeheuer noch eine Heuchlerin. Man darf der armen Frau ihren Zorn nicht zum Vorwurf machen, halte ich mir vor Augen. Immerhin hat sie gerade ihr einziges Kind verloren. Die Gabriels sind Afroamerikaner. Wie würdest du dich an ihrer Stelle fühlen, verdammt? Natürlich bist du keine Rassistin.
Wieder spüre ich, dass jemand im Raum ist. Jemand hat den Umkleideraum betreten, den ich inzwischen mit Nebel gefüllt habe wie ein Dampfbad. Wegen der Hitze habe ich kräftiges Herzklopfen.
»Dr. Scarpetta?« Captain Avallone klingt nun nicht mehr so zögerlich, sondern eher, als hätte sie bedeutsame Nachrichten.
Ich stelle das Wasser ab, verlasse die Duschkabine und wickle mich in ein Handtuch. Captain Avallone ist ein undeutlich auszumachender Schemen, der im Dunst neben den Waschbecken und den mit Bewegungsmeldern ausgestatteten Händetrocknern verharrt. Ich erkenne nur ihr dunkles Haar, ihre khakifarbene Cargohose und das schwarze Polohemd mit dem aufgestickten gold-blauen Emblem.
»Pete Marino …«, setzt sie an.
»Ich rufe ihn sofort zurück.« Ich nehme mir ein zweites Handtuch vom Regal.
»Er ist hier, Ma’am.«
»Was soll das heißen, er ist hier?« Fast rechne ich damit, dass er wie ein Geschöpf aus grauer Vorzeit im vom Dampf erfüllten Umkleideraum erscheint.
»Er erwartet Sie hinten in der Anlieferungszone, Ma’am«, teilt sie mir mit. »Er wird Sie nach Eagles Rest fahren, damit Sie Ihre Sachen holen können.« Sie sagt das, als würde ich vom FBI abtransportiert, weil ich verhaftet oder gefeuert worden bin. »Ich habe Anweisung, Sie zu ihm zu bringen und Ihnen in jeglicher Hinsicht behilflich zu sein.«
Captain Avallone heißt mit Vornamen Sophia. Sie ist Angehörige der Army, hat gerade die Facharztausbildung zur Radiologin hinter sich und verhält sich stets militärisch korrekt und unterwürfig höflich, während sie sich um mich herumdrückt. Als ich meinen Kosmetikkoffer über den Fliesenboden trage, folgt sie mir auf den Fersen.
»Ich soll erst morgen abreisen, und mit Marino irgendwohin zu fahren war eigentlich nicht geplant«, erwidere ich.
»Ich kümmere mich um Ihr Auto, Ma’am. Soweit ich informiert bin, sollen Sie nicht selbst fahren …«
»Haben Sie ihn gefragt, worum zum Teufel es geht?« Ich hole Haarbürste und Deo aus dem Spind.
»Ich habe es versucht, Ma’am«, entgegnet sie. »Aber er war nicht sehr gesprächig.«
Ein Großraumtransporter C-5 Galaxy im Landeanflug auf Bahn 19 dröhnt über meinen Kopf hinweg. Der Wind weht wie immer aus Süden.
Einer der vielen Grundsätze beim Fliegen, die ich von Lucy, die auch Helikopterpilotin ist, gelernt habe, lautet, dass die Nummern der Landebahnen gemäß ihrer Position auf dem Kompass vergeben werden. 19 steht zum Beispiel für 190 Grad, was bedeutet, dass 01 das entgegengesetzte Ende ist. Die Gründe für dieses System sind der Bernoulli-Effekt und Newtons Gesetze der Bewegung, also die Geschwindigkeit, mit der Luft über eine Tragfläche streichen muss, und das Starten und Landen mit dem Wind, der in diesem Teil Delawares vom Meer her kommt. Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, von Süden nach Norden. Tagein, tagaus bringen die Flugzeuge Leichen und schaffen sie wieder fort, auf einem schwarzgeteerten Band, das wie der Fluss Styx hinter Port Mortuary verläuft.
Die haifischgraue Galaxy ist so lang wie ein Football-Feld und so gewaltig und schwer, dass sie am blassblauen Himmel mit seinen Federwolken, die die Piloten Stutenschweife nennen, stillzustehen scheint. Ich würde den Flugzeugtyp auch ohne Hinschauen erkennen, und zwar an seinem schrillen Kreischen und Pfeifen. Inzwischen habe ich Erfahrung mit dem Geräusch von Triebwerken, die einhundertsechzigtausend Pfund Schubkraft erzeugen, und kann eine C-5 oder eine C-17 schon aus vielen Kilometern Entfernung identifizieren. Ich weiß auch einiges über Helikopter und Kipprotoren und bin in der Lage, einen Chinook von einem Black Hawk oder einem Osprey zu unterscheiden. Wenn ich bei schönem Wetter ein paar Minuten Zeit habe, setze ich mich auf eine Bank vor meiner Unterkunft und beobachte die Flugmaschinen von Dover, als wären es exotische Geschöpfe wie Manatis, Elefanten oder prähistorische Vögel. Ich kann von ihrer schwerfälligen Dramatik, ihrem Dröhnen und den Schatten, die sie im Vorüberfliegen werfen, nicht genug bekommen.
Räder berühren, begleitet von Rauchwolken, so dicht in meiner Nähe den Boden, dass ich die Vibration in meinem Inneren spüre, als ich die Anlieferungszone mit ihren vier gewaltigen Toren, der hohen Sichtschutzmauer und den Notstromgeneratoren durchquere. Dort parkt ein blauer Transporter, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Pete Marino macht keine Anstalten, sich zu rühren, mich zu begrüßen oder mir die Tür aufzuhalten, was alles oder nichts bedeuten kann. Er vergeudet seine Energie nicht mit Umgangsformen. Solange ich mich erinnern kann, stand Charme oder gar Freundlichkeit bei ihm nie oben auf der Liste. Unsere erste Begegnung in der Gerichtsmedizin von Richmond, Virginia, liegt inzwischen über zwanzig Jahre zurück. Vielleicht habe ich ihn auch am Tatort eines Mordes kennengelernt. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich steige ein und klemme die Reisetasche zwischen die Füße. Mein Haar ist noch feucht vom Duschen. Offenbar findet er, dass ich zum Fürchten aussehe, und bildet sich schweigend ein Urteil. Das erkenne ich stets an seinen Seitenblicken, mit denen er mich von Kopf bis Fuß mustert und die an gewissen Stellen hängenbleiben, die ihn nichts angehen. Er mag es nicht, wenn ich meine AFME-Uniform, bestehend aus khakifarbener Cargohose, schwarzem Polohemd und Funktionsjacke, anhabe. Ich glaube, die wenigen Male, die er mich in dieser Aufmachung erlebt hat, haben ihn eingeschüchtert.
»Wo hast du das Auto geklaut?«, frage ich ihn, während er rückwärts aus der Parkposition rangiert.
»Eine Leihgabe von Civil Air.« Seine Antwort verrät mir wenigstens, dass Lucy nichts zugestoßen ist.
Der Privatterminal am nördlichen Ende der Startbahn wird von Zivilisten benutzt, die die Genehmigung haben, auf dem Luftwaffenstützpunkt zu landen. Also hat meine Nichte Marino hierhergeflogen, und ich überlege, ob sie mich damit haben überraschen wollen. Sie sind unangekündigt erschienen, um mir den morgigen Linienflug zu ersparen und mich endlich nach Hause zu bringen. Wunschdenken. Weil das nicht der Grund sein kann, suche ich in Marinos derbem Gesicht nach der Antwort und lasse sein Äußeres auf mich wirken wie bei der ersten Musterung eines Patienten. Turnschuhe, Jeans, eine mit Fleece gefütterte Harley-Davidson-Jacke, die er schon seit Ewigkeiten besitzt, eine Baseballkappe mit dem Emblem der Yankees, die er, da er nun im Revier der Red Sox lebt, auf eigene Gefahr trägt, und seine altmodische Nickelbrille.
Ich kann nicht erkennen, ob er sich das schüttere graue Haar heute abrasiert hat, aber er ist frisch gewaschen und verhältnismäßig gepflegt. Außerdem hat er weder ein vom Whiskey gerötetes Gesicht noch einen aufgedunsenen Bierbauch. Seine Augen sind nicht blutunterlaufen, seine Hände ruhig. Ich rieche auch keine Zigaretten. Also ist er noch immer sauber, und das in mehr als einer Hinsicht. Marino hat eine solche Menge von Problemen, dass er sie aneinanderreihen könnte wie die Waggons eines Zuges, der durch die unbefriedeten Gebiete seiner angeborenen Neigungen rattert: Sex, Alkohol, Tabak, Essen, Fluchen, Vorurteile, Faulheit. Vermutlich sollte ich noch mangelnde Wahrheitsliebe hinzufügen. Wenn es ihm in den Kram passt, weicht er aus oder lügt wie gedruckt.
»Ich nehme an, Lucy ist beim Hubschrauber …«, beginne ich.
»Weißt du, dass die sich hier geheimniskrämerischer anstellen als bei der gottverdammten CIA, wenn du gerade an einem Fall arbeitest?«, unterbricht er mich, während wir in den Purple Heart Drive einbiegen. »Dir hätte die Bude abbrennen können, ohne dass dir jemand ein Sterbenswörtchen gesagt hätte. Fünfmal habe ich angerufen. Also musste ich eine Managemententscheidung treffen und bin mit Lucy hergeflogen.«
»Es wäre sehr hilfreich, wenn du mir den Grund dafür verraten würdest.«
»Niemand wollte dich stören, während du den Soldaten aus Worcester untersucht hast«, fügt er zu meiner Überraschung hinzu.
PFC Gabriel stammte aus Worcester, Massachusetts, und ich kann mir nicht erklären, woher Marino weiß, welchen Fall ich hier in Dover auf dem Tisch hatte. Das hätte ihm niemand verraten dürfen. Alles, was wir hier in Port Mortuary tun, ist mit äußerster Diskretion zu behandeln, wenn nicht gar streng geheim. Ich frage mich, ob die Mutter des gefallenen Soldaten ihre Drohung wahr gemacht und sich an die Medien gewandt hat. Hat sie sich bei der Presse beschwert, die weiße Gerichtsmedizinerin, die ihren Sohn obduziert habe, sei eine Rassistin?
Ehe ich nachhaken kann, spricht Marino weiter. »Offenbar ist er der erste Kriegstote aus Worcester, weshalb sich die Journalistenmeute vor Ort daraufgestürzt hat. Wir hatten einige Anrufe. Anscheinend haben die Leute nicht ganz durchgeblickt und geglaubt, dass jeder Tote mit Wohnort in Massachusetts bei uns landet.«
»Man möchte meinen, die Reporter müssten inzwischen wissen, dass alle Gefallenen direkt hierher nach Dover gebracht werden«, entgegne ich. »Bist du sicher, dass das die Erklärung für das Medienecho ist?«
»Warum?« Er betrachtet mich. »Kannst du dir eine andere vorstellen, von der ich nichts ahne?«
»Ich habe bloß gefragt.«
»Ich kann nur sagen, dass einige Leute angerufen haben. Wir haben sie nach Dover verwiesen. Du warst mit dem Jungen aus Worcester beschäftigt, weshalb dich niemand ans Telefon holen wollte. Also habe ich schließlich General Briggs angerufen, als wir, nur noch zwanzig Minuten von hier entfernt, in Wilmington aufgetankt haben. Der hat dann Captain Do-Bee losgeschickt, um dich aus der Dusche zu holen. Ist sie eigentlich solo? Oder singt sie in Lucys Chor? Sie sieht nämlich nicht schlecht aus.«
»Woher weißt du, wie sie aussieht?«, wundere ich mich.
»Du warst nicht da, als sie auf dem Weg zu ihrer Mutter in Maine im CFC vorbeigeschaut hat.«
Ich versuche mich zu erinnern, ob mir das jemals mitgeteilt worden ist. Marino führt mir gerade in aller Deutlichkeit vor Augen, dass ich keine Ahnung habe, was sich im Cambridge Forensic Center, das ich eigentlich leiten sollte, in letzter Zeit abgespielt hat.
»Fielding hat ihr die große Besichtigungstour verabreicht und sich als Gastgeber in die Brust geworfen.« Marino kann Jack Fielding, meinen Stellvertreter, nicht leiden. »Die Sache ist, dass ich wirklich versucht habe, dich zu erreichen. Ich wollte nicht einfach so hereinplatzen.«
Marino weicht mir aus, und der Ablauf, wie er ihn mir schildert, deckt sich ganz sicher nicht mit den Tatsachen. Frei erfunden. Aus irgendeinem Grund hielt er es für nötig, mich mit seinem Besuch zu überraschen. Vermutlich, weil er sichergehen wollte, dass ich ihn auf der Stelle begleite. Mir schwant Übles.
»Du bist sicher nicht wegen des toten PFC Gabriel hier hereingeplatzt, wie du es ausdrückst«, merke ich an.
»Ich fürchte, nein.«
»Was ist passiert?«
»Wir haben ein Problem.« Er blickt starr geradeaus. »Und ich habe Fielding und allen anderen streng verboten, die Leiche anzufassen, bevor du da bist.«
Jack Fielding ist ein erfahrener Rechtsmediziner, der für gewöhnlich nicht nach Marinos Pfeife tanzt. Wenn mein Stellvertreter entscheidet, die Finger davon- und mir den Vortritt zu lassen, heißt das vermutlich, dass der Fall entweder politische Dimensionen hat oder uns eine Klage einbringen könnte. Es macht mir ziemlich zu schaffen, dass Fielding nicht versucht hat, mich anzurufen oder mir eine E-Mail zu schicken. Ich überprüfe noch einmal mein iPhone. Keine Nachricht von ihm.
»Gestern Nachmittag gegen halb vier in Cambridge«, erklärt Marino. Inzwischen sind wir auf der Atlantic Street und fahren langsam in der Dämmerung mitten durch den Stützpunkt. »Norton’s Woods, Irving Street, nicht einmal einen Block von deinem Haus entfernt. Du hättest zu Fuß zum Tatort gehen können. Vielleicht hätten die Dinge sich dann anders entwickelt.«
»Welche Dinge?«
»Ein Mann, weiß, schätzungsweise Mitte zwanzig. Sieht aus, als wäre er mit seinem Hund spazieren gegangen und dann plötzlich mit einem Herzinfarkt umgekippt«, spricht er weiter, während wir an Wartungshallen aus Beton und Metall, Hangars und anderen Gebäuden vorbeifahren, die Nummern statt Namen tragen. »Es war am helllichten Sonntagnachmittag, und es wimmelte von Leuten, weil in dem Gebäude – du weißt schon, das mit dem großen grünen Metalldach – irgendeine Veranstaltung stattfand.«
Norton’s Woods, ein bewaldetes Anwesen mit einem beeindruckenden Bauwerk aus Holz und Glas, das man für besondere Anlässe mieten kann, beherbergt die American Academy of Arts and Sciences. Es befindet sich einige Häuser weiter von dem, das Benton und ich im letzten Jahr bezogen haben, damit ich in der Nähe des Instituts wohnen kann, während er es nicht weit nach Harvard hat, wo er dem Lehrstuhl für Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät angehört.
»Mit anderen Worten: überall Augen und Ohren«, fügt Marino hinzu. »Ein toller Zeitpunkt und Ort, um jemandem das Licht auszupusten.«
»Ich dachte, du hättest einen Herzinfarkt erwähnt. Da er noch so jung war, meinst du vermutlich Herzrhythmusstörungen.«
»Ja, das hat man allgemein angenommen. Einige Zeugen berichten, er habe sich plötzlich an die Brust gegriffen und sei zusammengebrochen. Angeblich war er beim Eintreffen des Krankenwagens bereits tot. Wurde auf direktem Weg in dein Institut geschafft und hat die Nacht in der Kühlkammer verbracht.«
»Warum angeblich?«
»Heute am frühen Morgen ist Fielding in die Kühlkammer gegangen und hat Blutstropfen am Boden und eine Menge Blut auf der Bahre bemerkt. Also hat er Anne und Ollie geholt. Der Tote hat aus Nase und Mund geblutet, was er am Nachmittag zuvor, als er für tot erklärt wurde, noch nicht getan hat. Kein Blut am Fundort, nicht ein einziges Tröpfchen, und jetzt blutet er. Um Leichenwasser handelt es sich eindeutig nicht, weil er noch nicht verwest. Das Laken, mit dem er zugedeckt ist, ist ebenfalls blutig, und im Leichensack befindet sich etwa ein Liter Blut. Ich habe noch nie einen Toten so bluten gesehen. Daraufhin habe ich alle angewiesen, wegen dieses gottverdammten Problems den Mund zu halten.«
»Was hat Jack gesagt? Was hat er unternommen?«
»Du machst Witze, oder? Einen tollen Stellvertreter hast du dir da angelacht. Ich spar mir meinen Kommentar lieber.«
»Wissen wir, wer der Mann ist? Und warum Norton’s Woods? Wohnt er in der Nähe? Ist er Student in Harvard oder vielleicht am Priesterseminar?« Das liegt gleich um die Ecke von Norton’s Woods. »Ich bezweifle, dass er bei dieser Veranstaltung war. Nicht, wenn er einen Hund dabeihatte.« Ich klinge viel ruhiger, als ich mich fühle, während wir auf dem Parkplatz des Eagles Rest Inn dieses Gespräch führen.
»Wir kennen nicht viele Einzelheiten, aber es handelte sich offenbar um eine Hochzeit«, erklärt Marino.
»Am Sonntag des Super-Bowl-Turniers? Wer legt seine Hochzeit auf diesen Termin?«
»Vielleicht jemand, der lieber allein feiert. Oder jemand, der kein Amerikaner oder antiamerikanisch eingestellt ist. Keinen blassen Schimmer. Allerdings glaube ich nicht, dass unser Toter ein Hochzeitsgast war, und das liegt nicht nur an dem Hund. Er hatte nämlich eine 9-Millimeter-Glock unter der Jacke. Keinen Führerschein. Dafür aber ein tragbares Satellitenradio. Also kannst du dir wahrscheinlich denken, worauf ich hinauswill.«
»Eher nicht.«
»Lucy kann dir mehr zum Thema Radio sagen. Anscheinend hat er jemanden überwacht oder ausspioniert. Und dann hat derjenige, dem er damit auf den Wecker gefallen ist, beschlossen, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen. Kurz gesagt, gehe ich davon aus, dass er eine Verletzung hatte, die von den Sanitätern irgendwie übersehen worden ist. Der Transportdienst hat auch nichts bemerkt. Deshalb wurde er in den Leichensack gesteckt und hat während des Transports zu bluten angefangen. Und das wäre nicht passiert, wenn er keinen Blutdruck mehr gehabt hätte, was heißt, dass er noch lebte, als man ihn in die Rechtsmedizin gebracht und in die verdammte Kühlkammer gesperrt hat. Da drin sind es minus fünf Grad. Bis zum Morgen war er vermutlich erfroren. Vorausgesetzt, dass er nicht zuerst verblutet ist.«
»Warum hat er am Fundort nicht geblutet, wenn er eine Verletzung hat, aus der Blut nach außen austritt?«, wundere ich mich.
»Das musst schon du mir erklären.«
»Wie lange haben sich die Sanitäter mit ihm beschäftigt?«
»Fünfzehn bis zwanzig Minuten.«
»Könnte während der Wiederbelebungsmaßnahmen ein Gefäß geplatzt sein?«, frage ich. »Verletzungen kurz vor und auch nach dem Tod können, wenn sie schwer genug sind, kräftige Blutungen auslösen. Vielleicht ist ja bei der Herzmassage eine Rippe gebrochen worden und hat eine Arterie durchbohrt. Hat man ihn aus irgendeinem Grund vorsorglich intubiert, was möglicherweise zu einer Verletzung und den von dir beschriebenen Blutungen geführt hat?«
Doch ich kenne die Antworten schon, noch während ich die Fragen stelle. Marino hat jede Menge Erfahrung als Inspector bei der Mordkommission und als Ermittler in Mordfällen. Niemals hätte er meine Nichte und ihren Helikopter bemüht, um unangekündigt nach Dover zu fliegen, wenn es für den Vorfall eine logische oder zumindest plausible Erklärung gäbe. Außerdem ist Jack Fielding ganz sicher in der Lage, zwischen einer tatsächlichen Verletzung oder den Folgen eines Versehens zu unterscheiden. Warum hat er sich noch nicht bei mir gemeldet?
»Die Feuerwache von Cambridge ist etwa anderthalb Kilometer von Norton’s Woods entfernt. Deshalb war die Rettungsmannschaft schon nach wenigen Minuten da«, verkündet Marino.
Wir sitzen bei abgeschaltetem Motor im Transporter. Draußen ist es beinahe dunkel. Im Westen verschmelzen Horizont und Himmel, nur getrennt von einem hauchzarten Lichtstreifen. Wann hat Fielding je ohne meine Hilfe eine Katastrophe gemeistert? Nie. Er verschwindet dann einfach und überlässt es anderen, das von ihm angerichtete Durcheinander zu beseitigen. Das ist der Grund, warum er nicht versucht hat, mich zu erreichen. Vielleicht hat er wieder einmal einfach alles hingeworfen. Wie oft wird er das noch tun, bis ich genug habe und ihn endgültig nicht noch einmal einstelle?
»Laut den Sanitätern war er sofort tot«, fügt Marino hinzu.
»Sofern man nicht von einer Sprengfalle in tausend Stücke gerissen wird, ist man nie sofort tot«, wende ich ein. Ich mag es nicht, wenn Marino sich unpräzise ausdrückt. Sofort tot. Tot umgefallen. Tot, bevor er den Boden berührt hat. Seit zwanzig Jahren gibt er diese Allgemeinplätze nun schon von sich, ganz gleich, wie oft ich ihm auch predige, dass Herz- und Atemstillstand keine Todesursachen, sondern Symptome des Sterbens sind und dass das Eintreten des klinischen Todes mindestens einige Minuten dauert. Es passiert nicht sofort. So einfach ist das nicht. Zum wohl hundertsten Mal halte ich ihm diese medizinische Tatsache vor Augen, weil ich nicht weiß, was ich sonst sagen soll.
»Nun, ich wiederhole nur, was man mir erklärt hat. Nach Auffassung der Sanitäter war es unmöglich, ihn wiederzubeleben.« Marino redet, als würden sich Sanitäter besser mit dem Tod auskennen als ich. »Keine Reaktion. So stand es auf dem Formular.«
»Hast du mit ihnen gesprochen?«
»Mit einem. Heute Morgen am Telefon. Kein Puls, gar nichts. Der Bursche war tot. Zumindest behauptet das der Sanitäter. Aber was soll er auch sonst sagen? Dass sie nicht sicher waren, ihn jedoch trotzdem ins Leichenschauhaus geschickt haben?«
»Hast du ihm also verraten, warum du ihn das fragst?«
»Nein, zum Teufel, ich bin doch nicht geistig zurückgeblieben. Schließlich wollen wir nicht, dass der Globe es auf der Titelseite bringt. Wenn die Geschichte in den Nachrichten kommt, kann ich genauso gut wieder bei der New Yorker Polizei anfangen oder mir vielleicht einen Job als Nachtwächter suchen, nur dass der Stellenmarkt zurzeit recht eng ist.«
»An welche Vorgehensweise hast du dich gehalten?«
»Ich hatte keine Chance, mich an irgendwas zu halten. Fielding hat alles an sich gerissen. Natürlich beteuert er, er wäre streng nach Vorschrift vorgegangen. Die Polizei von Cambridge hätte am Fundort nichts Verdächtiges entdeckt, anscheinend ein natürlicher Tod in Gegenwart von Zeugen. Also hat Fielding die Erlaubnis gegeben, die Leiche ins Institut zu schaffen, unter der Bedingung, dass die Polizei die Pistole sicherstellt und schnellstens ins Labor bringt, damit wir rauskriegen, auf wen sie zugelassen ist. Ein Routinefall also und nicht unsere Schuld, wenn die Sanitäter Mist gebaut haben. So waren wenigstens Fieldings Worte. Und weißt du, was ich dazu sage? Dass es keine Rolle spielen wird. Wir sind so oder so die Sündenböcke. Die Medien werden sich auf uns stürzen, dass uns Hören und Sehen vergeht, und fordern, dass das Institut zurück nach Boston verlegt wird. Kannst du dir das vorstellen?«
Bevor mein Cambridge Forensic Center im letzten Sommer die ersten Fälle übernahm, war das Rechtsmedizinische Institut des Bundesstaates Massachusetts in Boston ansässig und Schauplatz von politischen und wirtschaftlichen Problemen und Skandalen, die stets ihren Weg in die Nachrichtensendungen fanden. Leichen gingen verloren, wurden in die falschen Beerdigungsinstitute geschickt oder ohne vorherige gründliche Untersuchung eingeäschert. In mindestens einem Fall von Verdacht auf Kindesmissbrauch wurden die falschen Augäpfel überprüft. Chief Medical Examiner kamen und gingen, und wegen der Mittelkürzungen mussten Außenstellen geschlossen werden. Doch Marinos Andeutungen stellen sämtliche Vorwürfe, die je gegen dieses Institut erhoben wurden, in den Schatten.
»Ich lasse lieber die Finger vom Spekulieren und befasse mich mit den Tatsachen.« Ich öffne die Beifahrertür.
»Genau das ist ja der springende Punkt, dass wir momentan nichts in der Hand haben, was wirklich Sinn ergibt.«
»Hast du General Briggs dasselbe erzählt wie gerade mir?«
»Nur das, was er wissen musste«, erwidert Marino.
»Dasselbe, was du mir erzählt hast?«, wiederhole ich meine Frage.
»Mehr oder weniger.«
»Das hättest du nicht tun dürfen. Es wäre meine Aufgabe gewesen. An mir liegt es, zu entscheiden, wie weit er eingeweiht werden soll.« Die Beifahrertür steht weit offen. Wind weht herein. Da ich noch feuchte Haare vom Duschen habe, fröstle ich. »Man ignoriert nicht einfach den Dienstweg, nur weil ich beschäftigt bin.«
»Nun, du warst aber schwer beschäftigt, und so habe ich es ihm gesagt.«
Beim Aussteigen rede ich mir ein, dass Marinos Schilderung unmöglich auf Fakten beruhen kann. Dem Rettungsdienst von Cambridge würde niemals ein so fataler Fehler unterlaufen. Also zermartere ich mir das Hirn nach einer Erklärung, warum eine tödliche Verletzung am Fundort zunächst nicht blutet und dann plötzlich heftig zu bluten beginnt. Dann denke ich über den Todeszeitpunkt und die Todesursache eines Menschen nach, der in der Kühlkammer meines Rechtsmedizinischen Instituts gestorben ist. Ich bin ratlos und tappe völlig im Dunkeln. Und vor allem mache ich mir Sorgen um ihn, diesen jungen Mann, der, angeblich tot, in mein Institut eingeliefert worden ist. Ich stelle ihn mir in ein Laken gewickelt und in einem verschlossenen Leichensack vor. Stoff für alte Gruselmärchen. Ein Mensch, der im Sarg wieder zu sich kommt. Bei lebendigem Leib begraben wird. Noch nie ist mir so etwas Grausiges passiert, nicht einmal annähernd, kein einziges Mal in meiner gesamten beruflichen Laufbahn. Und ich kenne auch sonst niemanden, dem es untergekommen wäre.
»Wenigstens deutet nichts darauf hin, dass er sich aus dem Leichensack befreien wollte.« Marino gibt sich Mühe, uns beide aufzumuntern. »Kein Hinweis darauf, dass er irgendwann aufgewacht und in Panik geraten ist. Du weißt schon, Zerren am Reißverschluss, Strampeln oder so. Wenn er sich gesträubt hätte, hätte er schief auf der Bahre gelegen, als wir ihn heute Morgen gefunden haben. Vielleicht wäre er sogar runtergefallen. Bei genauerem Nachdenken bin ich allerdings nicht sicher, ob man in diesen Dingern nicht erstickt. Wahrscheinlich schon, weil sie ja angeblich wasserdicht sind. Aber sie lecken trotzdem. Zeig mir einen Leichensack, der nicht leckt. Und da wäre noch etwas: die Blutstropfen auf dem Boden, die von der Anlieferungszone in die Kühlkammer führen.«
»Warum verschieben wir dieses Gespräch nicht auf später?« Es ist gerade Zeit fürs Einchecken. Als wir auf die moderne, aber schlicht verputzte Fassade des Hotels zugehen, wimmelt der Parkplatz von Menschen, und Marinos Stimme klingt so laut, als spräche er in einem Amphitheater.
»Ich glaube kaum, dass Fielding sich die Mühe gemacht hat, die Aufnahmen anzusehen«, fährt Marino dennoch fort. »Überhaupt bezweifle ich, dass er auch nur einen Finger gerührt hat. Ich habe den Schwachkopf seit heute Morgen nicht mehr zu Gesicht gekriegt. Spurlos verschwunden, wie schon so oft.« Er öffnet die Glastür. »Hoffentlich müssen wir seinetwegen nicht dichtmachen, verdammt. Wäre das nicht ein Witz? Du tust dem Idioten einen Gefallen und gibst ihm einen Job, obwohl er sich beim letzten Mal einfach verdrückt hat. Und er versetzt dem Institut den Todesstoß, noch ehe wir richtig angefangen haben.«
In der mit Vitrinen voller Orden und Souvenirs der Air Force, bequemen Sesseln und einem riesigen Flachbildschirmfernseher ausgestatteten Vorhalle begrüßt ein Schild die Gäste in der Heimat der C-5 Galaxy und der C-17 Globemaster III. An der Rezeption reihe ich mich schweigend hinter einem Soldaten in der Kampfuniform der Army mit ihrem gedeckten Muster aus durchbrochenen Tigerstreifen ein, der Rasierschaum, Wasser und einige Minifläschchen Scotch, Marke Johnnie Walker, kauft. Dann teile ich dem Mann am Empfang mit, dass ich früher abreise als geplant. Ja, ich werde nicht vergessen, meinen Schlüssel abzugeben. Und natürlich sei mir klar, dass ich den für Staatsbedienstete üblichen Preis von achtunddreißig Dollar pro Tag bezahlen müsse, obwohl ich die Nacht nicht hier verbringen würde.
»Wie heißt es noch mal so schön?«, spricht Marino weiter. »Keine gute Tat bleibt ungesühnt.«
»Wir sollten uns bemühen, nicht so negativ zu sein.«
»Wir beide haben gute Positionen in New York aufgegeben und das Büro in Watertown geschlossen. Und jetzt haben wir den Salat.«
Ich schweige.
»Ich hoffe nur, dass wir unsere Karrieren nicht in den Sand gesetzt haben, verdammt«, ergänzt er.
Ich antworte nicht, denn ich habe genug gehört. Als wir an den Läden und Verkaufsautomaten vorbeigehen und die Treppe in den ersten Stock hinaufsteigen, teilt er mir endlich mit, dass Lucy uns nicht am Helikopter auf dem Zivilflugplatz erwartet. Sie ist in meinem Zimmer, wo sie meine Sachen packt, sie berührt, Entscheidungen über sie fällt, meinen Wandschrank und meine Schubladen leert und meinen Laptop, meinen Drucker und mein Navigationsgerät abbaut. Er hat diese Information bis jetzt zurückgehalten, weil er weiß, dass ich mich unter gewöhnlichen Umständen unglaublich darüber ärgern würde, obwohl ich meine Nichte – Computergenie und ehemalige FBI-Agentin – wie eine Tochter großgezogen habe.
Allerdings sind die Umstände alles andere als gewöhnlich, und so bin ich erleichtert, dass Marino hier ist, dass Lucy sich in meinem Zimmer aufhält und dass die beiden gekommen sind, um mich abzuholen. Ich muss nach Hause, um zu retten, was noch zu retten ist. Wir folgen dem langen, mit einem dunkelroten Teppich belegten Flur und passieren eine mit Möbeln im nachgeahmten Kolonialstil geschmückte Empore mit einem elektrischen Massagestuhl, den ein fürsorglicher Mensch für müde Piloten aufgestellt hat. Während ich den Kartenschlüssel ins Schloss meiner Zimmertür stecke, frage ich mich, wer Lucy wohl hereingelassen hat. Im nächsten Moment denke ich wieder an Briggs und CNN. Ein Fernsehauftritt kommt nun nicht mehr in Frage. Was, wenn die Medien Wind von dem Zwischenfall in Cambridge bekommen haben? Doch das würde ich inzwischen wissen. Marino ebenfalls. Bryce, mein Verwaltungschef, würde mir sofort Bericht erstatten. Also wird alles gut.
Lucy sitzt auf meinem ordentlich gemachten Bett und schließt gerade meinen Kosmetikkoffer. Als ich sie umarme, steigt mir der frische Zitrusduft ihres Shampoos in die Haare, und mir wird klar, wie sehr ich sie vermisst habe. Der schwarze Pilotenoverall betont ihre kühn wirkenden grünen Augen, das kurze rötlich blonde Haar, die markanten Züge und ihre schlanke Figur. Wieder einmal erkenne ich, dass sie auf ungewöhnliche Weise atemberaubend gut aussieht, jungenhaft, aber weiblich, muskulös, aber mit Brüsten, und so leidenschaftlich, dass sie bedrohlich wirkt. Ganz gleich, ob meine Nichte ausgelassen oder höflich ist, sie neigt dazu, andere einzuschüchtern, und hat deshalb nur wenige Freunde außer Marino. Ihre Liebesbeziehungen halten nie lange. Nicht einmal die mit Jaime Berger, obwohl ich meinen Verdacht noch nicht ausgesprochen habe. Ich habe nicht nachgefragt, doch ich nehme Lucy die Geschichte nicht ab, dass sie aus finanziellen Gründen von New York nach Boston gezogen ist. Selbst wenn es mit ihrem auf Computerermittlungen spezialisierten Unternehmen bergab ging, was ich auch nicht glaube, hat sie in Manhattan um einiges mehr verdient als das klägliche Gehalt, das mein Institut ihr bezahlt. Meine Nichte arbeitet quasi ehrenamtlich für mich. Sie hat das Geld nicht nötig.
»Was war mit dem Satellitenradio?« Ich beobachte sie aufmerksam und versuche, ihre wie immer unterschwelligen und widersprüchlichen Signale zu deuten.
Kapseln klappern, als sie nachprüft, wie viele Advils noch in dem Döschen sind. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich das Einpacken angesichts der geringen Menge nicht lohnt, und wirft die Kopfschmerztabletten in den Papierkorb. »Eine Schlechtwetterfront zieht auf. Deshalb möchte ich so schnell wie möglich verschwinden.« Sie öffnet ein Döschen Zantac und entsorgt es ebenfalls. »Wir können uns unterwegs unterhalten. Außerdem brauche ich deine Hilfe als Copilotin, weil wir es auf dem Flug mit Schneeschauern und Eisregen zu tun bekommen werden. Zu Hause ist ein halber Meter Schnee angesagt. Gegen zehn soll es anfangen zu schneien.«
Mein erster Gedanke gilt Norton’s Woods. Ich muss dem Fundort unbedingt einen Besuch abstatten, doch bis ich dort bin, wird alles verschneit sein. »Wie dumm«, antworte ich. »Wir haben nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach einen Tatort, der nie als solcher untersucht worden ist.«
»Ich habe die Polizei von Cambridge heute Morgen gebeten, sich noch einmal umzuschauen.« Marinos Blick gleitet neugierig durch den Raum, als wäre es mein Zimmer, das durchsucht werden müsste. »Sie haben nichts gefunden.«
»Haben sie dich gefragt, warum sie überhaupt suchen sollten?« Wieder die Besorgnis.
»Ich habe erklärt, wir hätten noch Zweifel, und alles auf die Glock geschoben. Die Seriennummer wurde abgefeilt. Ich glaube, das habe ich dir noch nicht erzählt«, fügt er hinzu, sieht sich um und betrachtet alles außer mir.
»Im Waffenlabor können sie versuchen, die Seriennummer mit Säure wieder sichtbar zu machen. Wenn alles scheitert, probieren wir es mit dem Großkammer-Rasterelektronenmikroskop«, entgegne ich. »Falls noch Spuren vorhanden sind, finden wir sie. Außerdem werde ich Jack bitten, nach Norton’s Woods zu fahren und alles unter die Lupe zu nehmen.«
»Klar, und er wird sich bestimmt gleich an die Arbeit machen«, höhnt Marino.
»Er kann fotografieren, ehe es zu schneien anfängt«, spreche ich weiter. »Oder ein anderer erledigt das. Wer hat denn Dienst …?«
»Zeitverschwendung«, gibt Marino zurück. »Von uns war gestern niemand da. Deshalb wissen wir nicht einmal, wo genau die verdammte Stelle ist – nur, dass es neben einem Baum und einer grünen Bank passierte. Sehr hilfreich bei zweieinhalb Hektar Grund, wo es von Bäumen und grünen Bänken nur so wimmelt.«
»Was ist mit Fotos?«, frage ich, während Lucy weiter die Salben, Schmerzmittel, Magentabletten, Vitamine, Augentropfen und Handdesinfektionsmittel aus meiner kleinen Hausapotheke durchgeht und sie auf dem Bett ausbreitet. »Die Polizei muss doch Fotos von der Leiche am Fundort angefertigt haben.«
»Ich warte noch immer darauf, dass der Detective sie mir zukommen lässt. Der Typ, der als Erster am Fundort war, hat die Pistole heute Morgen im Labor abgegeben. Lester Law, genannt Les Law. Auf der Straße heißt er nur Lawless – der Gesetzlose –, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Die Polizisten von Cambridge können ihren Stammbaum bis zur bescheuerten Mayflower zurückverfolgen. Bin ihm bis jetzt noch nicht begegnet.«
»Ich denke, das wär’s.« Lucy steht vom Bett auf. »Vielleicht solltest du dich vergewissern, dass ich nichts vergessen habe«, meint sie zu mir.
Papierkörbe quellen über, gepackte Taschen sind an der Wand aufgereiht, die Schranktür steht weit offen. Bis auf die Kleiderbügel ist der Schrank leer. Computerausrüstung, Ausdrucke, Zeitschriftenartikel und Bücher sind von meinem Schreibtisch verschwunden. Es ist nichts im Schmutzwäschekorb, im Bad oder in den Kommodenschubladen zurückgeblieben, die ich überprüfe. Als ich den kleinen Kühlschrank öffne, ist er ausgeräumt und geputzt. Während Lucy und Marino meine Sachen hinaustragen, suche ich Briggs’ Nummer in meinem iPhone. Dabei betrachte ich das dreistöckige verputzte Gebäude auf der anderen Seite des Parkplatzes, das im zweiten Stock eine gewaltige Glasfront aufweist. Gestern Abend war ich mit ihm und einigen anderen Kollegen in jener Suite, um mir das Spiel anzuschauen. Das Leben war schön. Wir feuerten die New Orleans Saints und uns selbst an und brachten Trinksprüche auf das Pentagon und das Institut für Rüstungsforschung, DARPA, aus, das es ermöglicht hat, in Dover und nun auch am CFC, meinem Institut, CT-unterstützte virtuelle Autopsien durchzuführen. Wir feierten den Abschluss eines Projekts und eine großartige Leistung. Und nun das. Es ist, als hätte der letzte Abend nicht wirklich stattgefunden. So als hätte ich ihn nur geträumt.
Ich hole tief Luft und drücke auf »Anrufen«. Ein hohles Gefühl breitet sich in mir aus. Sicher ist Briggs nicht zufrieden mit mir. Bilder flackern über den an der Wand befestigten Flachbildschirmfernseher in seinem Wohnzimmer. Im nächsten Moment geht er an dem Gerät vorbei. Er trägt die Kampfuniform der Army, grün und sandbraun mit Stehkragen, die er immer anhat, wenn er nicht gerade im Autopsiesaal oder an einem Tatort ist. Ich beobachte, wie er den Anruf annimmt und zu dem großen Fenster zurückkehrt, wo er innehält und mich ansieht. Getrennt von einer geteerten Fläche und geparkten Autos, stehen wir, der Chief Medical Examiner der Streitkräfte und ich, einander gegenüber, als wollten wir uns duellieren.
»Colonel«, begrüßt mich seine nüchterne Stimme.
»Ich habe es gerade erst erfahren. Und ich versichere Ihnen, dass ich mich darum kümmern werde. Noch innerhalb der nächsten Stunde fliege ich mit dem Helikopter los.«
»Wissen Sie, was ich immer sage?« Als seine dunkle, befehlsgewohnte Stimme durch den Hörer dringt, versuche ich, seinem Tonfall zu entnehmen, wie verärgert er ist und was er unternehmen wird. »Auf alles gibt es eine Antwort. Das einzige Problem ist, sie zu finden, und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Mit einer Methode, die der Situation angemessen ist.« Er ist kühl. Er ist vorsichtig. Und sehr ernst. »Wir holen es ein andermal nach«, fügt er hinzu.
Damit meint er die geplante Abschlusssitzung. Außerdem bin ich sicher, dass er auch auf CNN anspielt, und frage mich, was Marino ihm wohl erzählt haben mag. Wie präzise hat er sich ausgedrückt?
»Ganz Ihrer Ansicht, John. Wir sollten alles absagen.«
»Ist bereits geschehen.«
»Sehr gut.« Ich klinge ganz sachlich, damit er mir meine Zweifel nicht anmerkt, denn ich weiß verdammt gut, dass er mich darauf abklopft.
»Kein guter Zeitpunkt für Sie, vor die Kamera zu treten. Das brauchte Rockman uns nicht eigens zu erklären.«
Rockman ist der Pressesprecher. Briggs muss nicht mehr mit ihm reden, weil er es schon getan hat. Da bin ich ganz sicher.
»Verstehe«, entgegne ich.
»Ein bemerkenswertes Timing. Wenn ich an Verfolgungswahn litte, könnte ich fast glauben, dass jemand eine Art Sabotageakt gegen Sie verüben wollte.«
»Angesichts der Informationen, die man mir gegeben hat, sehe ich nicht, wie das möglich gewesen sein sollte.«
»Ich sagte, wenn ich an Verfolgungswahn litte«, wiederholt Briggs. Von meinem Standort aus kann ich zwar seine beeindruckend kräftige Gestalt sehen, allerdings nicht seinen Gesichtsausdruck. Doch das ist überflüssig. Er lächelt nicht, und seine grauen Augen erinnern an gehärteten Stahl.
»Das Timing ist entweder Zufall oder Absicht«, erwidere ich. »So lautet ein Grundsatz in der Kriminalistik, John. Es ist immer das eine oder das andere.«
»Wir wollen die Sache keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.«
»Nichts läge mir ferner.«
»Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Menschen bei lebendigem Leib in Ihre verdammte Kühlkammer zu stecken«, meint er knapp.
»Wir wissen noch nicht …«
»Nach der vielen Mühe ist es eine gottverdammte Schande.« Als ob alles, was wir im Lauf der letzten Jahre aufgebaut haben, am Rand des Abgrunds stünde.
»Wir können nicht sicher sein, ob die Berichte stimmen …«, setze ich an.
»Ich halte es für das Beste, die Leiche herzubringen«, fällt er mir wieder ins Wort. »Das DNA-Labor könnte mit der Identifizierung beginnen. Rockman wird dafür sorgen, dass die Angelegenheit unter Verschluss bleibt. Wir haben hier alles, was wir brauchen.«
Ich bin wie vor den Kopf geschlagen. Briggs will ein Flugzeug nach Hanscom Field beordern, dem Luftwaffenstützpunkt, der mit meinem CFC zusammenarbeitet. Das DNA-Identifizierungslabor der Streitkräfte und vermutlich auch noch andere Labors des Militärs sollen sich mit diesem, meinem Fall befassen, weil er mich als inkompetent einstuft und mir nicht traut.
»Wir können noch nicht sagen, ob dieser Fall Bundesangelegenheit ist«, wende ich ein. »Außer Sie wissen mehr als ich.«
»Hören Sie. Ich will nur das Beste für alle Beteiligten.« Briggs hat die Hände hinter dem Rücken verschränkt und die Beine leicht gespreizt. Über den Parkplatz hinweg starrt er zu mir hinüber. »Ich schlage vor, eine C-17 nach Hanscom zu schicken. Dann hätten wir die Leiche um Mitternacht hier. Das CFC ist ebenfalls ein Rechtsmedizinisches Institut der Streitkräfte, und dazu sind solche Einrichtungen da.«
»Sind sie nicht. Wir haben nicht die Aufgabe, Leichen vorübergehend anzunehmen und sie dann zur Autopsie und Laboranalyse anderswohin weiterzuschicken. Das CFC war nie als Stelle geplant, die Dover zuarbeitet und vorläufige Untersuchungen durchführt, bevor sich die wahren Fachleute ans Werk machen. Das war niemals meine Arbeitsplatzbeschreibung, und es stand auch nicht im Vertrag, als dreißig Millionen Dollar in das Institut in Cambridge gesteckt wurden.«
»Bleiben Sie einfach in Dover, Kay. Wir holen die Leiche her.«
»Ich bitte Sie, sich nicht einzumischen, John. Im Moment unterliegt dieser Fall dem Zuständigkeitsbereich des Chief Medical Examiner von Massachusetts. Bitte, hinterfragen Sie weder mich noch meine Autorität.«
Eine lange Pause entsteht. »Sie wollen also wirklich die Verantwortung übernehmen.« Das ist eine Feststellung, keine Frage.
»Es ist meine Verantwortung, ob ich nun will oder nicht.«
»Ich habe nur versucht, Sie zu schützen.«
»Lassen Sie es.« Das war ganz und gar nicht seine Absicht. Er hat kein Vertrauen zu mir.
»Ich kann Captain Avallone zu Ihrer Unterstützung abstellen. Das wäre doch keine schlechte Idee.«
Ich traue meinen Ohren nicht. »Das wird nicht nötig sein«, entgegne ich mit Nachdruck. »Das CFC ist durchaus in der Lage, den Fall zu bearbeiten.«
»Mein Angebot wurde vermerkt.«
Vermerkt von wem? Mir kommt der beunruhigende Gedanke, dass eine dritte Person am Telefon oder im Raum mithören könnte. Briggs steht noch immer am Fenster. Ich kann nicht erkennen, ob sich sonst jemand in der Suite aufhält.
»Ihre Entscheidung«, meint er zu mir. »Ich werde Ihnen keine Steine in den Weg legen. Rufen Sie mich an, sobald Sie neue Erkenntnisse haben. Wenn es sein muss, wecken Sie mich.« Er verabschiedet sich weder, noch wünscht er mir viel Glück oder sagt, dass er sich über meinen sechsmonatigen Aufenthalt hier gefreut hat.