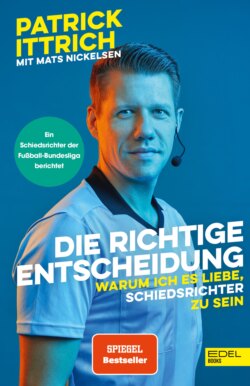Читать книгу Die richtige Entscheidung - Patrick Ittrich - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
KAPITEL 2 „DAS WÄRE DOCH WAS FÜR DICH!“ – ANFÄNGE IN MÜMMELMANNSBERG
ОглавлениеAls kleiner Junge wollte ich unbedingt Schiedsrichter werden. Bereits im Kindergarten griff ich beim Kampf ums Spielzeug schlichtend ein. Mein größter Traum: im schwarzen Trikot und mit einer Pfeife im Mund für Gerechtigkeit auf dem Fußballplatz zu sorgen … Schöne Geschichte, oder? Leider zu schön, um wahr zu sein.
Ich wollte einfach nur Fußball spielen. Die Schiedsrichter waren mir total egal.
Mein Vater hatte früher in Polen selbst gespielt, sein Lieblingsverein war Lechia Danzig. Fußball war bei uns zu Hause immer ein Thema, also tat ich das, was Hunderttausende Kinder tun, ich ging zum Fußballtraining. Ich war fünf Jahre alt, der Verein hieß Mümmelmannsberger SV. Mitglied bin ich bis heute, der MSV ist mein Verein. Ein TV-Kommentator brachte meinen Club mal groß raus, als ich kurz vor Ostern ein Spiel in Frankfurt pfiff: „Bald ist Ostern, und woher kommt der Schiedsrichter? Vom Mümmelmannsberger Sportverein!“
Die Hasen sind das Markenzeichen meiner Heimat, die bei den Hamburgern viele Spitznamen hat, einer davon lautet „Bunny Hill“. Als das Viertel errichtet wurde, gab es dort wohl viele Hasen, also wurde eine Straße Mümmelmannsberg getauft, später hieß die ganze Siedlung so.
Die Hasen sind das eine, der Ruf der Gegend das andere. Mümmelmannsberg im Stadtteil Billstedt gilt als geradezu klassischer sozialer Brennpunkt, wie ihn jede richtige Großstadt aufzuweisen hat, ein Hochhausghetto auf drei Quadratkilometern. In „Mümmel“ – ein anderer Spitzname – leben knapp 18 000 Menschen aus aller Welt. Die Großwohnsiedlung entstand in den 1970er-Jahren für Spätaussiedler – meine Eltern waren aus Polen nach Hamburg gekommen – und Arbeiter.
Wer jetzt die große Aufsteigerstory erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich hatte eine super Kindheit und bekam alles, was ich brauchte. Vor allem hatte ich großartige Eltern. Mein Vater und meine Mutter haben mich geprägt, als Einzelkind hatte ich eine sehr enge Bindung zu ihnen. Meine Mutter war eine lebensfrohe Frau, die viel lachte und immer offen auf andere Menschen zuging. Bis ich zehn Jahre alt war, blieb sie zu Hause, später arbeitete sie in der Küche eines Pflegeheims. Mein Vater arbeitete als Schlosser auf dem Bau. Von ihm habe ich den Ehrgeiz mit auf den Weg bekommen. Was man anfängt, bringt man auch zu Ende. Nicht aufgeben, auch wenn es Rückschläge gibt. Meine Eltern sind beide leider verstorben, ich denke oft an sie, zum Beispiel, wenn ich kurz vor dem Anpfiff das Spielfeld betrete.
Aber es stimmt schon, Mümmelmannsberg war in meiner Kindheit ein sozial schwacher, auch gefährlicher Stadtteil mit hoher Kriminalitätsrate. Wir wohnten in der Nähe der Bundesstraße fünf, der Fußballplatz lag am Ende der Kandinskyallee. Ich musste mich also jedes Mal quer durch die gesamte Siedlung kämpfen, um dorthin zu gelangen. Es bestand die reelle Gefahr, auf dem Weg durch den Häuserdschungel Prügel zu kassieren oder abgezogen zu werden. Zumindest musste man abschätzen können, wann es angebracht war, seine Beine in die Hand zu nehmen. Ich kannte jeden Schleichweg.
Auf Dauer konnte es so nicht weitergehen, ein Plan musste her. Mich einer der Straßengangs anschließen? Das erschien mir keine sinnvolle Option. Beim Fußball Verbündete zu finden dagegen schon. Wir spielten nicht nur im Verein beim MSV, sondern auch in jeder freien Minute in den Hinterhöfen unserer Wohnblöcke. Da waren ein paar richtig gute Kicker dabei, klassische Straßenfußballer. Über Ecken kannte jeder jeden und bald hieß es: „Das ist Patrick vom Fußball, lass den mal in Ruhe.“
Fußball wurde mein Ein und Alles. Lag ich mal krank im Bett, war das eine doppelte Strafe. Ich wollte immer raus auf den Platz. Als Rechtsaußen war ich laufstark, technisch ganz ordentlich und vor allem hoch motiviert. Irgendwann fiel ich den Talentspähern des Hamburger SV auf, ich bekam das Angebot, dreimal in der Woche beim HSV in Ochsenzoll zu trainieren – inklusive Abholung und Fahrservice ab Mümmelmannsberg!
Um eines aber vorwegzunehmen: Aus mir wäre niemals ein Profi geworden. Schon mit zwanzig hatte ich zwei Kreuzbandrisse, aber selbst ohne Verletzungen und mit voller Konzentration auf den Fußball hätte es maximal für die Regionalliga gereicht. Außerdem hatte ich damals gar nicht den Kopf, um alles dem Fußball unterzuordnen. Meine Haare waren rot gefärbt – Spitzname Pumuckl – als 15-Jähriger hielt ich das für eine gute Idee. Inmitten meiner jugendlichen Selbstfindungsphase wollte ich gar nicht weg aus Mümmelmannsberg. Hier war ich zu Hause.
Mein Verein, der MSV, hatte dasselbe Problem wie alle Amateurclubs. Er brauchte dringend Schiedsrichter. Das ist nämlich vorgeschrieben, bis heute. Wer beispielsweise drei Mannschaften für den Spielbetrieb meldet, muss auch drei Schiedsrichter auf die Sportplätze der Region schicken. Irgendwie muss der Spielbetrieb schließlich am Laufen gehalten werden. Fand man keine Freiwilligen, wurde ein Strafgeld an den Landesverband fällig. Darauf hatten die Vereinsverantwortlichen verständlicherweise wenig Lust, also bearbeiteten sie uns Spieler. Sie versuchten, die Schiedsrichttätigkeit erst gar nicht als große Chance oder persönlichkeitsfördernde Lebensschule zu verkaufen, sondern waren ehrlich: „Wir brauchen Leute für den Lehrgang, bitte tut uns den Gefallen!“ Wie Eltern, die ihre Kinder zum Schneeschippen oder anderen notwendigen Aufgaben verdonnern wollen – lästig, aber komm, wird schon nicht so schlimm. Es musste ja auch niemand aufhören, selbst Fußball zu spielen, es ging lediglich darum, ab und zu mal ein Spiel zu pfeifen.
Die vielversprechendere Taktik der Vereinsverantwortlichen war, die aktiven Nachwuchsschiedsrichter für die Akquise zu gewinnen. Meine Vereinskumpels Khaled Baghban und Kevin Oje hatten den Schirischein bereits gemacht und – welch Überraschung – das Schneeschippen machte den beiden sogar Spaß! Und sie erzählten es weiter: „Patrick, das wäre auch was für dich!“
Ich aber hatte keinen Bock. Ich wollte Fußball spielen, nicht die Seite wechseln. Ich gebe zu: ich war ein unangenehmer Zeitgenosse für die Schiedsrichter. Ich diskutierte und wusste alles besser. Einmal flog ich mit Gelb-Rot vom Platz – beide Gelbe Karten gab es wegen Meckerns. Heute treffe ich auf dem Platz gelegentlich auf Profis, bei denen ich feststelle: Ich war früher genauso emotional drauf.
Im August 1994 – ich war 15 – hatten sie mich dann so weit: Ich meldete mich zum Lehrgang an. Freitag und Samstag Regelschulung im Clubhaus, Sonntag der Test. Herzlichen Glückwunsch, du bist Schiedsrichter!
So läuft es auch heute noch. Einzige Voraussetzungen: Mindestalter 14 Jahre (in manchen Landesverbänden auch zwölf Jahre) und Mitgliedschaft in einem Fußballverein. Der Konditionstest kommt erst später, beim Aufstieg in höhere Ligen.
Der Anwärterkurs liefert die absolute Grundlage. Nicht mehr und nicht weniger. Was es wirklich bedeutet, Schiedsrichter zu sein, muss jeder selbst herausfinden. Zunächst mal leitete ich einige Jugendspiele und zog als Assistent – oder Linienrichter, wie man damals noch sagte – mit den erfahrenen Haudegen durch Hamburgs Kreis- und Bezirksligen. Was soll ich sagen: Es war großartig! Der Bezirksschiedsrichterausschuss Ost wurde meine neue sportliche Heimat. Ich fühlte mich als Mannschaftssportler
immer am wohlsten, wenn ich Menschen um mich herum hatte. Die alten Haudegen beeindruckten mich. Sie verfolgten keine sportlichen Ziele, es ging ihnen nicht um die paar Mark fünfzig, sie waren Schiedsrichter, weil es ihnen Spaß machte. Eine Herzensangelegenheit eben. Manche Einsätze, die sonntags um 15.00 Uhr begannen, endeten in einer der Hamburger Fußballkneipen.
„Na Patrick, gestern ein Spiel gehabt?“, fragte mich der Meister, wenn ich montags morgens in der Lehrwerkstatt noch nicht so richtig fit wirkte – ich machte damals eine Ausbildung zum Industriemechaniker und baute Fahrtreppen.
Ein netter Nebeneffekt meiner Anfangszeit waren die paar Mark als kleiner Nebenverdienst und die Freikarten für Spiele des FC St. Pauli und des Hamburger SV. Vor den Stadien gab es Kassenhäuschen mit der Aufschrift „Schiedsrichterkarten“, dort zeigten wir unsere Ausweise und bekamen gratis Tickets – ein Dankeschön für die jungen Unparteiischen und ganz nebenbei auch ein nicht zu unterschätzender Köder für Unentschlossene, die noch haderten, ob sie den Schiedsrichterschein wirklich machen sollten. Für lau zum HSV und zu St. Pauli, das war schon ganz cool als junger Fußballfan. Man musste allerdings auch mindestens vierzehn Spiele pro Saison pfeifen, um den Schein zu verlängern – inzwischen reichen zehn. In meinen Augen handelte es sich um eine klassische Win-win-Situation. Ich bekam Freikarten, der Verein hatte einen Schiedsrichter. Die Nachwuchsakquise war das eine, den Nachwuchs bei der Stange zu halten, das andere. Die meisten hören nämlich irgendwann wieder auf, weil sie keine Lust mehr haben, weil es zeitaufwändig ist …
Mit unseren Freikarten durften wir nicht auf die Haupttribüne, und unsere Herausforderung bestand darin, es trotzdem zu schaffen. Vor der Bundesligapartie gab es immer ein Jugendspiel im Stadion. Mein Kumpel Khaled und ich erzählten den Ordnern, dass wir die Schiedsrichter für dieses Nachwuchsspiel wären und sie uns jetzt dringend durchlassen müssten. Das stimmte in den seltensten Fällen, ab und zu klappte der Trick aber. Manchmal jedoch durften wir tatsächlich so ein Spiel im Bundesligastadion leiten, das war dann natürlich das Allergrößte.
Mein erstes Herrenspiel pfiff ich am Sonntag, den 3. März 1996. Fatihspor II gegen Kosova II. Kreisklasse. Schlackeplatz – der mit der roten Asche, auf dem nur die ganz Harten zur Grätsche ansetzen.
Bei meiner Ankunft am Sportplatz im Hamburger Stadtteil Hamm erblickte ich zwei Streifenwagen. Im Hinspiel hatten sich Spieler und Zuschauer heftige Auseinandersetzungen geliefert, soweit wollte man es diesmal nicht kommen lassen. Da stand ich nun mit meinen 17 Jahren. Dann sind da halt Polizisten, wird schon. Ich war jung und naiv. Das war vielleicht auch ganz gut so. Ich machte mir jedenfalls keine übertriebenen Gedanken. Es war ja auch nicht so, dass ich als Mümmelmannsberger Junge noch nie einen Streifenwagen gesehen hätte.
Das Spiel begann um 10.45 Uhr, ohne Assistenten. 22 Spieler und ich. Honorar: 15 Mark. Mein Vater erschien kurz vor Schluss auf dem Sportplatz, um mich abzuholen. Ich hatte am Nachmittag mit der zweiten Mannschaft des MSV nämlich selbst noch ein Spiel.
Am Spielfeldrand stand ein Mann, der für den weiteren Verlauf meiner Karriere entscheidend werden sollte. An diesem Sonntagmorgen im März 1996 schaute er ganz genau, wie ich mich verhielt. Sein Name: Uwe Albert. Uwe war Obmann und Schiedsrichterbeobachter im Bezirksschiedsrichterausschuss Ost. Was genau so ein Beobachter tat, lernte ich schnell. Es ging nicht darum, mir vor dem Spiel Tipps zu geben oder „das Händchen zu halten“. Nein, Schiedsrichterbeobachter stehen am Rand, machen sich Notizen und schreiben eine Bewertung. Ein richtiges kleines Zeugnis. Ein paar Tage nach dem Spiel bekam ich das Werk.
Uwe attestierte mir ein „unglaublich ruhiges, abgeklärtes Auftreten“ mit dem „stets richtigen Umgangston“ und kam zu dem Schluss: „Ittrich hatte das Spiel jederzeit voll unter Kontrolle, auch gelangen ihm mehrere gute Vorteilssituationen, die aber durch das Unvermögen der Spieler nicht von Erfolg gekrönt waren.“
Zur Erinnerung, wir reden hier von der Kreisklasse. Die Spieler wollten lieber den Freistoß als den Vorteil. Erstmal durchatmen und dann den Ball nach vorn schlagen, anstatt schnell weiterzuspielen.
Meine Bewertungen habe ich über all die Jahre fein säuberlich in Ordnern abgeheftet – Zeugnisse wirft man ja schließlich auch nicht weg. Die Feinheiten des Regelwerks hatte ich nach meinem dreitägigen Anwärterkurs allerdings noch nicht ganz verinnerlicht:
„ … lag regeltechnisch einmal voll daneben. Unterbrechung des laufenden Spiels wegen Meckerns eines Spielers, zu Recht Verwarnung. Die richtige Spielfortsetzung ist jedoch ein indirekter Freistoß und nicht – wie entschieden – Schiedsrichterball!!!“
Ja, Uwe notierte tatsächlich drei Ausrufezeichen. Vor Regeltests war ich übrigens in meiner gesamten Laufbahn immer angespannter als vor Fitnesstests. Niemand kennt sofort alle Regeln. Das erwartet aber auch keiner von einem Neuling.
„Insgesamt eine sehr ansprechende Leistung mit durchaus guten bis sehr guten Perspektiven für eine Schiedsrichterlaufbahn.“
Uwe Albert hatte es als Assistent bis in die Bundesliga geschafft, er kannte sich aus und merkte, dass mir die Rolle des Spielleiters lag. Ich fühlte mich wohl auf dem Platz. Zudem war ich als junger Fußballer fit und konnte viel laufen, damit verschaffte ich mir Akzeptanz. Ich war schnell da, wo es brannte. Die Spieler akzeptieren eine Entscheidung dann eher, als wenn der Pfiff aus 30 Metern Entfernung kommt. (Zu dicht sollte man allerdings auch nicht dran sein, dazu später mehr.)
Uwe wurde mein Mentor und Ratgeber. Seine Zeit als hochklassiger Schiedsrichter war vorbei, nun kümmerte er sich im Bezirksschiedsrichterausschuss Ost um den Nachwuchs und schrieb Beobachtungen. Ab und an pfiff er selbst auch noch mal ein Spiel. Wir waren oft zusammen im Gespann unterwegs. Von ihm lernte ich, wie das so funktioniert als Schiedsrichter. Und was ich besser lassen sollte. Ich war durch und durch Fußballer und konnte meine Füße nicht stillhalten. Während Spielunterbrechungen dribbelte ich gerne mal mit dem Ball, hielt ihn zwei, drei Mal hoch – Uwe würde sagen, eher drei, vier Mal – und köpfte ihn dann zum Spieler, der zum Einwurf oder Freistoß bereitstand. Nachdem ich bei einer Partie mal wieder mit so einer Showeinlage geglänzt hatte, gab Uwe mir bei einem Hefeweizen den freundlichen Rat, auf so etwas lieber zu verzichten.
In der Bundesliga ist es unbedingt notwendig, dem Reiz des Balles zu widerstehen. In einem Bundesligastadion gibt es allzu viele Kameras. Beim Rauskommen zur zweiten Halbzeit habe ich den Ball in der Hand, trage ihn ganz in Ruhe zur Mitte, versuche beim Betreten des Rasens keinen 25-Meter-Pass in den Anstoßkreis. Na klar, wenn der Ball bei einem solchen Passversuch an der Eckfahne landet, hat das ganze Stadion etwas zu lachen und die Szene schafft es garantiert in jede Spielzusammenfassung. Aber das würde das alte Vorurteil befeuern: Schiedsrichter sind Schiedsrichter geworden, weil sie als Kicker nicht gut genug waren.
Neben der Schiedsrichterei spielte ich weiterhin beim Mümmelmannsberger SV in der Mannschaft. Samstags kicken, sonntags pfeifen oder andersrum, das ging eine Zeit lang gut. Irgendwann kam es aber unausweichlich zu Terminkollisionen, ich musste mich entscheiden. Am Sonntag standen zwei wichtige Bezirksligaspiele an, morgens Erster gegen Dritter, nachmittags Zweiter gegen Vierter. Ich sollte morgens pfeifen, Uwe sollte einer meiner Assistenten sein. Am Nachmittag umgekehrt: Uwe sollte das Spiel leiten und ich assistieren. Am Donnerstag rief mich der Trainer der ersten Herren des MSV an, sie hatten Personalprobleme, ich sollte am Sonntagnachmittag einspringen. Mein Fußballerherz schlug höher. Was für eine Frage: Klar, ich bin dabei!
Nun musste ich nur noch Uwe Bescheid sagen.
Der wusste, wie leidenschaftlich gern ich Fußball spielte. Aber er machte mir klar, dass ich es als Schiedsrichter weit bringen könnte. Er war sich sicher. Wäre ich ohne seinen Rat von damals heute Bundesligaschiedsrichter? Schwer zu sagen, eine hypothetische Frage. Er hat an meinem Weg jedenfalls einen entscheidenden Anteil. Damals bat er mich, nachzudenken. Fünfzehn Minuten nach unserem Gespräch rief ich ihn an und sagte zu. Ich war am Sonntag dabei. Morgens als Schiedsrichter, nachmittags als Assistent. Kurze Zeit später hörte ich komplett auf, selbst zu spielen. Mit meinen beiden kreuzbandgeschädigten Knien hätte ich im Zweikampfsport Fußball auf Dauer ohnehin Probleme bekommen.
Nun war ich also „richtiger“ Schiedsrichter. Ich sehe mich aber heute noch als Fußballer. Nicht als einen, der gegen den Ball tritt, sondern als einen, der Teil des Spiels ist. Schiedsrichter gehören zum Fußball dazu. Also sind sie Fußballer.
Und Fußballer sind ehrgeizig. Ich hatte Spaß an der neuen Aufgabe, wurde gefördert und brachte von Haus aus extremen Ehrgeiz mit. Manchmal zu extrem. Wenn ich beim Joggen im Wald jemanden vor mir sah, wollte ich schneller sein. Ich versuchte, die Läuferin oder den Läufer vor mir zu überholen. Herausforderungen trieben mich an. Auf dem Feld konnte ich es nie jedem recht machen. Aber ich konnte es versuchen. Genau das war der Reiz.
Wer Talent und Motivation hat, kann schnell aufsteigen. Ich übersprang eine Leistungsklasse und schaffte es von der Bezirksliga direkt in die Verbandsliga. Und im August 2000 durfte ich zum ersten Mal als Spielleiter außerhalb Hamburgs ran, auf der Ebene des Norddeutschen Fußballverbandes. Knapp viereinhalb Jahre nach meiner Premiere in der Kreisklasse debütierte ich in der Oberliga, Heider SV gegen TuS Dassendorf. Ich hatte nie Angst vor Spielen, sondern war positiv aufgeregt. Das ist bis heute so geblieben.
Ich fand eine Aufgabe, die perfekt zu mir passte. Ich liebte den Fußball, durfte viel laufen und viel reden. Ideal. Wahrscheinlich ist das schon die Antwort auf den Untertitel dieses Buches – warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Es passt einfach zu mir.
Okay, ein bisschen komplexer als laufen und reden ist es dann schon. Manchmal redete ich zu viel. Nach der Verbandsligapartie zwischen Henstedt-Rhen und dem SV Ellerbek notierte der Beobachter:
„Er sollte bei Kritik von den Zuschauern sich nicht selbst mit denen anlegen, sondern hier den Mannschaftsführer einschalten.“
Ich erinnere mich nicht mehr genau an die Situation, aber ich weiß, was er meinte. Wenn mir jemand etwas vom Spielfeldrand zu rief oder mich anpöbelte, wehrte ich mich. Mir fehlte die Souveränität. Ich pöbelte nicht zurück – das nun doch nicht, dann wäre ich nicht gelandet, wo ich bin –, aber ich fing an, mit den Zuschauern zu diskutieren. Im Laufe der Jahre wurde ich ruhiger, aber ich gebe zu: Bis heute fällt es mir schwer, Pöbler zu ignorieren, die mir Dinge direkt ins Gesicht sagen. Aber auch dazu später mehr.
Ende der 1990er-Jahre hieß Hamburgs ranghöchster Schiedsrichter Carsten Byernetzki. Er pfiff sogar Zweitligaspiele, ihn als Assistent zu begleiten, war für mich etwas ganz Besonderes. Mit Carsten hatte ich im März 1998 meinen ersten großen Einsatz, Regionalliga Nord, Kickers Emden gegen Eintracht Braunschweig vor 2500 Zuschauern, mit einer Wahnsinnsstimmung auf den Rängen. Das fühlte sich nach richtig großem Fußball an! Eigentlich hätte ich niemals mitfahren dürfen, denn ich hatte mir drei Monate zuvor zum ersten Mal das Kreuzband gerissen. Eine Operation war nicht nötig, ich absolvierte ein Rehaprogramm –, und als ich wieder anfing, auf dem Platz zu trainieren, verdrehte ich mir direkt wieder das Knie. Ich wollte den Einsatz in Emden aber auf gar keinen Fall absagen. Aufgeregt wie ein kleines Kind an Heiligabend, fuhr ich nach Ostfriesland und rannte mit meinem kaputten Knie die Seitenlinie rauf und runter. Aus heutiger Sicht ziemlich unverantwortlich, aber ich war halt jung und naiv.
Mit Carsten Byernetzki hatte ich zuvor schon ein Highlight in der Verbandsliga in Billstedt erlebt. Der Tag begann mit einem Anpfiff. Allerdings nicht auf dem Spielfeld, sondern den Anpfiff kassierte ich, und zwar zu Recht. Ich war nämlich zu spät zum vereinbarten Treffpunkt gekommen – das passiert mir wirklich selten! Carsten überprüfte zunächst einmal die Tore. Ein Fußballtor ist 7,32 Meter breit und 2,44 Meter hoch, im Idealfall auf jedem Sportplatz dieser Welt. An diesem Tag stimmte aber irgendwas nicht. Er stellte sich auf die Linie, streckte seinen Arm nach oben und da war deutlich mehr Luft bis zur Querlatte, als er es gewohnt war. Wir hatten kein Maßband, aber ganz klar: Dieses Tor war viel zu hoch. Locker 20 Zentimeter. Die Billstedter versuchten die Pfosten tiefer in die Fassung zu drücken, aber das Aluminium saß bombenfest. Nichts regte sich. Carsten machte eine unmissverständliche Ansage: „Absägen!“
Der Handwerksauftrag ging zum Glück nicht an mich, sondern an die Verantwortlichen des gastgebenden Vereins. Zwei Stunden lang sägten sie an den Torpfosten rum, bis es endlich losgehen konnte. Ich stand als kleiner Assistent staunend daneben. Wochenende für Wochenende neue Spiele und Erlebnisse, ich liebte es.
Im Herbst 1997 schickte mich der Hamburger Verbandsschiedsrichterausschuss zum ersten Mal in die Sportschule Wedau nach Duisburg. Dort wurde der Länderpokal ausgetragen, die DFB-
Landesverbände spielten mit ihren Toptalenten gegeneinander. Wenn Deutschlands beste Nachwuchskicker aufeinandertrafen, bot sich die Gelegenheit, auch die Schiedsrichtertalente zu testen. Für mich war das eine richtig große Nummer. Organisiert wurde der Lehrgang von Hans-Jürgen Weber, damals Bundesligaschiedsrichter. Der DFB schickte erfahrene Ex-Referees, um uns zu beobachten. Wir mussten einen knallharten Regeltest überstehen, dazu einen Konditionstest – von den Ergebnissen war abhängig wie viele Partien wir pfeifen durften.
In der Umkleidekabine der Sportschule saß ich neben einem sehr großen Jungen mit schwarzen Haaren. Er bemalte seine graue Spielnotizkarte – auf der werden die Verwarnungen notiert – mit Buntstiften. „Was ist denn mit dir los?“, fragte ich meinen Sitznachbarn staunend. „Na, da spielt doch gleich blau gegen grün. Also male ich die eine Hälfte der Notizkarte blau an, die andere grün. So komme ich nicht mit den Teams durcheinander.“
Grundsätzlich keine schlechte Idee, eine Verwechslung kann einem Neuling nämlich leicht mal passieren. Gelb-Rot für Nummer sechs – leider von der falschen Mannschaft, Nummer sechs des anderen Teams hatte die erste Gelbe Karte gesehen. Ich wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, meine Notizkarte anzumalen. Auf der Vorderseite sind schließlich vorgedruckte Kästchen für jedes Team. Da machte ich meine Kreuze, wie alle anderen auch.
Der Buntstiftfreund kam aus dem Landesverband Bayern und stellte sich mir als Deniz vor, Nachname Aytekin. Heute leitet er als FIFA-Schiedsrichter die ganz großen Spiele und reist immer noch mit Buntstiften durch die Fußballwelt. Ein Jahr nach unserem gemeinsamen Lehrgang in Duisburg rief Deniz mich an: „Hey, ich bin gerade in Hamburg. Wollen wir uns treffen?“ Das passte
mir gut. Meine damalige Freundin – und heutige Frau – hatte nämlich gerade ein paar Möbel bei IKEA gekauft. Ich bestellte ihn also zu uns in die Wohnung. „Kannst du den Stuhl da mal aufbauen?“ Deniz konnte, und obwohl er sich unser Wiedersehen höchstwahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt hatte, sind wir gute Freunde geworden.
Insgesamt siebenmal war ich bei den Lehrgängen der Nachwuchsschiedsrichter dabei, 2003 durfte ich das Finale des Länderpokals leiten, kurz danach schaffte ich es auf die „DFB-Liste“, ich durfte Spiele in der dritten Liga pfeifen und wurde Assistent in der zweiten Liga. Der erste Schritt in den Profifußball.
Körperlich angegriffen wurde ich in meinen Anfangsjahren zum Glück nie. Auch in Celle nicht, trotzdem traute ich mich nach der Oberligapartie gegen Göttingen nicht aus der Kabine. Von draußen donnerten die Fäuste gegen die Tür. Ich hatte den Platz unter dem Schutz von Ordnern und Polizisten verlassen, die heimischen Fans bepöbelten mich heftig, einige waren in den Innenraum gelangt. Sie hatten ein heißes Niedersachsenduell mit einer Heimniederlage ihrer Mannschaft gesehen. Es ging ordentlich zur Sache. 3:5, ein Platzverweis auf jeder Seite, mehrere Gelbe Karten, dazu schickte ich noch den Trainer der Gastgeber auf die Tribüne. Manchmal kann man nichts dafür, wenn ein Spiel ausufert, die Spieler treten einfach drauflos. Und manchmal ist man selbst nicht ganz unschuldig. Es war in diesem Fall wohl eine Mischung aus beidem. Der Beobachter notierte in seiner Beurteilung:
„Die ersten Verwarnungen in der 30. und 32. Minute waren höchste Zeit!!“
Ich hatte seiner Meinung nach zu viel durchgehen lassen. Außerdem kritisierte er meine „übertriebene Armgestik“, mit der ich meine Entscheidungen verdeutlichen wollte. Es funktionierte an diesem Tag nicht. Spieler merken genau, wenn der Schiedsrichter unsicher wird. Ich wurde nonstop bearbeitet. Bei jeder Entscheidung gab es Theater, meine Akzeptanz sank. Und am Ende saß ich in meiner Kabine und hörte das Donnern der Fäuste. Nie zuvor hatte ich so etwas erlebt und traute mich nicht aus meiner Kabine heraus. Zum ersten Mal stellte ich mir selbst die Frage, die ich bis heute so oft gehört habe: Warum tust du dir das an?
Die Frage blitzte auf und genauso schnell war sie auch schon wieder weg. Dies war ein Ausnahmespiel. Wie gesagt: So etwas hatte ich noch nie zuvor erlebt. Nicht jeden Sonntag musste ich mich in einer Kabine einschließen. Abhaken.
Am Tag nach dem Spiel besorgte ich mir die Regionalzeitung und las die Schlagzeile: „Die Niederlage hat einen Namen – Pattrick Ittrich“ – ob mein Vorname absichtlich falsch geschrieben worden war, weiß ich nicht. Ich schnitt den Artikel jedenfalls aus und klebte ihn in meinen Ordner – in die Schlagzeile eines Spielberichtes hatte ich es bis dahin schließlich noch nie geschafft.
Übrigens: Meistens steht hinter meinem Namen nur „Hamburg“. Der Mümmelmannsberger SV wird eher selten erwähnt. Schade eigentlich.
Ich denke gern an meine Anfänge zurück. Ich wohne zwar schon lange nicht mehr in „Mümmel“. Aber der Mümmelmannsberger SV wird definitiv immer mein Verein bleiben. Nicht nur um TV-Reportern kurz vor Ostern eine Freude zu machen, sondern weil es meine Heimat ist.
REGELFRAGEN
2
Direkter Freistoß für die verteidigende Mannschaft rund 20 Meter vor dem eigenen Tor. Der Abwehrspieler spielt den Ball zu seinem Torwart zurück. Dieser wird völlig überrascht, der Ball kullert unberührt ins Tor. Wie geht es weiter?