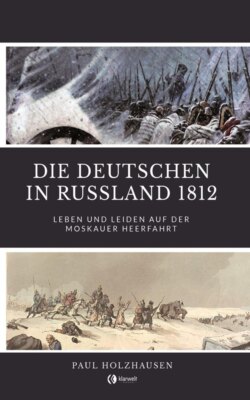Читать книгу Die Deutschen in Russland 1812 - Paul Holzhausen - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORREDE
Оглавлениеnno 12, Es ist kein Feldzug, der so abgrundtief in der Seele der Völker und des Volkes geschrieben steht wie dieser. Nicht der Krieg, den der große Friedrich mit den Österreichern, Franzosen und Russen, mit den feinfrisierten Marquis Louis Quinze, mit den wilden Kroaten und Fanduren der Maria Theresia führte, nicht das Jahr der Leipziger Schlacht, nicht die Kampagne von Waterloo, nicht 1870. Keiner.
Mochten sie heimkehren, die da hinausgezogen, oder auf dem Felde der Ehre gefallen sein — man wusste, wo sie geblieben, da und dort, bei Lützen oder Bautzen, in dem Kampf mit der alten Garde bei Plancenoit oder um Metz, Sedan, vor Paris. In der großen Mehrzahl der Fälle wusste man das. Mit dem Unabänderlichen weiß der Mensch sich abzufinden.
Anders nach Anno 12. Disparu pendant la retraite, en arriere Sans nouvelles 1812 usw. — das sind die Randzeichnungen, die man in den Stammlisten französischer Regimenter bei zahllosen Namen in den Archiven findet. Ein norddeutscher Dichter hat das Wort in seiner ganzen schauerlichen Tragik übersetzt — Fritz Reuter. In der »Franzosentid« fragt der Amtshauptmann den »Möller Voß« nach seinem Sohne Karl. »Korlen hewwen de Franzosen mitnahmen nach Russland«, erwidert der alte Müller, »un hei ‘s nich wedder kamen«.
»Nicht wiedergekommen«! Das war das schreckliche Wort, das in Tausenden deutscher Familien damals umging, das von Vätern, Müttern, Schwestern, Bräuten unter Tränen wiederholt wurde.
Aber wo war er geblieben? Man fragte die wenigen, die wiederkamen, aber diese hohläugigen Gespenster mit den abgefrorenen Fingern wussten keine Auskunft zu geben. Und was sie berichteten von den endlosen Leiden in den Eiswüsten des Nordens, von der Grausamkeit der Kosaken, den Untaten der Muschiks, der litauischen Bauern und der Wilnaer Juden, ließ die Herzen erbeben ob nie erhörtem Menschenjammer.
Noch nach Jahren kehrten einzelne, die gefangen waren, aus den russischen Ketten zurück, 1817, 1819 — noch viel später.
Heinrich Heine hatte einer Begegnung mit solchen revenants seine »Grenadiere« zu verdanken. In den zwanziger Jahren erfolgten in bayrischen Blättern Aufrufe über Aufrufe an die Verschollenen, sich zu melden. Manches liebende Herz wartete, zagte, bangte und hoffte noch viel länger. Es ist wieder Reuter, der von einem einfachen Mecklenburger Landkinde gefragt wird, ob wohl nach siebenunddreißig Jahren einer aus Russland noch zurückkommen könne. Siebenunddreißig Jahre hatte das arme Mädchen auf den Geliebten gewartet.
Die wenigen Hindeutungen mögen genügen, um dem Leser zu zeigen, welch tiefe Wunde dieser Krieg unserem Volke geschlagen, dessen Kinder — 200 000 an der Zahl — unter fremden Fahnen in ein fremdes Land hinausgezogen waren.
Hier drängt sich ein anderes Bild vor. Der Schatten des großen Heerführers steigt auf, der die Scharen leitete, um dessen Gestalt noch heute Licht und Dunkel kämpfen, den die einen für einen Dämon, andere für die vollkommenste Verkörperung menschlichen Wollens und Könnens halten. Letzteres glaubte die Welt um 1812, und erst durch die folgenden Kriege wurde der Glaube an ihn erschüttert. Die Männer, die Anno 12 mit ihm gingen, sind ihm im vollen Vertrauen auf seine Unbesiegbarkeit gefolgt — wenigstens die größte Mehrzahl. Aber sie haben auch, als alles ganz anders kam, in ihrer Soldatentreue für die fremde Sache ausgehalten, mit einer beispiellosen Standhaftigkeit, die selbst den im andern Lager Stehenden Bewunderung abrang. Auch dies ist eine Seite der Moskauer Heerfahrt, die, durch die Ereignisse der Befreiungskriege zeitweilig verdunkelt, heute, aus der Ferne eines Jahrhunderts gesehen, zu uns Nachlebenden klar herüberschaut.
Darum haben wir ein Recht, auf diese Männer stolz zu sein, diese Bayern, die in dem brennenden Polozk gefallen, diese Sachsen, die in dem rasenden Gemetzel um Borodinos Schanzen starben, diese Schwaben, die Smolensk gestürmt, und auch die stammverwandten Schweizer, die auf dem Ehrenposten an der Beresina gestorben sind. Nicht Unrecht hatte jener deutsche Romantiker auf dem Throne, Ludwig I., als er den in Russland Gebliebenen in seinem schönen München ein Denkmal setzte.
Das soll auch in diesem Bande geschehen. Neben dem oben ausgesprochenen Gedanken forderte dazu die Erwägung heraus, dass der dankbare Stoff in seiner Gesamtheit noch nie zu einem Buche geformt worden war. Ansätze im Einzelnen waren freilich schon genug vorhanden, schöne Detailarbeiten, die ich dankbar verwendet habe.
Auch ungenutzte Bausteine fanden sich in überraschender Menge: vergilbte, zerfressene Bücher, verschollene Aufsätze in uralten Zeitungen, Journalen, Revuen, daneben ein herrliches Handschriftenmaterial, das, wohl von dem einen und dem andern durchstöbert, noch viel ungemünztes Gold in vollen Kammern und Schächten barg.
Es ist mir unmöglich, jedem lieben Freunde, auch Fremden und Unbekannten, für die vielen kleinen Büchelchen über das Kriegsjahr hier zu danken, die sie oft zögernd und mit fragendem Blicke heranbrachten, »ob man das wohl brauchen könne«. Man konnte in der Regel etwas davon brauchen, und sie werden sich davon überzeugen. Auch die Verwaltungen unserer öffentlichen Büchersammlungen, fast aller deutschen Bibliotheken, haben mich in dankenswerterweise unterstützt. Wenn ich die Königlichen Bibliotheken in München, Berlin und Dresden wegen der Reichhaltigkeit der mich interessierenden Materialien hier an erster Stelle anführe, so will ich nicht verschweigen, dass auch die Büchereien verschiedener Universitäten, besonders der Bonner, und die Sammlungen der Residenzstädte unserer deutschen Kleinstaaten, Weimar, Gotha, Sondershausen, Detmold, Schwerin usw., manche schöne Einzelheit bereitwillig beigesteuert haben.
Handschriftliche Schätze sind mir durch eine Reihe von Archiven zugänglich gemacht worden: das Kriegsarchiv des Großen Generalstabes in Berlin, die geheimen Haus- und Staatsarchive in Stuttgart und Darmstadt, das Badische Landesarchiv, die Kriegsarchive in Dresden, Stuttgart und München. Neben Herrn Oberst Rudolf Friederich, dem Chef der Kriegsgeschichtlichen Abteilung II des Gr. Generalstabes und durch eigene Werke rühmlichst bekannten Militärschriftsteller, habe ich im Besondern noch die Pflicht, den Herren Freiherrn
Schenk v. Schweinsberg in Darmstadt, Oberst Paraquin und Major Luitpold Lutz in München, Archivdirektor Schneider und Hotbibliothekar Professor v. Stockmayer in Stuttgart wärmsten Dank auszusprechen. An letzter und eigentlich allererster Stelle aber Herrn General Staudinger, Vorstand des Königl. Bayrischen Kriegsarchivs in München. Die Liberalität General Staudingers, der mich auch bei schwierigen Fragen mit nie ermüdender Bereitwilligkeit unterstützte, hat mich in den Stand gesetzt, eine große Anzahl noch nicht gedruckter Tagebücher und anderer wertvollen Urschriften in uneingeschränktester Weise benutzen zu können.
Diese Ausbeute ist für mein Vorhaben von erheblichem Werte gewesen. Denn auf Grund der umfangreichen Materialien ist es möglich geworden, den Feldzug von 1812 in einer ganz eigenartigen und neuen Weise zu behandeln. Die Schicksale größerer Truppenteile waren ja vielfach schon bearbeitet: die Geschicke, Taten, Stimmungen, Leiden von Regimentern, kleinen Gruppen, vor allem aber das Leben und Leiden einzelner interessanter Personen habe ich zum ersten Mal in einer Ausdehnung schildern können, die sich in keinem Werke der gesamten Literatur über das merkwürdige Jahr findet.
Ich lasse sie sagen, was sie gelitten, wo es nur angeht mit ihren eigenen Worten. Wohl wird nicht selten ein Fragezeichen hinter eine Stelle gesetzt, und wenn es sein muss, wird sie kritisch beleuchtet. Das ist manchem sensationsbegierigen Erzähler gegenüber am Platze. Doch die meisten unserer deutschen Berichterstatter, namentlich die Verfasser eigentlicher Tagebücher, schreiben einfach, wissen oft die schrecklichsten Dinge mit wirkungsvoller Schlichtheit zu sagen.
Französische Übertreibungen, russische Lügen werden dadurch beiseite geschafft, und es tritt ein Geschichtsbild zutage, gereinigt von den grotesken Fratzen und den maßlosen Überschwänglichkeiten mancher und gerade mancher der verbreitetsten Schriften über diesen so unheilvollen und doch so großartigen Feldzug, den Napoleon auf St. Helena — und mit ihm die Nachwelt — für die gewaltigste Unternehmung seines Lebens erklärt hat.
Die gewaltigste und die furchtbarste. Wer Emotionen liebt, wird auch bei mir nicht zu kurz kommen: ja, vielleicht wird er beim Durchlesen dieser Blätter manchmal fragen, wie es möglich gewesen, dass aus diesem bodenlosen Abgrund von Elend ein wenn auch nur kleiner Rest entkommen konnte.
Freilich nur ein kleiner. »Hei ‘s nich wedder kamen«, der unglückliche Sohn von »Möller Voß«. Aber er ist wieder aufgelebt in den Werken eines unserer gelesensten Dichter, und so möchte ich, dass auch die andern wieder auflebten, die bayrischen Chevaulegers und die Württemberger Infanterie, die hessischen Dragoner und die preußischen Ulanen, die Zastrow-Kürassiere und die Gardejäger weiland König Jérômes, sie alle, die Anno 12 mit der großen Armee gegangen — auf der Heerfahrt nach Moskau.