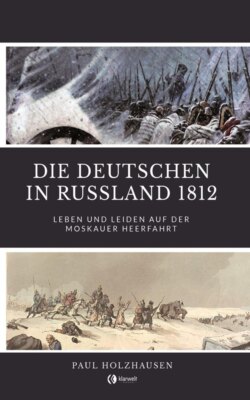Читать книгу Die Deutschen in Russland 1812 - Paul Holzhausen - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BESONDERE SCHICKSALE DER BAYERN AN DER DÜNA. BLICK AUF DAS LEBEN DER PREUSSISCHEN TRUPPEN IN KURLAND. ERLEBNISSE DER SACHSEN IN WOLYNIEN.
Оглавлениеir beginnen mit den Begebenheiten an der Düna. Anfangs August waren die Bayern vom Hauptheere getrennt worden. Sie hatten Befehl erhalten, den Marschall Oudinot im Kampf gegen das von der Barclayschen Armee abgezweigte Korps Wittgensteins zu unterstützen, das zur Deckung von Petersburg auf dem rechten Dünaufer stehen geblieben war. Von Polozk aus hatte der französische Marschall, dem es zwar keineswegs an persönlichem Mute, wohl aber an der auf seinem Posten besonders nötigen Entschlossenheit fehlte, einen Vorstoß nach Norden bis über das Flüßchen Drissa hinaus versucht, wo er sich mit abwechselndem Erfolge geschlagen, aber vor dem unternehmungslustigen Wittgenstein wieder zurückgezogen hatte. Auch als er, durch die Bayern verstärkt, aufs Neue vorgegangen war, kam seine Offensivbewegung abermals bald zum Stillstand. Am 16. trafen die Oudinot unterstellten Korps, das 2. und 6., wieder in der Nähe von Polozk ein. Auf den Vor- und Rückmärschen und in den gelieferten Gefechten hatte das bayrische Korps ungefähr 3000 Mann verloren.
Diese Truppen bestanden fast nur aus Infanterie und Artillerie, da die Kavallerie, wie schon in der Einleitung mitgeteilt, mit Ausnahme einer kleinen Abteilung Chevaulegers, der Hauptarmee zugeteilt worden war. Mit dieser machte sie nun den Zug nach Moskau mit, auf dem sie uns noch oft begegnen wird. Sie hat dort manche glänzende Charge ausgeführt; aber ihr Fehlen wurde in den folgenden Kämpfen an der Düna schwer empfunden. Mit den zuletzt den Bayern abgenommenen und zum Korps Eugens geschlagenen vier Chevaulegersregimentern der Division Preysing war auch die bayrische Batterie Widnmann dorthin abgegangen, eine gleichfalls, wie ihr Führer, sehr brave Truppe, deren wir noch bei mancher Gelegenheit zu gedenken haben werden.
Die Lage der an der Düna verbliebenen Bayern wurde alsbald eine sehr traurige. Schon auf dem Hinmarsch mit dem übrigen Heere hatten sie so viel gelitten, dass die zwischen Wilna und Polozk in Kobylniki, Dokszitzi und an andern Orten angelegten Hospitäler mit kranken Bayern gefüllt waren. Auch auf dem Rückzug Oudinots waren viele liegen geblieben.1 Den Feinden konnte dieses nicht verborgen bleiben, und da deren Führer, Graf Wittgenstein, der beweglichste von den russischen Generalen, den Zustand seiner Gegner für noch schlimmer hielt, als er in Wirklichkeit war, so glaubte er durch einen raschen Angriff mit ihnen fertig werden und sie über die Düna zurückwerfen zu können.
So kam es zu der blutigen Schlacht bei Polozk am 17. und 18. August, die zu den ruhmreichsten Tagen in der bayrischen Kriegsgeschichte gezählt werden dürfen, namentlich wenn man den physischen Zustand berücksichtigt, in dem sich die dort kämpfenden Truppen schon damals befanden.
Die Stadt Polozk liegt zum bei weitem größten Teil am rechten Ufer der Düna, in die hier die kleine Polota mündet. Das um die Stadt herum liegende freie Terrain wird von dichten Waldungen umrahmt, die es kreisförmig einschließen. Diese Gegend war bestimmt, das Schlachtfeld des 17. und 18. August 1812 zu werden. Sie wird von drei Straßen durchzogen, von denen die eine ostwärts über Gromewo nach Newel führt, während die beiden andern, die dünaabwärts führende Rigaer und die gerade nördlich nach Petersburg laufende, bei dem eine Stunde von Polozk entfernten Posthause von Gamzelowo zusammenkommen. Unweit dieser nun vereinigten Straßen in östlicher Richtung liegt das Dorf Spas mit einem Schlosse und anderen massiven Gebäuden, die sich ihrer Festigkeit wegen zu einer Verteidigung wohl eignen, nördlich davon das aus Holzhäusern bestehende Gut Prismenitza. Unsern Spas, aber auf dem andern Polotauter, erhebt sich ein die Gegend beherrschender Hügel, der zur Besetzung mit Geschütz herausforderte. Hier standen die bayrischen Batterieen Gottharot und Gravinreuth, deren Feuer zum Erfolge des Tages wirksam beitragen sollte.
Auch das Dorf Spas hatten die Bayern besetzt und gehörig verrammelt. Es war der Schlüssel der französischen Stellung, liier stand die 2. bayrische (20.) Division Wrede, während die 1. (19.) unter dem alten General Deroy am ersten Schlachttag auf dem linken Polotaufer in Reserve blieb. Die Bayern bildeten den rechten Flügel des französischen I leeres, dessen linker sich an die Düna lehnte, während auch von jenseits des Stromes einige bei dem Dorfe Ekimania aufgefahrene Batterien, darunter auch eine bayrische, dem Feinde ihre Grüße hinübersandten. Verschiedene Male versuchten die Russen, das Dorf Spas mit Sturm zu nehmen. Es gelang ihnen auch zeitweilig, Teile der Ortschaft zu erobern, doch wurden sie jedesmal wieder herausgeworfen. Der Führer der 1. bayrischen Infanteriebrigade, General v. Vincenti, wurde hierbei schwer verwundet.
Auch die auf dem Hügel bei Spas aufgestellten Batterien hatten von dem Feuer der feindlichen Scharfschützen erheblich zu leiden. Aber die Bayern hielten fest, und da auch die links von ihnen stehenden Franzosen den Angriffen trotzten, wurden die Russen auf allen Punkten zurückgewiesen.
Freilich war hiermit noch nicht viel gewonnen, da Wittgensteins Heer, das den das freie Land umgebenden Waldsaum nach wie vor besetzt hielt, den Gegner immer noch umklammerte. Bei der Unentschlossenheit des Marschalls Oudinot durfte er hoffen, dass dieser ihm doch noch die Dünalinie überliefern würde. Da kam eine Wendung. Noch am Abend des ersten Schlachttages wurde der Marschall durch eine Flintenkugel verwundet. Der russische Schütze, der diesen Schuss abgefeuert, hatte der Sache seines Feldherrn wenig genützt. Denn an Stelle Oudinots, der sich zu seiner Heilung nach Wilna zurückbringen lassen musste, trat jetzt der bei weitem energischere St. Cyr, persönlich ein recht wenig angenehmer Charakter, der aber über ganz andere militärische Fähigkeiten verfügte als sein verwundeter Waffengefährte.
In humorvoller Weise hat Major v. Thurn und Taxis die Zankereien geschildert, die zwischen den beiden französischen Korpskommandanten über die Führung stattgefunden hatten. Jetzt hatte St. Cyr allein das Kommando, und die Folgen zeigten sich zur selben Stunde. Er entwarf einen klugen Plan zur Täuschung des Feindes. Möglichst auffällige Demonstrationen sollten am folgenden Tage auf dem jenseitigen Dünaufer ausgeführt werden, als handle es sich um Abzug. Wittgenstein ließ sich auch wirklich betören, ganz ähnlich wie später der russische Admiral Tschitschagow an der Beresina sich düpieren lassen wird.
Währenddessen wurden in der Stille die Anstalten zum Angriff getroffen. Wieder fiel den Bayern eine wichtige Aufgabe zu. Auf dem Hügel von Spas wurden 34 ihrer Geschütze vereinigt. Die Division Wrede bildete diesmal den äußersten rechten Flügel, der in den Gromewoer Wald eindringen und die russische Linke gegen die Petersburger Straße zurückwerfen sollte. Bei Spas stand die 19. Division, die diesmal in die vorderste Linie vorgezogen war. Ihr Führer, der greise General Deroy, sollte heute der todbringenden Kugel begegnen.
Über seine Kampfeslust, die den mehr als Siebzigjährigen noch nach Russland getrieben, gingen allerlei Erzählungen im Heere um. Einem Offizier aus Wredes Umgebung gegenüber soll Deroy im Hinblick auf die Ereignisse des vorhergehenden Tages scherzhaft geäußert haben: »Wenn die naseweise Division Wrede wieder den Vorzug erhält, so lasse ich sie rückwärts mit dem Bajonett angreifen«.
Von alledem ließ sich Wittgenstein nichts träumen. Er saß noch in Prismenitza beim Mittagsmahle, als Schlag 4 Uhr die bayrischen Geschosse in sein Hauptquartier einschlugen, das im Augenblick auseinanderfuhr. Doch sammelten sich die Russen schnell und leisteten hartnäckigen Widerstand, als die Bayern, denen der enge Ausgang der Dorfgasse von Spas beim Debouchieren hinderlich war, gegen Prismenitza vorrückten.
Die nun folgenden wechselreichen Kämpfe, deren einzelne Momente wir hier nicht mitteilen können, waren außerordentlich blutig, da beide Heere auf einem ungewöhnlich engen Raum zusammengedrängt waren und sich in solcher Nähe gegenüberstanden, dass man die Gesichter der Gegner deutlich erkennen konnte. Eine Zeitlang schien die Lage der erschöpften Bayern recht bedenklich, zumal die links neben ihnen stehende französische Division Legrand mehrmals zurückwich und sie selbst das Unglück hatten, einen ihrer Führer nach dem andern zu verlieren. Das 4., 8. und 9. Infanterieregiment — schon damals nur schwache Bestände — werden in den Berichten besonders rühmend hervorgehoben. Bei dem letzteren war gegen Ende des Kampfes kein Stabsoffizier mehr unverwundet, so dass ein Hauptmann das Kommando übernehmen musste. Deroy fiel, in den Unterleib tödlich getroffen. Auf einer aus halbverbrannten Brettern hergestellten Bahre musste der alte Held, der den Seinen noch fortgesetzt zusprach, aus dem Feuer getragen werden. Da erschien Wrede und stellte durch die Macht seiner Persönlichkeit die Ordnung wieder her.
Das blutige Gemetzel endete damit, dass das 9. bayrische Regiment den Edelhof von Prismenitza endlich mit dem Bajonett wegnahm. Da inzwischen auch die 20. Division den russischen linken Flügel zurückgedrängt hatte und Wittgenstein die Petersburger Straße bedroht sah, so entschloss er sich zum Rückzuge.
Bevor er aber diesen antrat, ließ er, ähnlich wie Blücher am Abend der Schlacht von Lützen, durch seine Kavallerie noch einen Angriff machen, der bei der inzwischen eingetretenen Dunkelheit unter den Gegnern keine geringe Verwirrung anrichtete. St. Cyr selbst wurde überritten und konnte sich vor den Hieben der feindlichen Reiter nur mit Mühe in einen Graben retten. Auch bei der Abweisung dieses Angriffs haben — neben den Schweizern — die Bayern tätig mitgewirkt: zwei Bataillone der Brigade Siebein und zwei Geschütze der Batterie Gravenreuth. Hauptmann Gravenreuth sagt, dass es ihm gelungen sei, durch möglichst schnelles Feuern den Feind über die geringe Anzahl seiner Kanonen zu täuschen.
Sehr bedauert wurde hierbei die Abwesenheit der Chevaulegersregimenter. Die Bayern meinten: nur noch ihre Kavallerie zur Stelle, und man hätte den Feind, statt ihn ruhig abziehen zu lassen, durch scharfe Verfolgung für lange Zeit lahmlegen können. Das wäre für Napoleons Sache allerdings von großer Bedeutung gewesen.
So wie die Dinge nun einmal lagen, war es freilich unmöglich, das Korps Wittgensteins zu vernichten, das man sich mit Mühe und Not vom Halse geschafft hatte. Denn wenn Oudinot in den ersten Tagen des August bei größerer Tatkraft noch imstande gewesen wäre, sich die Offensive zu sichern: jetzt war es schon zu spät, und die Aufgabe des bei Polozk stehenden Heeres konnte nur mehr die sein, den errungenen Besitzstand zu behaupten, um die Russen zu hindern, von hier aus die Verbindungen des immer weiter nach Osten ziehenden Hauptheeres zu gefährden. Ein einheitlicher Oberbefehl auf dem linken Flügel der großen Armee würde ja vielleicht andere Resultate zur Folge gehabt haben; aber da er nicht existierte, musste man mit dem Erreichten zufrieden sein, und Napoleon, der, wie wir hörten, die Nachricht von der Schlacht bei Polozk mit großer Befriedigung aufgenommen, belohnte St. Cyr mit dem Marschallstabe. Auch die Bayern, die dieser in seinem Bericht nach Verdienst belobt hatte, gingen nicht leer aus, 60 Ehrenlegionskreuze wurden unter sie verteilt; doch kam für manchen die Belohnung zu spät. So für den alten Deroy, den der Kaiser zum Reichsgrafen mit einer Dotation von 30 000 Franken erhob, vier Tage, nachdem der wackere alte Herr von seinen Leiden erlöst war, so auch für jenen bayrischen Unteroffizier, dem man das ihm zuerkannte Kreuz aus Mangel an verfügbaren Stücken nicht geben konnte. Man tröstete ihn damit, dass bald durch den Tod eines Kameraden ein Ordenskreuz vakant werden würde; aber der brave Korporal starb selbst schon nach wenigen Tagen.
Denn wie überall in dem weiten Russland, so hielt auch an der Düna der Tod seine reichste Ernte gerade unter denen, die er auf dem Kampfplatze verschonte. Die Einbuße der Bayern hatte trotz der Heftigkeit der Aktion an den beiden Schlachttagen an Toten nicht viel mehr als 200 Offiziere und Soldaten betragen. Dazu kamen etwa 1500 Verwundete. Freilich fand in den folgenden Tagen eine umfangreiche Rekognoszierung statt, die zu einem Gefecht bei dem nördlich von Polozk gelegenen Bieloie führte, wo auch der General Siebein eine tödliche Wunde empfing. Infolge dieses Unternehmens wurden die Verluste abermals um die Zahl von etwa 250 erhöht. Immerhin waren das zusammen nur an 2000, von denen vielleicht die Hälfte hätte erhalten werden können, wenn die Hospitäler in einem einigermaßen erträglichen Zustande gewesen wären. Leider war dies wie überall in dem ganzen Feldzuge nicht der Fall. Zunächst fehlte es an geeigneten Baulichkeiten. Die meisten Wohnhäuser von Polozk lagen schon damals in Asche; die blessierten Offiziere waren größtenteils in dem zu Zeiten Katharinas II. erbauten Jesuitenkloster untergebracht, die Mannschaften in einer zum Lazarett umgeschaffenen Kirche, wo man ihnen, wie der Sergeant Schrafel sagt, »einen braunen Trank aus Wermuth reichte, der in der Gegend häufig wächst. Sonst gab es keine Arznei«. Der Mangel an Medikamenten wird auch von andern Seiten bestätigt, und dass man allerlei unschädliche Tränklein braute, ut aliquit fiat, wie der Mediziner das nennt, und um die Kranken zu täuschen. Als später eine größere Sendung mit Arzneien und anderen Stärkungsmitteln von München ankam, hatten die meisten ausgelitten.
Zur Bevölkerung der Lazarette trug ein anstrengender Vorpostendienst bei, für den die Bayern täglich 1500 Mann hergeben mussten. Dazu traten unaufhörliche Schanzarbeiten, da St. Cyr in Erwartung kommender Dinge Polozk so stark wie möglich befestigte. Auch suchte er sich gegen unliebsame Überraschungen auf dem linken Dünaufer zu sichern. Hier wurde flussabwärts eine bayrische Abteilung unter dem Generalmajor v. Ströhl vorgetrieben, die das Städtchen Disna besetzte und sich gleichfalls dort verschanzte.
Alle diese Arbeiten wären aber nicht so aufreibend gewesen, wenn die sanitären Verhältnisse von Polozk nicht eine so unheilvolle Wirkung geübt hätten. Von den vielen ungesunden Gegenden Russlands ist die um Polozk gelegene zur Sommerszeit eine der ungesundesten. Sogar die Russen pflegten in den heißen Monaten ihre Garnison aus der Stadt zu ziehen.
Überall wie in Litauen brackiges Wasser, das »von Würmern wimmelte.« Nicht einmal zum Kochen konnte es benutzt werden, so dass, wer ein bischen Branntwein hatte, darin seinen Kaffee brühte.
Der Hauptmann Maillinger bewirtete mit diesem Getränk einen vor der Polozker Schlacht aus dem Hauptquartier mit Depeschen für St. Cyr eingetroffenen Adjutanten des Kaisers, und der Franzose wusste ihm nicht genug zu danken. Ein Trunk reinen Wassers war dort eine Seltenheit, die nicht hoch genug eingeschätzt werden konnte. Sergeant Schrafel glaubte, als er eines solchen einmal habhaft geworden, allein durch diesen Genuss von der Dysenterie befreit worden zu sein, die ihn, wie alle Welt, befallen hatte.
Eine andere Plage, die bei längerem Aufenthalt an der Düna besonders lästig wurde, waren die zahllosen Mücken und Fliegen. Selbst in den bestverwahrten Räumen konnte man sich ihrer kaum erwehren. Über das Bett des sterbenden Deroy im Polozker Jesuitenkloster hatten treue Hände einen Flor gebreitet, um den alten Mann in seinen letzten Stunden vor den lästigen Insekten zu schützen. In den zum Schutze der Truppen errichteten Baracken waren Decken und Wände mit diesen übersät. »Wir konnten kaum einen Löffel Suppe genießen«, sagt Gravenreuth, »ohne einige dieser Tiere mit zu verschlingen«. Ein Kamerad, den der Hauptmann eines Tages zum frugalen Mal geladen, brachte es nicht über sich, das Essen zu sich zu nehmen. Man zündete Feuer an, um das Geschmeiß zu vertilgen; man kehrte Myriaden der verbrannten Tiere aus — am andern Morgen war schon Ersatz eingerückt.
Alle diese größeren und kleineren Miseren, zu denen wie überall ein empfindlicher Brot- und Salzmangel kam, brachten durch ihre tägliche Wiederholung unter den schwerblütigen Bayern eine Melancholie hervor, die in solchem Grade bei der Hauptarmee bis dahin zu den immerhin noch selteneren Erscheinungen gehörte. Mit großer Heftigkeit äußerte sich die Nostalgie, das Heimweh, und man kann wohl sagen, dass dieses Seelenleiden einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Individuen geradezu den Tod gebracht hat. »Gemeine wie Offiziers«, sagt der Stabsauditeur Stubenrauch, »sahen Geistern ähnlich«. Die Leute starben überall, selbst auf den Latrinen des Biwaks sind nach der Angabe des (späteren) Hauptmanns Friedrich Mändler viele verendet. In den Spitälern soll es, wie der französische General Marbot erzählt, der damals als Oberst des 23. Chasseursregiments beim Korps Oudinot stand, ein sogenanntes »Sterbezimmer« gegeben haben, nach dem die Bayern verlangten, um sich dort aufs Stroh hinzustrecken und nicht wieder aufzustehen. Anderseits will man bemerkt haben, dass diejenigen eine Erleichterung fühlten, die nach den auf dem linken Dünaufer angelegten Lazaretten befördert wurden, weil sie sich der Heimat um einige Meilen näher wussten! Die Wege dorthin zu finden ward den Kranken nicht schwer. Sie brauchten nur den umherliegenden Leichen nachzugehen. Den Rosenkranz mit lauter Stimme betend, zogen die frommen Bayern diesen offenen Gräbern entgegen. In ihren Seelennöten nahmen sie auch zu den Polozker Jesuiten ihre Zuflucht, unter denen mehrere Landsleute waren. Ein alter Pater nahm sich besonders der armen Soldaten an, denen er die Tröstungen der Religion spendete und für die er so lange sorgte, bis er selbst der Ansteckung erlag.
Nicht alle Väter der Gesellschaft Jesu in Polozk haben wie dieser gute Mann gehandelt. Unter den russischen Mitgliedern des Ordens überwog das Nationalgefühl. Einige standen sogar im Verdacht, Verrat zu üben. Auch hielten sie ihre Vorräte verborgen. Hauptmann Maillinger entdeckte diese mit Hilfe findiger Burschen: Fässer voll Met und einige hundert Flaschen feiner Weine. Auch mehrere Zentner Zucker und Kaffee wurden hinter dem Hauptaltar der Kirche gefunden. Mit Mühe und Not gelang es dem bayrischen Kapitän, einen kleinen Teil von diesen Schätzen den verwundeten Offizieren zukommen zu lassen. Das übrige behielt der Höchstkommandierende, St. Cyr, für sich, dessen Egoismus bei dieser wie bei andern Gelegenheiten in hässlichem Licht erscheint.
Doch hatte es das Feldherrntalent des Marschalls fertig gebracht, seinem Korps und damit auch den Bayern für längere Wochen Ruhe vor dem Feinde zu verschaffen. Eine geordnetere Verpflegung trat nach und nach ein; die weiter zurückliegende Landschaft wurde in Requisitionsbezirke geteilt, und auch das so schmerzlich vermisste Brot konnte wieder gebacken werden: das letzte vor den schrecklichen Tagen des Rückzuges, das aus diesem Grunde, wie Sergeant Schrafel sagt, die Bayern »nicht vergessen konnten.« Wenn trotz dieser relativen Besserung der Lage die Ziffer der Streitkräfte bei Polozk während des folgenden Monats (September) immer weiter herunter ging, so war doch militärisch ein nicht unwichtiger Erfolg erreicht; die vorläufige Sicherung der linken Flanke des Hauptheeres. Es hätte mehr erreicht werden können, wenn auch der an der unteren Düna nicht allzu weit entfernt stehende Marschall Macdonald eine größere Rührigkeit entfaltet hätte.
Wir werden uns auch mit diesem für einen Augenblick zu beschäftigen haben, nicht nur weil bei dem 10. Korps die Preußen standen, sondern auch aus dem andern Grunde, weil die Ereignisse oder vielmehr Nichtereignisse auf dem äußersten linken Flügel, wenn auch erst in einer späteren Periode des Feldzugs, einen gewissen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Dinge und das endliche Schicksal der nach Moskau Ziehenden ausüben sollten. Auf der andern Seite zwingt aber die Rücksicht auf das Hauptheer zur Kürze. Handelt es sich doch hier um einen verhältnismäßig wenig interessanten Nebenschauplatz, auf dem sich ein zwar an sich nicht reizloser Kleinkrieg abspielt, der den kämpfenden Truppen mancherlei Opfer und Entbehrungen auferlegt, aber neben der gewaltigen Tragik des eigentlichen Moskauer Heereszuges und auch neben den Taten und Leiden der Bayern weiter oben an der Düna nur den Namen einer recht bescheidenen Episode verdient.
Von allen Bundesgenossen, die den großen Cäsar in das Zarenreich begleiteten, waren die Preußen bekanntlich die widerwilligsten. Der von Friedrich Wilhelm III. mit Napoleon unter dem Zwange der Umstände abgeschlossene Allianzvertrag war im Lande und noch mehr im Heere höchst unpopulär. »Wir Preußen folgten nicht dem hochtönenden Rufe Napoleons,« schreibt der Leutnant vom Leibregiment Philipp v. Wussow in sein Tagebuch, »wir folgten vielmehr nur dem unvermeidlichen Willen unseres hart bedrängten Königs.« Eine größere Anzahl namhafter Offiziere, unter denen sich Clausewitz, Boyen, Chasot, Graf Friedrich Dohna u.a. befanden, hatten auch das nicht über sich gewinnen können. Sie waren aus der preußischen Armee ausgeschieden und kämpften unter russischen Fahnen. Manche standen ihren früheren Kameraden unmittelbar gegenüber. So der bekannte Major v. Tiedemann, der sich in Riga aufhielt und bei einem in dortiger Gegend stattfindenden Gefechte tödlich verwundet wurde. Von Seiten dieser Landsleute wurden vielfach Versuche gemacht, preußische Truppen zur Desertion zu verleiten, was auch bei einzelnen Individuen gelang. Man empfand das zwar als illoyal, und ein den Feldzug mitmachender Offizier betrachtete das vorzeitige Ende des Majors v. Tiedemann als eine gerechte Strafe für dessen Treiben; aber das schiefe Verhältnis, in dem die Preußen standen, wird durch solche Vorkommnisse deutlich gekennzeichnet. Bald wiederholen sich diese Vorgänge im Großen. Von den den Preußen gegenüberstehenden Generalen hat es keiner unversucht gelassen, den in der letzten Zeit deren Korps kommandierenden General Yorck auf die russische Seite herüberzuziehen, weder die Rigaer Gouverneure Essen und Paulucci noch der später den Preußen auf ihrem Rückzuge nachsetzende Wittgenstein, und es ist ein weltgeschichtlich feststehendes Faktum, dass es dem unter letzterem stehenden General Diebitsch nach langen Verhandlungen endlich gelungen ist, Yorck zum Abschluss der berühmten Konvention von Tauroggen zu vermögen, durch welche die Russen ihren Zweck, wenn auch nicht ganz in dem von ihnen gewünschten Maße, erreichten. Denn Yorck hat sich nicht zum völligen Übertritt auf die russische Seite entschließen können, vielmehr nur einen Neutralitätsvertrag abgeschlossen, durch den er das Korps seinem Könige erhielt.
Die eigentümliche Lage des preußischen Hilfskorps gegenüber den Russen, die man im Herzen nicht als Feinde betrachtete und die ihrerseits die Preußen auch nur als halbe Gegner ansahen, haben, zusammen mit den örtlichen Verhältnissen und der geringen Tatenlust Macdonalds, dem Feldzug in Kurland ein Aussehen gegeben, das von dem des übrigen Krieges wesentlich abweicht. Statt des grausamen, unsäglich blutigen Charakters, den dieser zeigt, tritt uns hier eine im ganzen recht menschliche Kriegführung entgegen, namentlich zwischen den Russen und Preußen, die ihre Gefangenen beiderseits schonen, während, wie wir noch hören werden, sonst mit barbarischer Rohheit gegen diese verfahren wurde. Man respektiert das Sanitätspersonal; man schickt sich gegenseitig gefangene Militärärzte zurück, und zwischen Yorck und den russischen Befehlshabern kommt es während der letzteren Zeit der Blockade von Riga schon zu einer Vereinbarung, laut deren die Neckereien der Vorposten eingeschränkt werden, um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden.
Auch das Verhältnis zu der Bevölkerung war bei weitem weniger feindselig als im eigentlichen Russland. Auch hier waren die Ursachen verschiedene. Ein Teilnehmer am Feldzuge erzählt, dass die Bewohner der Grenzdistrikte seinen Landsleuten, mit denen sie durch Handelsverkehr bekannt waren, vertrauensvoll entgegengekommen seien. Die Polen Samogitiens zeigten sich der französischen Sache ergeben. Der Leutnant v. Hartwich vom Leibregiment betrachtete mit Verwunderung die »merkwürdige Feierlichkeit«, durch die der Fürstbischof Zandrowitsch im Beisein des fremden Offizierkorps das Volk von dem Eide der Treue gegen den Zaren entband. Tiefer nach Russland hinein zeigten sich die Bauern widerhaariger, namentlich bei Ausübung der Vorspanndienste, zu denen sie mit Kantschuhieben angehalten werden mussten, das einzige Mittel, wodurch man sich, wie derselbe Offizier bemerkt, »mit ihnen verständigen kann«. Immerhin waren die Bedrückungen nicht allzu hart, da auch Macdonald ein rücksichtsvoller Mann war, und von der grimmigen Wut des Volkes, die in andern Gegenden hervorbrach, zeigt sich kaum eine Spur. Nur hört man, dass die Umwohner der Düna den Russen vielfach Spionagedienste leisteten.
Einer besonders günstigen Aufnahme hatten sich die preußischen Offiziere in den gebildeten Familien Kurlands zu erfreuen. Auf den Schlössern der wohlhabenden Edelleute wurden üppige Gastmähler veranstaltet, bei denen der Wein nicht gespart wurde. Wie freundliche Inseln im wilden Meere dieses fürchterlichen Krieges erscheinen die Erzählungen mancher preußischen Offiziere von ihrem Aufenthalt in den Ostseeprovinzen. Hartwich z. B., der längere Zeit in Liebau im Quartier liegt, hat hier im eigentlichsten Sinne des Wortes ein Badeleben geführt. Als er endlich scheidet, fließen die Tränen eines schönen Mädchens, das er täglich auf Weg und Steg und besonders auf dem Gange zum Strande begleitet hat. Ähnliche Verhältnisse fand der Leutnant v. Wussow im Avenariusschen Hause in Mitau. Auch in dem Lager der Preußen vor Riga herrschte fröhliches Leben, das den Ernst des Krieges milderte und dessen raue Seiten umso weniger hervortreten ließ, als, dank der Tätigkeit eines vorzüglichen Verwaltungsbeamten, des Staatsrats Ribbentrop, die Verpflegung, zumal in den ersten Monaten, eine ausreichende war. Der Geburtstag des Königs Friedrich Wilhelm (3. August), konnte durch ein »anständiges Diner« von den Offizieren begangen werden. »Wir hatten uns«, schreibt der Leutnant Wilhelm v. Eberhardt, »einen großen Tempel aus hohen Bäumen bauen lassen, mit Festons aus Eichenlaub und Blumengirlanden verziert, in dem wir sehr vergnügt und fröhlich aßen und nachher sogar tanzten«. In weitem Abstände hiervon erscheint die armselige Feier des Namensfestes des bayrischen Königs in Polozk, zu der die Soldaten das bisschen Talg ihrer schmalen Fettportionen für die Lämpchen zur lllumination des Lagers aufgespart hatten!
Auch am Napoleonstage (15. August) ging es im Lager vor Riga verhältnismäßig hoch her. »Die Soldaten«, erzählt ein ostpreußischer Offizier, »erhielten besondere Gaben von Brot, Branntwein und Tabak, und bei jeder Kompagnie mussten gymnastische Spiele im Springen, Laufen und Klettern veranstaltet werden. Die Gelegenheit, an Napoleons Geburtstage als Sieger in den verschiedenen Wettkämpfen Geldbelohnung zu erringen, belebte hauptsächlich den Eifer dabei«.
Sicherlich ist es den Soldaten des Hilfskorps mehr auf die blanken Taler angekommen, als auf den Ruhm, sie am Geburtstag des Kaisers errungen zu haben. Denn das Geld war infolge der Leere in den preußischen Kassen viel knapper als die Lebensmittel, und von Begeisterung für den höchsten Festtag der Franzosen verspürten diese Bundesgenossen recht wenig. Der oben erwähnte Schreiber betont, dass die Offiziere sich bei der Feier sehr zurückgehalten und nur eben die »Form« beobachtet hätten, auf das Wohl des obersten Führers ein Glas zu leeren. In Mitau tanzten sie beim Festball nicht; doch hat es Philipp v. Wussow nicht unterlassen können, eine Skizze der mit einer Statue des Ungeliebten geschmückten Säulenhalle, in der das Fest stattfand, seinem Tagebuch einzuverleiben.
Nach dem früher Gesagten begreiflich. Die Spannung zwischen ihnen und den Franzosen nahm täglich zu. Schon beim Durchmarsch durch Ost- und Westpreußen hatten die preußischen Offiziere mit besonderem Schmerze die Ausschreitungen der fremden Krieger mit ansehen müssen. Neben dem durch die Umstände halb und halb gerechtfertigten Mundraub waren auch ärgerliche Profanationen vorgefallen. Hartwich erwähnt, dass in der Marienburg die Franzosen einen Rittersmann aus dem Grabe geholt, ihn in einen modernen Infanteristen verwandelt und in dieser Ausrüstung als Wache vor die Tür eines Kornmagazins postiert hatten. Beim Überschreiten der russischen Grenze hatte Yorck eine Rede gehalten, die mit einem Hoch auf den König schloss; der französische Kaiser war dabei vergessen worden.
Zwar waren auch andere Empfindungen zu Beginn der Kampagne rege geworden. Napoleons Kriegsruhm hatte selbst etliche von dessen ausgesprochenen Gegnern elektrisiert. General Grawert, der anfänglich das preußische Hilfskorps befehligte, sah nach Yorcks ärgerlichem Worte in dem Franzosenkaiser »etwas Übermenschliches« und in seinen Marschällen die »Jünger eines Propheten«. Mancher preußische Leutnant mag sich wie Hartwich im Stillen ausgemalt haben, den Napoleonszug über Moskau »nach Ostindien« mitzumachen. Solche Träume, die dem Ehrgeiz schmeichelten, dämmten die vaterländischen Gefühle anfangs doch etwas zurück. Auch für die Auszeichnungen, mit denen Napoleon nicht geizte, war persönliche Eitelkeit nicht immer ganz unempfänglich. Yorck hat das Offizierskreuz der Ehrenlegion, das ihm der Feldzug einbrachte, niemals getragen; aber der Brigadier Oberst von Hörn, ein tapferer Mann und besonderer Liebling Macdonalds, hat nach Eberhardts Darstellung eine fast kindliche Freude beim Empfang des französischen Ordens verraten, obwohl auch er seinem politischen Empfinden nach durch und durch Preuße war.
Während sich im späteren Verlaufe des Feldzugs die Gegensätze mehr und mehr verschärften, tat anfangs Macdonalds gewinnende Persönlichkeit manches, um sie zu überbrücken. Die preußischen Offiziere, die mit ihm zu tun hatten, sind voll des Lobes über die Liebenswürdigkeit des französischen Marschalls. »Sein ganzes Wesen«, schreibt einer, »verkündigte den Mann von Ehre, von Verstand und Wohlwollen«. Ein anderer lobt seine gerade Haltung, seine noblen Züge, seine große Freundlichkeit. Alle stimmen darin überein, dass er die Bundesgenossen außerordentlich gut behandelt, ihre Disziplin und Tapferkeit fortwährend gelobt habe.
Hierzu fand sich eine erste Gelegenheit, als die Preußen in dem glänzenden Gefecht bei Eckau (19. Juli) die Russen geworfen hatten. Ganz im Gegensatze zu Napoleons Eilmärschen war Macdonald mit schneckenhafter Langsamkeit durch Kurland gezogen. Seine übergroße Bedächtigkeit forderte zum Tadel heraus. »Vor jedem Büschlein wurde gehalten«, spottet Hartwich, und Grawert verglich den Marsch mit dem der Raupen, die »immer erst das Hinterteil nachziehen, ehe sie den Kopf wieder vorstrecken«. Bei Eckau stießen die Preußen auf die Truppen des russischen Generals Löwis. Das Gefecht war reich an »spannenden Lagen«, auf die hier im Einzelnen nicht näher eingegangen werden kann. Jedenfalls hatte die Eroberung von Eckau, bei der die preußischen Schützen eine hervorragende Geschicklichkeit bewiesen, die engere Einschließung der Festung Riga zur Folge. Diese blieb dem Hilfskorps überlassen, das sich auch in einer Reihe von weiteren Kämpfen seines neuerworbenen Ruhmes würdig zeigte.
Bei alledem wurde die Blockade der Ostseestadt nur lässig betrieben. Von einer eigentlichen Belagerung war keine Rede, da die Stadt nur von der Südseite eingeschlossen wurde, auf dem nördlichen Ufer der Düna aber völlig freiblieb, so dass der aus Finnland kommende russische General Steinheil ungehindert ein- und auspassieren konnte. Als endlich der schwerfällige Belagerungspark anlangte, war es zu spät, und Riga, das strategische Objekt der Heerfahrt des 10. Korps, durch den Vormarsch der Hauptarmee nach Moskau ziemlich wertlos geworden.
Nachgerade war es zwischen den Preußen und der französischen Oberleitung zu Konflikten gekommen, die einen ernsteren Charakter anzunehmen drohten. Yorck, der an Grawerts Stelle das Kommando des Hilfskorps übernommen hatte, ließ sich in seinem ausgesprochenen Franzosenhasse von Macdonalds Artigkeit nicht gewinnen. Er war ebenso unliebenswürdig wie jener zuvorkommend. »Mit Macdonald«, sagt Graf Henckel v. Donnersmarck, der im persönlichen Auftrag des Königs zu Yorck geschickt wurde, »lebte er stets auf einem gespannten Fuß und tat gewöhnlich nicht mehr, als er eben musste; ja, war es nur irgend möglich, so widersetzte er sich seinen Befehlen geradezu.«
Das bezieht sich freilich weniger auf die eigentlich militärischen Dinge. Noch Ende September leisteten die Preußen der französischen Heeresleitung einen wichtigen Dienst, indem sie in einer höchst eigenartigen und gefährlichen Stellung den Belagerungspark bei Ruhenthal gegen einen feindlichen Überfall erfolgreich verteidigten, allerdings den geschlagenen Gegner ziemlich unverfolgt nach Riga zurückgehen ließen. Yorck benutzte eben den kleinen Krieg in Kurland zur Erziehung seiner Truppen für Aufgaben, die außerhalb des Rahmens des gegen Russland geführten Kampfes lagen. Auch das ist eins der charakteristischen Merkmale des so viele Besonderheiten aufweisenden Feldzugs in Kurland.
Ein anderes ist die fast völlige Untätigkeit Macdonalds. Wenn tatsächlich der Besitz von Riga umso mehr an Bedeutung verlor, je weiter Napoleon nach Osten rückte, so wuchs hiermit umgekehrt die Wichtigkeit der Dünalinie für die Basierung seines weitausgesponnenen Unternehmens. Hätte Macdonald sich mit Oudinot und später mit St. Cyr in Verbindung gesetzt, so wäre es tatsächlich nicht unmöglich gewesen, das Korps Wittgensteins, das sich erst nach und nach durch den Zuzug Steinheils und starke Rekrutierungen verstärkte, solange es an Zahl unterlegen war, gänzlich aus dem Felde zu schlagen. Die hier begangenen Unterlassungssünden sollten sich bitter rächen.
Von diesen Sünden beging Macdonald die schwerste. Außer dem preußischen Hilfskorps, das als 27. Division der großen Armee zählte, verfügte er noch über die (7.) Division Grandjean, die gleichfalls aus Ausländern zusammengesetzt war. Neben mehreren polnischen Regimentern und einer von den Preußen abgegebenen Reiterabteilung gehörten das 13. bayrische und das 1. westfälische Infanterieregiment dazu. Diese Truppen bildeten den rechten Flügel der Aufstellung Macdonalds, der sich mit ihnen, von den links stehenden Preußen südostwärts, an der Düna hinauf bis Jakobstadt und Dünaburg ausdehnte. Hier blieb er lange Zeit unbeweglich stehen. Wieviel nun aber der Marschall auch der Sache seines Herrn hierdurch geschadet, für die ihm untergebenen Truppen ist es ein Gewinn gewesen. Noch im Oktober fiel einem bayrischen Offizier, der von Wrede zu dem Marschall geschickt wurde, das gute Aussehen seiner Landsleute vom 13. Regiment auf: »Unsere Leute strotzten von Gesundheit; der Kontrast mit der Gegend, aus welcher ich kam, wo alles Krankheit und Zerstörung zeigte, war so frappant, dass es mir wie ein Traum vorkam.« Auch auf dem linken Flügel des Macdonaldschen Korps war ein Gleiches der Fall. Bis zum endlichen Abmarsch hat das 10. Armeekorps verhältnismäßig wenig gelitten. Mangel ist auch hier, dank der schlechten französischen Intendantur, zu guter Letzt eingetreten, und es war gerade die Verpflegung, über die der lange Zeit latente Konflikt zwischen Yorck und Macdonald endlich zum Ausbruch kam. Aber bei alledem blieb die vorherrschende Stimmung im preußischen Korps im Ganzen eine optimistische, fröhliche, und es hat in den Hüttenlagern vor Riga an Gesang und derben Soldatenscherzen nicht gefehlt. Leutnant Hartwich erzählt, dass man sich auf den Vorposten damit belustigte, Strohpuppen einander zuzusenden, und was dergleichen Spasse mehr waren. Die Offiziere belustigten sich mit Karten- und Würfelspiel; Philipp V. Wussow benutzte die langen Stunden der Muße, um Stellen in Goethes Faust auswendig zu lernen. Das geschah noch zu einer Zeit, als auf dem Rückzug von Moskau schon Hunderte täglich starben und auch unter den Bayern — nur 30 Meilen dünaaufwärts — das schrecklichste Elend herrschte.
Wir haben hiermit den Zeitpunkt, um den es sich gegenwärtig handelt, bereits überschritten. Bei der verhältnismäßig untergeordneten Rolle, die das Macdonaldsche Korps gespielt hat, erschien es am Platze, über diese Episode im Zusammenhang alles zu sagen, was darüber für unsere Darstellung von Interesse sein konnte. Nur noch einmal wird später dieses Korps genannt werden, bei der Auflösung der großen Armee und der Konvention von Tauroggen.
Wenn nun, alles in allem, die Invasion in Kurland den Charakter eines »militärischen Spazierganges« zeigt, so lagen die Verhältnisse auf dem rechten Flügel der großen Armee erheblich anders. Auch die hier — zumeist im Verein mit den Österreichern unter Schwarzenberg — operierenden Sachsen haben in dem ganzen Feldzug bei weitem nicht so viel gelitten wie die Hauptarmee, aber sie sind auch lange nicht so glimpflich davongekommen wie die zum 10. Korps gehörenden Preußen. Dabei ist die Gestalt, die der Feldzug auf dem von diesen Truppen betretenen Kriegsschauplatz annahm, wieder eine so eigentümliche, dass es einiger besonderen Hinweise bedarf, um den Leser auch hierüber aufzuklären.
Dem Korps fiel die Aufgabe zu, im Süden von Litauen eine ungefähr 60 Meilen lange Linie an der Grenze von Wolynien von Brest-Litowski bis Mozyr gegen die Armee Tormassows zu decken und zugleich ein Eindringen der Russen in das Großherzogtum Warschau zu verhindern. Ursprünglich hatten die Österreicher diese Aufgabe gehabt. Da aber Napoleon die letzteren nicht so nahe an den Grenzen lassen wollte — wohl um ihnen im Fall eines Misslingens des Feldzugs keine Gelegenheit zu geben, eine Schwenkung zu den Feinden hinüber zu machen, — so wollte er Schwarzenberg an die Hauptarmee heranziehen. Daher erhielten die anfangs zu dem Jérôme unterstellten Heeresteil gehörenden Sachsen den Befehl, jene abzulösen.
Auf diesem Marsche mussten sie bei der glühenden Sonnenhitze die hohen Ebenen des südlichen Litauens durchziehen. Das Land war hier nicht arm, aber es fehlte wie überall an erquickendem Schatten und trinkbarem Wasser. »In der unabsehbaren Fläche«, sagt der sächsische Generalleutnant v. Funck in seinen Erinnerungen, »wo der Weg fast immer in geraden Linien allmählich bergauf ging, wurde das Auge nur selten durch die Abwechslung eines Hügels oder eines sumpfigen Gebüsches erfreut, und so üppig das Getreide, jetzt meistens in der Blüte, stand, so ermüdend war doch das ewige Einerlei des Anblickes. Die Dörfer lagen versteckt in Vertiefungen, gewöhnlich in einem schmutzigen Moorgrunde, wo ein in tausend kleine Rinnen zerteilter, kaum merkbar fließender Bach zur Befriedigung des Durstes nichts als ein missfarbiges, übelriechendes Getränk darbot, und oft mussten die Truppen des Abends noch stundenlang marschieren, um nur die Nacht nicht ganz ohne Wasser zuzubringen.«
Sachsen und Österreicher begegneten sich bei Slonim, von wo die ersteren nach Süden zogen, in ein Terrain, das der Kriegsführung ganz eigenartige Aufgaben stellte. »Das alte Litauen«, sagt der ebengenannte Augenzeuge, »wird von Wolynien durch Moräste getrennt, die, abwechselnd sechs bis zwanzig Meilen breit, sich in einer Länge von mehr als sechzig Meilen von Abend gegen Morgen erstrecken und, in der Linie von Brest, Pinsk und Mozyr, den größten Teil des Zwischenraumes zwischen dem Bug und dem Dnieper ausfüllen. Sie neigen sich mit kaum merklicher Abdachung von der Ebene Litauens gegen Mittag und Abend und umschließen trockene Bezirke von ungleicher Ausdehnung, die, zum Teil gut angebaut, in der Mitte der Sümpfe gleichsam als Inseln oder Oasen erscheinen. Nur an solchen Stellen fließen die vielen Ströme der Gegend in ordentlichen Betten; bald nachher verlassen sie wieder ihre Ufer, verbreiten sich über das Land und machen es zum undurchdringlichen Bruch. Die Moräste selbst sind mit Waldung und Gebüsch bedeckt, wo jeder große Baum eine kleine Insel bildet. Hart an dem Stamm steht man auf fester Erde, zwei Schritte weiter versinkt man in dem Boden. Der Pripet, der in der niedrigsten Gegend fließt, nimmt den größten Teil dieser Gewässer auf«.
Drei auf Holzdämmen angelegte Straßen gingen von Norden nach Süden durch die unwegsamen Moräste nach den genannten Orten Brest, Pinsk und Mozyr. Wer diese Endpunkte besaß, konnte der aus Wolynien kommenden russischen Reservearmee den Zugang nach Litauen sperren. Aber der Führer des sächsischen Heeres, General Reynier, verfügte über zu schwache Kräfte, um alle drei Eingangspforten zu besetzen. Er suchte daher wenigstens eine zu gewinnen, um den Feind festzuhalten und bei einem Übergang an einer andern Stelle um seinen Rücken besorgt zu machen. Im Hinblick auf seine eigenen Verbindungen wählte er den am meisten nach Westen gelegenen jener strategisch wichtigen Orte, nämlich Brest, und beeilte sich, nach dieser Gegend abzurücken.
Wir benutzen den Moment, um über das sächsische Korps und seinen Führer ein Wort einzuschalten. Auch dieses aus sehr guter Infanterie und Artillerie bestehende Korps hatte wie die Bayern zu wenig Reiterei, da ja auch ihm zwei seiner besten Regimenter, die Brigade Thielmann, genommen und zur Hauptarmee versetzt waren. Vergebens bat Reynier wiederholt um Verstärkung an Reitern.
Im Übrigen bestanden zwischen' dem französischen Korpskommando und den Sachsen Verhältnisse, wie wir sie gleichfalls schon an anderen Stellen wiederholt beobachten konnten. Allerdings mit einem charakteristischen Unterschiede. Denn persönlich war Reynier, ein stiller, verschlossener Mann, trotz seines wortkargen Wesens bei den Sachsen nicht unbeliebt. Urteilsfähige Offiziere, der Generalstabskapitän v. Cerrini, der Rittmeister v. Odeleben und andere, geben ihm das beste Zeugnis, und nur der Generalleutnant v. Funck, seinerseits eine wenig anziehende Persönlichkeit, hat ihn, unter scharfem Widerspruch der Sachsen selber, als misstrauisch und eigennützig geschildert, wobei doch auch er den militärischen Talenten des Generals Gerechtigkeit widerfahren lassen muss. Jedenfalls hatte der Soldat Vertrauen zu dem ernsten Manne, nannte ihn »Vater Reynier«, und begrüßte sein Erscheinen auf dem Schlachtfelde als Vorboten des Sieges: »Reynier kommt, nun wird es bald ein Ende haben«. Weniger traute man seiner Umgebung, und die Intendantur begegnete auch hier wegen ihrer Ungeschicklichkeit und der Habsucht, mit der sie das Land auspresste, vielfachem Tadel. Man sah mit Unwillen, dass sie durch ihr Verhalten die Polen, die auch in diesem Teil ihres ehemaligen Landes den Fremden anfangs sehr geneigt gewesen waren, nach und nach erbitterte. Neben andern Missetaten wurde den französischen Beamten der Vorwurf gemacht, die Gestüte der wolynischen Gutsbesitzer in unverantwortlicher Weise ausgeraubt zu haben, ohne dass der Armee von der gemachten Beute etwas zugutegekommen wäre.
Hier an der wolynischen Grenze sollten nun die Sachsen einen ernsteren Unfall erleben. Eine unter dem Generalmajor v. Klengel stehende Brigade wurde in dem Städtchen Kobrin das Opfer des Hin- und Herziehens durch die Sümpfe, vielleicht auch eines missverstandenen Befehls von dem Kommandierenden, nach welchem sich Klengel verpflichtet fühlte, den Ort gegen die von verschiedenen Seiten anrückenden Feinde um jeden Preis zu halten. Die Sachsen wehrten sich standhaft. Ein Durchbruchsversuch, den der Oberstleutnant v. Zezschwitz mit dem Chevaulegersregiment v. Polenz machte, musste bei der erdrückenden Übermacht des Feindes misslingen. Erst als das aus Holzhäusern bestehende Städtchen an allen Ecken brannte, ergab sich Klengel nach sechsstündigem Gefechte. Die russischen Offiziere waren über die geringe Anzahl ihrer Gegner erstaunt. »General Tokmassow«, schreibt Zezschwitz in seinem Tagebuche, »empfing uns sehr artig und überhäufte uns mit Lobeserhebungen über die hartnäckige und gute Verteidigung. Unsere Degen gab uns der General selbst mit den Worten zurück: ‚Männern, welche sich so brav geschlagen haben wie Sie, gehören ihre Degen zurück, ihr Wort ist mir genug‘«.
Eiligst ging nun Reynier nach Norden zurück, um die Verbindung mit den Österreichern wiederherzustellen. Ein gefahrvoller Nachtmarsch entzog ihn der Verfolgung.
Diese Märsche auf schmaler Straße zwischen bodenlosen Sümpfen hatten namentlich in der Finsternis etwas Unheimliches. »Nur das einzelne Klirren der Bajonette und die dumpfen Stöße der Geschütze und Munitionswagen tönten schauerlich durch die Nacht«. Ein Glück, dass Tormassow, ebenso langsam wie die meisten seiner Waffengefährten, die Verfolgung lässig betrieb. Nur die Kosaken erwiesen sich schon hier, wie überall, wo es sich um leichten Reiterdienst handelte, als gefährlich, und das umso mehr, als die sächsische Kavallerie, nun auch noch durch den Verlust bei Kobrin geschwächt, dem beschwerlichen Vorpostendienst nicht mehr gewachsen war.
Alle Welt atmete auf, als man endlich mit den Österreichern wieder zusammenkam. Der der Hauptarmee nachziehende Schwarzenberg war umgekehrt. Das findet Napoleons Billigung, der ihm nach dem Bekanntwerden des Unfalls bei Kobrin den Oberbefehl über das Ganze übertrug und ihn nunmehr anwies, zur Sicherung der rechten Flanke des großen Heeres mit Reynier zusammen in Wolynien zu verbleiben. Dieser hatte sich inzwischen durch ein Gefecht mit der unter General Lambert stehenden Vorhut des Tormassowschen Korps den Weg zu dem österreichischen Feldherm gebahnt.
Nun ging es wieder gemeinsam vorwärts. Die Stimmung war besser geworden. Sachsen und Österreicher hatten bei ihrem Zusammentreffen einander freudig umarmt.
Am 12. August kam es bei Gorodeszna zu einem neuen ernsten Zusammenstoß mit dem Feinde.
Auf sehr günstigem Terrain hatten sich die Russen aufgestellt, hinter einem breiten und tiefen Sumpfe, über den es vor ihrer Front nur einen Übergang — bei dem Dorfe Gorodeszna selber — gab, den Tormassow stark besetzt hielt. Vor diesem Moraste standen die Österreicher, die sich wesentlich auf ein Artilleriegefecht beschränkten. Den Sachsen fiel die schwierigere Aufgabe zu, durch Umgehung des linken Flügels die Rückzugslinie der Feinde zu gefährden. Es gelang ihnen, auf einem mit Hilfe der Umwohner entdeckten, seit langer Zeit nicht mehr benutzten Holzwege das stymphalische Gewässer zu durchqueren und den Russen auf den Leib zu rücken. Die Sachsen schlugen sich nach einstimmigem Urteile nicht nur ihrer eigenen, sondern auch der französischen und österreichischen Offiziere vorzüglich, waren aber zu schwach, um dem Gegner den Rückzug abzuschneiden. Letzteres hätte geschehen können, wenn Schwarzenberg sie genügend unterstützt hätte. Dass er es nicht tat, ist wohl in diesem Falle lediglich der natürlichen Langsamkeit zuzuschreiben, die zu den bezeichnenden Merkmalen Schwarzenbergscher Feldherrnkunst zählte. Er wird von ihr im Verlaufe der Kampagne noch weitere Beweise ablegen; doch wird gegen Ende derselben sein Verhalten so zweideutig, dass dabei gewiss die Instruktionen des Wiener Hofes mitgewirkt haben müssen, der wenig Bereitwilligkeit zeigte, das gestellte Hilfskorps Napoleons Zwecken zu opfern. Schon bei Besprechung des Gefechts von Gorodeszna erklärt ein sächsischer Generalstabsoffizier Schwarzenbergs Haltung für unbegreiflich, »wenn man sich nicht in das Reich politischer Möglichkeiten verlieren wolle.«
Auch beklagten die Sachsen, wie die Bayern bei Polozk, abermals ihren Mangel an Kavallerie, der sie gehindert habe, die von ihnen selbst errungenen Vorteile weiter auszunutzen. Aber den Österreichern fehlte es nicht an Kavallerie, sondern an Initiative. »Die Österreicher wollen nicht recht beißen«, schreibt auch der sächsische Oberst v. Böse ärgerlich. Das wird sich, wie gesagt, noch öfter wiederholen.
Nach der Schlacht bei Gorodeszna hatte sich Tormassow hinter den Styr, einen Nebenfluss des Fripet, zurückgezogen. Seine Stellung war nicht unangreifbar, und es hätte im Interesse Napoleons gelegen, ihn hier zu schlagen, bevor der Feind Verstärkung erhielt. Eine solche stand aber diesem in Aussicht. Denn ein neues russisches Heer unter dem Admiral Tschitschagow, das bis dahin gegen die Türken an der Donau gestanden, war frei geworden, da der türkische Sultan dem seit längerer Zeit zwischen seinem Reich und Russland bestehenden Kriegszustande durch den Frieden von Bukarest ein Ende gemacht hatte. Das war ein schwerer Schlag tür Napoleon, der auf das Fortbestehen dieses Krieges stark gerechnet hatte. Doch wäre, wie bemerkt, Schwarzenberg bei rechtzeitigem Eingreifen imstande gewesen, die Russen Tormassows mit an Zahl überlegener Macht anzugreifen, da es längere Zeit dauern musste, bevor Tschitschagow herankommen konnte. Stattdessen blieb er untätig am Styrflusse stehen. Seine Truppen fanden hier allerdings ein fruchtbares Land, »reich an Getreide, an Früchten, an fetten Weiden und Viehzucht«, auch an Fischen, Geflügel und Branntwein, wie General Funck es schildert. Aber wiederum wurde mit den gefundenen Vorräten schlecht hausgehalten. Immerhin war man für den Augenblick von Not entfernt.
Dagegen hatten die Verbündeten auch jetzt wieder von den täglichen Neckereien der überlegenen Reiterei des Feindes zu leiden. Fortwährend wurden Patrouillen abgefangen, einzelne Posten überfallen, hier und da auch ein größeres Detachement zur Ergebung gezwungen. »Die Kosaken«, sagt der sächsische Husar Goethe, nebenbei bemerkt, ein weitläufiger Verwandter des Dichterfürsten, »bildeten eine undurchdringliche Vorpostenkette, so dass unsere Patrouillen zuverlässige Nach* richten über Stellung und Stärke des Feindes nicht einzuziehen vermochten. Hierzu kam, dass wir der Wege und Sprache ganz unkundig waren und es schwer hielt, einen zuverlässigen Boten zu bekommen, der uns durch die großen Waldungen und Sümpfe richtig führte, da, wenn wir ein Dorf erreichten, die männlichen Bewohner entflohen waren. Wurden wir aber eines russischen Bauern habhaft, so benutzte derselbe gewiss die erste beste Gelegenheit, um in den Wald zu entspringen. Obgleich nun durch diese gemachten Erfahrungen vorsichtig geworden, da wir den Boten mit einer Fouragierleine an ein Pferd banden, so kamen doch Fälle vor, dass er auch diese unbemerkt durchschnitten und sich in Freiheit gesetzt oder, wenn er daran behindert worden war, uns einen falschen Weg geführt hatte, auf welchem wir einige Mal fast dem Feinde in die Hände gefallen wären.«
Trotz alledem war die Lage auch auf dieser Seite des Kriegsschauplatzes zurzeit keine ganz ungünstige. Das Treffen von Gorodeszna war wie das Gefecht bei Eckau und in weit größerem Maßstabe die Schlacht bei Polozk ein Erfolg und auf den beiden Flanken vorderhand nichts Ernstes zu befürchten. Wenn nur das Hauptunternehmen glückte, wenn vor allem die Russen sich endlich zur Schlacht bequemten, solange die Kräfte des eigenen Heeres noch hinreichten, sie vernichtend zu schlagen! Dann durfte Napoleon immer noch hoffen, den Frieden in Moskau zu diktieren, wie er ihn 1805 und 1809 in Wien diktiert hatte. Wir kehren jetzt von den Flanken zur Hauptarmee zurück, um zu sehen, inwieweit sich die Hoffnungen des großen Imperators erfüllen werden.
1 Für den rapiden Abgang sprechen folgende Zahlen: Vor dem Ausmarsche war das 6. Korps 22 500 Mann stark gewesen, bei der Revue in Wlna, wo es noch eine so imposante Haltung gezeigt, etwa 20 000. Am 7. August, dem Tage ihres ersten Eintreffens vor Polozk, hatten die Bayern noch 15 400 Mann gezählt. Bei der Wiederankunft in der Nähe der Stadt waren es kaum noch 12 500.