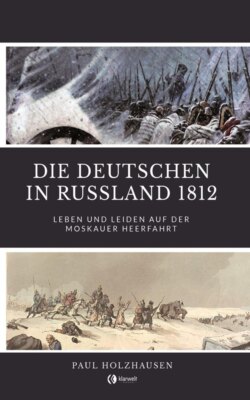Читать книгу Die Deutschen in Russland 1812 - Paul Holzhausen - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZUG DURCH DEUTSCHLAND. LEBEN IN POLEN UND LITAUEN. EINTRITT IN ALT-RUSSISCHES GEBIET.
Оглавлениеer große Imperator scheint im Zenit seiner Macht zu stehen. Vor Jahren hat er Preußen gedemütigt, Österreich wiederholt geschlagen, er ist Herr in Deutschland; er regiert auch in Italien von den Alpen bis Reggio—Charlemagne.
Und doch hat er eigentlich die Gipfelhöhe überschritten, Gewiss, er kann es sich jetzt leisten, durch einen Federstrich in Trianon die deutsche Nordseeküste in französische Departements zu verwandeln, kann gebieten, dass das Haus So und so aufgehört hat zu regieren; er kann den Staat Friedrichs des Großen zwingen, ihm in einem neuen Feldzug Heeresfolge zu leisten: das kann er alles.
Aber leise beginnt der Boden unter seinen Füßen zu schwanken. In Spanien schwelt ein langsames Feuer, das Legionen frisst und in letzter Zeit um sich greift, geschürt von England, das hinter den hölzernen Mauern seiner Flotte den Geschwadern Murats, den Bataillonen der alten Garde trotzen kann. Und England, dessen Zähigkeit im Kampf um die Herrschaft auf unserm Planeten keinem des jetztlebenden Geschlechts ein Geheimnis mehr ist, hat auch seine Hand in dem Zerwürfnis Napoleons mit Russland. Die Kontinentalsperre, die die britischen Waren vom europäischen Festland ausschloss, hatte England mit den berüchtigten Orders in Council beantwortet, die jedes Schiff, das zwischen den für die Briten gesperrten Kontinenthäfen verkehrte, für vogelfrei erklärten und den Handel der in dem Kampf zwischen Löwen und Walfisch neutralen Nationen nahezu unmöglich machten.
Es gab eigentlich keine Neutralen mehr in diesem Kampfe: es gab nur noch ein Für und ein Wider. Und so kam es auch zum Kriege zwischen Alexander und Napoleon.
Nicht allein deswegen. Nicht die Kontinentalsperre allein hat ihn entzündet. Freilich kam es auch darüber zu einem Zerwürfnis. Der Zar konnte sich Napoleons Forderung, die russischen Häfen dem englischen Handel zu schließen, auf die Dauer wohl nicht fügen, mit Rücksicht auf die Eigenart seines Landes, dessen Ausfuhr hauptsächlich in Rohprodukten bestand, die nach England gingen und gegen dortige Industriewaren umgetauscht wurden. Die Schädigung des heimischen Wohlstandes rief in Russland eine starke Erregung hervor, die den Ausbruch des Nationalhasses gegen die Franzosen vorbereitete, den wir 1812 so lichterloh emporflammen sehen.
Aber es war noch sonst Zündstoff genug. Die sogenannte »Freundschaft« Alexanders für Napoleon, an die die Zeitgenossen lange geglaubt haben, ist ja eins der albernsten Märchen, mit denen die Welt der Regierten angeführt wurde. In der komplizierten Seele des Zaren lebte der Wunsch aller Selbstherrscher an der Newa nach dem Besitze von Konstantinopel. Den wollte Napoleon nicht erfüllen. Und der Zar seinerseits fürchtete die Herstellung Polens. Das waren die tieferen Gründe des Bruches, der zu dem entsetzlichen Kriege führen sollte. Neben diesen realpolitischen Faktoren mögen psychische Imponderabilien mitgewirkt haben.
Alexander und Napoleon waren Kinder ihrer Zeit. Der erstere als der bei weitem kleinere Geist erscheint von ihren Strömungen natürlich abhängiger als der seine Mitwelt um ein Stück überragende Riese. Alexander I. war Selbstherrscher, Galan, Liebhaber und Menschenbeglücker in einer Person. Auf letzteres tat er sich viel zugute. Keinem sind die Humanitätsphrasen des 18. Jahrhunderts so honigsüß von den Lippen geflossen wie dem zweizüngigen Slaven, der später durch die »Heilige Allianz« die Völker binden und knuten half. Er gefiel sich in der Rolle eines »Zar-Befreiers«, Befreiers von der Herrschaft eines aus der gottlosen Revolution hervorgegangenen Usurpators. Dieser Zug tritt schon lange vor 1812 hervor.
Wenn jener halb mystische Zug im Verein mit seinem Machtgelüst den Zaren zum Kampf gegen Westen drängte, so zog den Kaiser etwas nach Osten. Seit seiner Jugend hatte er — vielleicht von Rousseau verführt, vielleicht von den Ideen altfranzösischer Orientpolitik, vielleicht gelockt durch das Vorbild Alexanders des Großen — von einer Herrschaft im Osten geträumt. Auch über Moskau führte ein Weg nach Indien. Wenigstens in dem Sinne, dass Russland besiegt sein musste, bevor an jenen fernen Osten zu denken war. Möglich, dass Phantasiebilder dieser Art, leise Unterströmungen der Seele, deren Herrschaft sich der klarste Kopf nicht immer zu entziehen vermag, mitgewirkt haben, um den sonst so scharfen Denker zu dem gigantisch-verwegenen Unternehmen zu verführen, das sein Verderben wurde. War‘s die letzte Konsequenz seines Wesens und Wirkens, war‘s Verhängnis, »Zäsarenwahn«, »Gottesgericht«? Man wird nach verschiedener Weltauffassung verschieden darauf antworten.
Wir wollen aus dem Nebel der Hypothesen auf den Boden des Tatsächlichen zurückkehren.
Für das Volk beginnt ein Krieg mit der Kriegserklärung; für das feinere Ohr des Staatsmannes mit dem Vorklingen der ersten scharfen Töne im diplomatischen Verkehr, für den Militär mit den Rüstungen und beginnenden Truppenverschiebungen.
Die Rüstungen hatten 1810 begonnen, die Dislokationen der Truppenkörper 1811. Wir haben es hier nur mit der einen Seite, der großen Armee, zu tun unter der noch engeren Beschränkung auf die deutschen Heeresteile. Überhaupt soll die militärische Vorgeschichte hier nur in den allgemeinsten Umrissen gezeichnet werden.
Schon zu Anfang des Jahres 1811 waren die unter Davout in Norddeutschland stehenden Truppen des Kaisers vermehrt worden. Die französischen Besatzungen in den preußischen Festungen waren verstärkt. Dann begann das Heranschieben von Regimentern aus den ferneren Ländern, aus Italien und Spanien. Um das an ein paar Beispielen zu erörtern: Im Januar 1812 wurden mehrere Schwadronen des auf der iberischen Halbinsel stehenden bergischen Lanciersregiments nach Deutschland berufen, um im Depot zu Hamm komplettiert und mittels neuer Aushebungen auf die Stärke eines vollen Kavallerieregiments gebracht zu werden. Heinrich v. Brandt, später einer unserer treuesten Berichterstatter, der mit seinem Regiment in Valencia stand, erhielt am 8. Januar die erste Nachricht von dem drohenden Kriege mit Russland. Schon am 10. war das Regiment auf dem Marsch nach Frankreich.
Das waren Truppen, über die der Kaiser unbedingt zu verfügen hatte. Am 24. Februar 1812 wurde aber in Paris ein Vertrag zwischen Frankreich und Preußen unterzeichnet, nach dem letztere Macht ein Hilfskorps von 20 000 Mann zu dem Kriege zu stellen hatte. Schon am 11. Dezember 1811 hatte Napoleon an die uns hier vor allem interessierenden Staaten des Rheinbundes die Aufforderung ergehen lassen, ihre Truppen tür den bevorstehenden Feldzug in Bereitschaft zu stellen. Am Abende des 5. Februar lief in München ein Schreiben des Kaisers ein, in dem König Max ersucht wurde, das bayrische Kontingent bis zum 15. Februar marschfertig zu halten. Dieselbe Frist wurde den Württembergern gestellt. Auch in Dresden ward an diesem Tage der Mobile machungsbefehl erlassen. Das ging alles wie am Schnürchen. In Karlsruhe hatte am 7. der Flügeladjutant des Großherzogs dem Grafen Hochberg eröffnet, dass er das Kommando des für den Feldzug bestimmten badischen Kontingents zu übernehmen habe. Auch im Königreich Westfalen waren die Vorbereitungen eifrig betrieben, und Ende Februar war die Armee vollkommen ausgerüstet. Am 1. März fand in der Karlsaue bei Kassel eine Revue aller Truppen statt, die in der Residenzstadt Jérômes in Garnison lagen oder in der Umgegend kantonierten.
Ein paar Wochen später ist das Bild schon wesentlich verändert. Schon im März ziehen die Bayern von Bamberg nach Schlesien, die Württemberger sind im Marsch nach der Weichsel begriffen; im April stehen die Sachsen schon bei Warschau, die Westfalen sind von Fialle her auf demselben Wege. Auch die vier großen Kavalleriekorps mit ihren vielen deutschen Reitern sind im Osten angelangt.
Wir übergehen die Einzelheiten des Aufmarsches, die in jedem etwas ausführlicheren Handbuch verzeichnet stehen, um uns den inneren Verhältnissen zuzuwenden, dem in den deutschen Truppenkörpern herrschenden Geiste, den Stimmungen und Gesinnungen, die in ihnen vorwiegend vertreten waren, den Freuden und Leiden auf den Märschen durch Städte und Länder, in denen noch die deutsche Zunge klang, vaterländische Bildung und Gesittung herrschte, die man bald entbehren und nach der man sich heiß zurücksehnen sollte.
Die Stimmungen beim Auszug waren natürlich je nach der Heimat, aus der die Teilnehmer an dem Feldzuge stammten, dem Staatsverbande, dem sie angehörten, und der persönlichen Charakters und Gemütsanlage recht verschieden gewesen. »Dreiviertel des ganzen Heeres«, sagt der Leutnant v. Wedel darüber, bestanden aus Nationen, deren wahren Interessen der beginnende Krieg schnurstracks entgegen war. Viele waren sich dessen bewusst und wünschten in der Tiefe der Brust mehr den Russen als sich selbst den Sieg, und dennoch war jede Truppe brav und focht am Tage der Schlacht, als gelte es ihre eigenen höchsten Interessen. Wer kein höheres Ziel vor Augen hatte, wer nicht wie der Pole fürs Vaterland kämpfte oder, richtiger, Napoleons Versprechen trauend, fürs Vaterland zu kämpfen glaubte, wollte wenigstens seine eigene Mannesehre und die Ehre seiner Nation hochhalten, indem er keinem andern den Vorzug einräumte. So entstand gerade aus dieser bunten Zusammensetzung des Heeres ein edler Wettstreit des Mutes und der Tapferkeit, und wie auch der einzelne über Napoleon sonst denken mochte, ob er ihn liebte oder hasste, so war doch wohl im ganzen Heere keiner, der ihn nicht für den größten und erfahrensten Feldherrn hielt und unbedingtes Vertrauen auf sein Talent und seine Kombinationen setzte.
Wo sich der Kaiser zeigte, glaubte sich der Soldat des Sieges gewiss; wo er erschien, ertönte ein tausendstimmiges Vive l‘Empereur! Der blendende Schein seiner Größe überwältigte auch mich und riss mich hin zu Bewunderung und Enthusiasmus, dass ich aus vollem Herzen, mit aller Kraft meiner Stimme, einstimmte in das Vive l’Empereur!«
Wenn so ein Mann schreiben konnte, dessen Vater von Friedrich dem Grossen in den Grafenstand erhoben worden war, so wird man sich nicht wundern dürfen, dass ein tapferer Rheinbundsoffizier sich in folgender Weise ausdrückt, die besser noch als die Worte des eben Genannten den eigentlich entnationalisierten Charakter des großen Heeres und die in demselben vorherrschende Gesinnung zum Ausdruck bringt:
»Ein wilder, kriegerischer Geist zog durch alle Lande; das bluttriefende Schwert fragte nicht: warum und gegen wen gezückt, sondern: wie geschlagen? Den Fahnen und Standarten des eigenen Heeres Ruhm zu erfechten, war die Parole des Tages; und die Sachsen hatten immer, so auch in den jüngsten Kämpfen, bewiesen, dass ihnen die Ehre kein hohler Klang sei — die Anerkennung der unparteiischen Mitwelt flocht ihnen dafür den wohlverdienten Lorbeerkranz um die Stirne. Der Erinnerungsruf an Friedland und Wagram ging von Regiment zu Regiment als glorreiche Mahnung, festzuhalten am guten Geist, und aus den kaum übergrünten Gräbern der gefallenen Kameraden klang es hinauf in den waffenblitzenden Tag: Haltet fest an der Ehre, du wir besiegelt im Heldentod!«
Unnötig zu sagen, dass diese Gesinnung nicht von allen geteilt wurde und dass gerade unter den seit dem Tilsiter Frieden so schwer gedrückten Preußen viele die Frage erwogen, ob nicht dieser Krieg, je nach seinem Ausfall, vielleicht der Anfang einer neuen Zeit werden könne, die ihrem Vaterlande die Befreiung von der Franzosenherrschaft bringen würde. Aber auch bei diesen, also selbst den Napoleon feindseligsten Elementen des großen Heeres war das soldatische Gemeinsamkeitsgefühl, das sie als Angehörige einer Armee an deren Fahnen und Führer fesselte, stark genug, um einen preußischen Reitersmann, der mit gen Moskau zog, sagen zu lassen: »Der Gleichmut und die vollkommene Siegesgewissheit, die angesichts der Gefahr aus den Augen der Soldaten strahlten, bewiesen wohl deutlich genug, dass all diese Kriegshaufen, welcher Nation sie auch angehören mochten, sich nichtsdestoweniger doch als ein großes Ganze fühlten und als solche zu handeln entschlossen waren.«
Bleibt die Frage, ob sie gerade gern nach Russland marschierten. Auch heutzutage erfreut sich der Gedanke eines Feldzugs in dieses Land unter deutschen Militärs nicht eben hervorragender Beliebtheit, wozu gerade die Erinnerung an das entsetzliche Ende der großen Armee und der Untergang der vielen Tausende unserer Landsleute beitragen mögen. Auch damals ist die Zahl derer, die Befürchtungen hegten, nicht gering gewesen. Den Rheinbündlern standen die Erinnerungsbilder aus den Jahren 1806/7 deutlich vor Augen, wo man die armseligen Hütten und den knietiefen Schmutz der Straßen Polens aus eigener Erfahrung kennen gelernt hatte.
Trotzdem zieht nun aber der echte Soldat gern zu Felde. Diese Freude an einer Kampagne und die unzweifelhaft vorhandenen Befürchtungen wegen der Unwirtlichkeit des Landes, in das die Heerfahrt gehen sollte, erzeugten ein Widerspiel miteinander streitender Empfindungen, das der württembergische Leutnant Karl v. Suckow in humorvoller Weise gezeichnet hat, an einer Stelle des Buches »Aus meinem Soldatenleben«, wo er die Eindrücke schildert, die die Kunde von der Marschorder unter den Offizieren und Mannschaften seines kleinen Garnisonstädtchens Schorndorf hervorrief:
»So saß ich denn eines Morgens zu Anfang des Monats Januar in meinem einsamen Stübchen mit Lektüre beschäftigt, als ein Klopfen an die Türe dieselbe unterbrach und ich durch den eintretenden Unteroffizier die Meldung erhielt, dass soeben der Befehl zur Einberufung sämtlicher Beurlaubten eingetroffen sei. Konnte man es wohl dem Überbringer dieser Nachricht verargen, dass er freudestrahlend mir dieselbe mitteilte? Er war jung und Soldat, folglich wollte er Krieg, abgesehen davon, dass er die Freuden Schorndorfs wohl gleich mir genügend gekostet haben mochte.
Wie kam es nun aber, dass ich sowohl als meine Kameraden mit jenem kriegslustigen jungen Waffengefährten in dieser Beziehung nicht unbedingt sympathisierten, da uns doch jede Aussicht auf einen Feldzug in ein andres Land höchst willkommen gewesen wäre, namentlich mir, der ich davon bereits zweien, aber sozusagen leider nur par distance angewohnt hatte? War es vielleicht das verhängnisvolle Wort »Russland«, das uns mit trüben Ahnungen erfüllte und deshalb unseren Kriegseifer dämpfte? Ich glaube es. Die allgemeine Stimmung in Beziehung auf jenen abenteuerlichen Zug war im Allgemeinen eine gedrückte. Ja, unsere höheren kriegserfahrenen Vorgesetzten verbargen es weder sich noch uns, dass wir keinem Rosengarten entgegenzögen.
So erinnere ich mich, dass wir bei Anwesenheit unseres Brigadegenerals v. Hügel zum Behufe der Musterung des Bataillons diesem Vorgesetzten, der später die erste militärische Stellung im Lande bekleidete, ein Festdiner im goldenen Hirsch veranstalteten. Was war natürlicher, als dass sich dabei die Unterhaltung größtenteils um unsere bevorstehende Aufgabe drehte! Der General warnte, sich doch ja keinen Illusionen hinzugeben und auf alle Eventualitäten männlich gefasst zu sein. Ein junger Leutnant war jedoch anderer Meinung; er nahm die Sache sehr leicht und versicherte etwas vorlaut: ‚So einen russischen Feldzug mache ich eben so leicht mit, wie ich ein Butterbrot esse!‘ Der General ward auf diese Äußerung sehr ernst und erwiderte: ‚Herr Leutnant, ich will Sie an dieses Butterbrot erinnern!‘ Und wahrlich, er hielt Wort, wie wir später hören werden«.
Begreiflich, dass der Abschied von der Heimat diesmal schwer fiel. »Der Ausmarsch«, sagt der bayrische Oberleutnant v. Furtenbach, »war feierlich und rührend, gleichsam als wenn die Leute es ahnten, dass kaum ein halbes Drittel unseres schönen Regiments wieder zurückkehren sollte«
»Viele von uns, und auch ich«, schreibt der Regimentsarzt v. Roos, »umarmten den Grenzpfahl, küssten ihn und dankten für das Gute, das uns der nun verlassene heimische Boden von zarter Jugend an erwiesen hatte. Vielen glaubte man da ein Vorgefühl unglücklicher Zukunft anzusehen, und viele riefen laut: »Lebt wohl, ihr Geliebten, die wir nun daheim lassen, wir werden uns vielleicht nicht wieder sehen!«
Aber gern oder ungern, man musste marschieren. Und da stellte sich denn bei den Klängen der Regimentsmusik und dem fröhlichen Leben in den ersten Quartieren vielfach eine Heiterkeit ein, die mit dem späteren Elend in einem so scharfen Kontrast steht. Junge ehrgeizige Offiziere träumten von dem Ruhme, den sie und ihre Truppen auch unter den Fahnen eines fremden Imperators erkämpfen würden. Der sächsische Premierleutnant v. Meerheim schreibt darüber:
»Unverstellte Freude blickte vom ersten Marschtage an aus jeder Miene, und lauter Jubel ertönte fortwährend im langgestreckten Zuge der Geharnischten. Glücklich in dem bloßen Gedanken, nun auf den alleinigen Weg zum heiß ersehnten Ziele gelangt zu sein, störte keine Ahnung dunkler Zukunft diesen allgemeinen Frohsinn, gedachte jeder nur der ihm bald obliegenden Pflichten und des dem Regimente zu erringenden Ruhmes, und alles andere, so warm das patriotische Interesse auch sein mochte, blieb von diesem Augenblicke an fremd und musste schweigen.«
Auch unter den Soldaten ist eine gehobene Stimmung zu beobachten. Und wie sollte es anders sein, wenn sie von den rauschenden Festlichkeiten hörten, sie gar sahen, mit denen der große Imperator allenthalben gefeiert wurde, besonders in Dresden, wo sich Kaiser und Könige zu einem letzten großen Rendezvous um ihn versammelten, wo sich des Abends »ein von bunten Papierlaternen komponierter breiter Regenbogen in allen Farben des Lichtes vom Elbspiegel aus hoch über die Brücke spannte,« der Brücke, die in den letzten Wochen erdröhnt war unter den donnernden Tritten endlos einherziehender Kolonnen, »der hohen Kürassiere mit beschweiften Helmen und goldenen Panzern, der leichtberittenen Chasseurs, Ulanen, Dragoner, Husaren, aller Gattungen von Infanterie und Artillerie, langer Züge von Pontons und Kriegsgerät.«
Selbst in einer nüchternen Kaufmannsstadt Norddeutschlands, in Bremen, wurde den abziehenden Truppen auf der Bühne eine Ovation gebracht, indem ein Schauspieler mit Stentorstimme die Verse deklamierte:
»Euch öffnen sich des Glückes gold‘ne Tore,
Mit Euch will ich den mächt‘gen Feind bezwingen.
Moskwa ist reich an Gütern; unermeßlich
An Gold und Edelsteinen ist sein Schatz
Der Zaren; meine Freunde kann ich königlich
Belohnen, und ich will's! Wenn ich als Herr
Und Sieger einzieh' auf dem Kreml, dann, ich schwör‘s,
Soll sich der Ärmste unter Euch, der mir
Dahin gefolgt, in Samt und Zobel kleiden,
An Gold und Silbergeld und Bankozetteln weiden«.
Auch in anderer Hinsicht war die Aufnahme der Durchmarschierenden meist eine gute; wenigstens in den zu dem damaligen Rheinbund gehörenden Ländern. Namentlich die Frauen- und Kinderwelt fand Gefallen an den schmucken Gestalten; manches Liebesabenteuer wurde schnell bestanden, der letzte Blick ins warme Leben für so viele, die ein Jahr darauf in Eis und Schnee begraben lagen. »Die Gutmütigkeit dieses Volkes hat wahrlich keine Grenzen«, schreibt der württembergische Leutnant v. Martens aus der Zeitzer Gegend, »und selbst die blauäugigen und rotbackigen Mädchen glaubten aus lauter Gastfreundschaft uns mehr einräumen zu müssen, als wir mit gutem Gewissen erwarten konnten«. Der Krefelder Karl Schehl, der als 14jähriger Junge aus seinem Vaterhause gegangen war, um Trompeter in einem französischen Karabinierregiment zu werden, preist die gute Aufnahme, die er und einer seiner Kameraden in der Familie eines Weimarer Professors gefunden. Während sich der junge Schehl von dem alten Herrn Vorlesungen über die Geographie Russlands halten ließ, trieb der Kamerad noch interessantere Studien mit der jungen hübschen Frau des Gelehrten, die ihn beim Abschiede zärtlich umhalste. »Ich habe die guten Leute nicht wieder gesehen«, setzt der Schreiber schelmisch hinzu, »denn ich kam auf meiner Rückreise nicht durch Weimar. Sonst würde ich sicher nicht unterlassen haben, mich zu erkundigen, ob im Hausstande des Herrn Professors in mittelst nicht eine kleine Veränderung eingetreten sei«.
Auch v. Roos wird nicht müde, die Gastlichkeit der Sachsen zu rühmen: »Wie oft erwärmten sie unsere von langen Märschen bei ungünstiger Witterung erstarrten und durchnässten Körper, indem sie uns beim Eintritt in ihre Wohnungen mit heißem Kaffee, Pfeifen und Tabak freundlich begrüßten.
Ebenso waren sie beim Abmarsch verschwenderisch mit Glückwünschen und so freigebig, dass sie immer unsere Schnapsflaschen füllten, Braten, Butterbrot und ähnliches auf den Weg einwickelten und mitgaben. Hatte man sich sonst gut aufgeführt, so erfolgten noch Freundschaftstränen und Küsse beim Abschied, oft auch Begleitungen bis zur nächsten Stadt«.
Das Bild änderte sich stark in Preußen. Hier blieb das Volk stumm und schweigsam. »In Pommern wehte eine so entschieden altpreußische Luft, dass die Rheinbündler eine gewisse Beklemmung nicht zu unterdrücken vermochten«. Gedanken an alte Zwistigkeiten lebten wieder auf, an die Zeit von 1806, wo die Sachsen und Weimaraner die preußischen Fahnen verlassen hatten. Das löste eigentümliche Stimmungen aus; ein Leutnant v. Schweinitz, vom Regiment der Herzoge zu Sachsen, wollte in Stettin nicht über den Friedrichsplatz gehen, wo das Standbild Friedrichs des Großen steht: »Ich mag an dem alten Fritze nicht vorbeigehen, er sieht mich so strafend an, als wenn er sagen wollte: »Hundsfott, wie kommst du hierher!« Den Württembergern wurde verübelt, dass sie 1807 während des Abzuges aus Preußen in den Marken arg gehaust hatten. Leutnant v. Martens schreibt darüber: »Der Schulze dieses Dorfes (einer Ortschaft in der Mark), bei welchem ich mich einquartierte, machte sich mit Schimpfreden über die Württemberger Luft. Sie hätten sich vor fünf Jahren in dieser Gegend so schlecht aufgeführt, dass sie in keinem guten Andenken bei ihm ständen. Er hätte Reiter im Quartier gehabt, deren Sporrädchen seine Kinder während dem Essen unter dem Tische treiben mussten, und seine Frau hatte mit der Schere die Nudeln abzuschneiden, die beim Essen über den Löffeln der Reiter herunterhingen usw. Auf meine Versicherung, dass wir nicht so übermütig wären und ein solches rohes Benehmen sehr missbilligten, auch mit allem zufrieden sein würden, was uns dargereicht werden könne, war dieser alte Mann besänftigt und sorgte für mich und meine Leute, so gut er konnte.«
Auch düstere Prophezeiungen wurden den durchziehenden Fremdlingen entgegengerufen. »Ihr seid euer viel«, sagte ein Prediger hinter der Oder zu den bei ihm einquartierten Schwaben, »ihr werdet im Anfang siegreich sein. Die Russen werden euch in das Mark ihres großen Reiches hineinlassen. Mittlerweile werdet ihr schwächer und werdet dann mit Frost und Mangel zu kämpfen haben. Dann erst fangen die Russen den Krieg mit vollem Ernste an; ihr werdet Mühe haben herauszukommen, und wenige werden zurückkehren«.
Bei den späteren Nachschüben zur großen Armee kam es in Ostpreußen schon zu offenen Feindseligkeiten zwischen den Durchmarschierenden und den Landesbewohnern. Anfälle wurden auf einzelne Soldaten gemacht, und der Kommandeur des Frankfurter Regiments, Major Horadam, dachte an die spanischen Verhältnisse, wenn er schrieb: »Hier fehlen nur die Berge, um Guerillas zu schaffen«. Auch in dieser Hinsicht warfen die Ereignisse ihre Schatten voraus. In verstärktem Maße sollten sich die Ausbrüche dieses Hasses wiederholen, als die Überbleibsel des gegenwärtig noch in stolzer Pracht einher ziehenden Riesenheeres im Dezember desselben Jahres verhungert und erfroren durch die preußischen Dörfer und Städte schlichen.
Übrigens verleugnete sich jetzt wie später das landsmannschaftliche Gefühl nicht ganz: der Groll der Bevölkerung richtete sich vorwiegend gegen die Welschen, und nur Leute, die keine Unterschiede machen konnten oder wollten, dehnten ihre Abneigung auf alle aus. Martens erzählt, dass ein ostpreußischer Gutsbesitzer in der Gilgenburger Gegend die Offiziere seines Bataillons freigebig bewirtet habe, mit dem Zusatz: »Sein Franzosenhass kam uns zu gut«.
Ein vornehmlicher Grund dieses Hasses der preußischen Bevölkerung lag in der Verarmung des Landes, das nun zum zweiten Mal innerhalb von fünf Jahren große Heere zu ernähren hatte. In manchen Gegenden war die Not so groß, dass viele Einwohner ihre Häuser verließen und gutmütige Offiziere mit den Ausgeplünderten die eigenen schmalen Vorräte teilten. Schon jetzt also, wo der Heerwurm das feindliche Land noch nicht einmal erreicht hatte, begann das bleiche Gespenst des Hungers in den Reihen umzugehen.
Ungleich schlimmer noch als in Preußen lagen die Verhältnisse in Polen, dessen Grenzen ein großer Teil der Armee zuerst in der Posener Gegend überschritt, um, nachdem er durch die heutige Provinz gleichen Namens gezogen, in Ostpreußen noch einmal den deutschen Boden zu berühren, der trotz der Antipathien seiner Bewohner den meisten als das letzte Stück der Heimat erschien. Die im Polnischen gemachten Erfahrungen lassen dies Gefühl als sehr berechtigt erscheinen, selbst bei den Sachsen, die das damalige Großherzogtum Warschau,1 das unter ihrem Könige stand, in besonderem Sinne als einen befreundeten Staat betrachten durften.
Gleich der erste Eindruck des Landes war ein trauriger gewesen. Major v. Lossberg schreibt am 17. April an seine Frau: »Schon am ersten Marschtage von Fraustadt aus und nachdem wir einige Dörfer passiert hatten, erzeugten diese und die den Augen sich von fern darstellenden Sandsteppen und Kiefernwälder einen Eindruck auf die Gemüter unserer jüngeren Soldaten, der ganz dem entgegengesetzt war, welchen die Kinder Israels empfanden, als sie das Land Kanaan erblickten, und ich kann sagen, dass von dem Augenblick an Scherz und Gesang im Regimente (in der ganzen westfälischen Armee wurde diese Bemerkung gemacht) verstummte.« »Sauland! Schweinepolen!« wetterte der Hauptmann v. Offterdinger, ein kernfester Schwabe vom Infanterieregiment Kronprinz, der mit seinem romantischen Namensvetter bei Novalis nichts gemein hatte, als er auf pfadlosem Marsche mit seiner Kompagnie in das unwirtliche Land hineindrang.
Alle Häuser starrten von Schmutz und Ungeziefer: Flöhen, Wanzen, Läusen und Kakerlaken. »Ein Schwein deutschen Ursprungs«, sagt v. Lossberg drastisch, »würde das Innere eines polnischen Wohnhauses nicht betreten.« Auch die deutschen Soldaten suchten sich dem Aufenthalt an diesen ungastlichen Stätten nach Möglichkeit zu entziehen und schliefen lieber in den Scheunen als in den rauchigen Hütten der polnischen Bauern, in denen Bett- und Leinenzeug fehlten und das Federvieh in den Ecken umherkroch.
Die poetische Seite des Kriegslebens, die den Soldaten ergötzt und erheitert, fehlte hier fast ganz. Nur auf den Edelhöfen, wo die Offiziere einquartiert lagen, zeigte sich eine höhere Gesittung, freilich auch diese in seltsamer Vermischung mit slavischer Unkultur, wovon wir gleich ein Beispiel hören werden.
Der polnische Adel war Napoleon günstig, zumal im Anfang des Feldzugs, als man eine Wiederherstellung Großpolens von seiner Allmacht erwartete. Wie im November von 1806 ward ihm in Posen ein glänzender Empfang bereitet, wobei die Damen den interessanten Mann umdrängten. Er hatte keine Muße, sich mit ihnen abzugeben; etwas mehr sein Bruder Jérôme. Als dieser im Juli einen folgenschweren Fehler beging, indem er nämlich zu spät kam, um die zweite russische Westarmee unter dem Fürsten Bagration abzuschneiden, wurde im westfälischen Korps getuschelt, dass er sich in Warschau und Grodno mit den liebenswürdigen Polinnen die Zeit zu gut vertrieben habe.
Die Begeisterung der polnischen Damen für die Sache des Kaisers hat sich auf manchen seiner Offiziere übertragen, die auf den Gütern im Allgemeinen gute, oft sogar sehr herzliche Aufnahme fanden. Allerdings stimmen auch hierüber die Angaben nicht völlig überein, doch scheinen einzelne Ausnahmen die Kegel zu bestätigen. »Von der Gastfreundschaft, mit der man uns entgegenkam«, sagt v. Brandt, »hat man keine Vorstellung. Die militärische Jugend bewunderte die junonischen Gestalten der Edelfrauen, die sich freilich nicht genierten, in Gegenwart der fremden Gäste ihren Kindern die Flöhe abzufangen«. Auch der bayrische Offizier v. Tavel-Mutach, ein geborener Schweizer, verlebte auf einem polnischen Schlosse am Njemen, wo er später als Verwundeter einkehrte, schöne Stunden. Die Töchter des Hauses kürzten ihm und seinen Kameraden in liebenswürdigerweise die Zeit; die alte Großmutter, eine würdige Matrone, ließ ihn in der Abschiedsstunde niederknien und erteilte dem Scheidenden feierlich ihren Segen.
Hier und da kam selbst das romantische Rittertum zur Geltung. Ein Adjutant des Generals Thielmann rettete während seines Aufenthalts auf dem Gute eines Grafen Lubinski dessen reizende Gemahlin und deren Töchterchen aus dem Schlossteich. Die Handlung endete mit einer Rührscene, die Freiherr v, Leysser, der Oberst der sächsischen Garde du Corps, in seinen nachher in der Gefangenschaft zu Saratow geschriebenen »Briefen von den Ufern der Wolga« mit der Gefühlsseligkeit eines Schriftsteilers der Werther- und Siegwartperiode vorgetragen hat. General v. Thielmann selbst wurde einmal der Gegenstand einer für ihn mehr ärgerlichen als erfreulichen Ovation, indem ihn die Polen nach ihrer Landessitte vor den Augen seiner erstaunten Sachsen auf den Armen herumtrugen und dabei von Zeit zu Zeit in die Luft schnellten.
Solche halb sentimentalen, halb burlesken Szenen heben sich von einem düsteren Hintergrunde ab. Schon zur Zeit des Einmarsches ins Posensche war das große Heer in einer Lage, die zu ernsten Befürchtungen für die Zukunft berechtigte. Der Mangel, der im Preußischen herrschte, machte sicherst recht in Polen fühlbar. In Litauen, an der Düna, überall wird es dasselbe sein, bis im Innern Russlands dieser Mangel zur grässlichsten Hungersnot anwächst, die im Verein mit Strapazen, glühender Sommerhitze und grimmiger Winterkälte das glänzendste Heer, das die Welt gesehen, aufreiben wird. Es dürfte daher schon an dieser Stelle erlaubt sein, ein Wort über die Ursachen einzuflechten, die ein so beispielloses Ergebnis zur Folge hatten, das dem russischen Feldzug unter den Feldzügen der Weltgeschichte eine Sonderstellung anweist.
Ins Gebiet einer längst als solcher erkannten Legende gehört die Behauptung, dass der große Feldherr, von seinen bisherigen Erfolgen verblendet, ohne Vorsicht und Umsicht in die großartigste Unternehmung seines Lebens eingetreten sei. Wenn er, seiner Gewohnheit entsprechend, den Operationsplan nur in allgemeinen Zügen festgelegt hatte, um die Einzelheiten den sich entwickelnden Verhältnissen zu überlassen, die sein Genius, wie selten der eines Menschen zu beherrschen und benutzen wusste, so hatte er doch den Verpflegungsschwierigkeiten, die sich ihm auf dem Wege bieten mussten, die eingehendste Beachtung zuteilwerden lassen.
Ungeheure Transporte wurden dem Heere nachgefahren, zum Teil von Ochsen, die nicht nur als Zugtiere, sondern später auch als Schlachtvieh dienen sollten. Für die Tage der Not führten die Soldaten eiserne Portionen mit sich. Große Magazine wurden angelegt; die Wasserstraßen, die Weichsel, der Njemen und die Düna, sollten benutzt werden, sie zu füllen. Man staunt, wenn man über die Vorbereitungen liest und doch weiß, wie vollständig das ganze Unternehmen gescheitert ist. Zu wohlfeilem Tadel ist ja hier Gelegenheit genug, und erst unlängst hat ein Militärschriftsteller bestimmt versichert, dass sich in einem Kriege zwischen Deutschland und dem russischen Reiche der Fall nicht wiederholen würde. Wir wollen das hoffen; aber auch im Falle vollständigen Gelingens würden hieraus noch nicht ohne weiteres für Napoleon ungünstige Rückschlüsse gezogen werden dürfen.
Es ist die Tragik des Genies, dass es, Raum und Zeit überspringend, sich an Probleme der Zukunft wagt, die die Gegenwart zu lösen nicht imstande ist. Und die damalige Zeit war nicht imstande, das Problem der Eroberung Russlands, selbst einer teilweisen und vorübergehenden Eroberung, auf dem von Napoleon angestrebten Wege zu erreichen: die Zeit, in der es keine Telegraphie, keine Ballons, Eisenbahnen, Kraftwagen und Fahrräder gab, tausend anderer technischen Hilfsmittel nicht zu gedenken, welche Wissenschaft und Erfahrung inzwischen in den Dienst des Strategen gestellt haben.
Dabei muss zugegeben werden, dass auch bei weitem nicht alles erreicht worden ist, was bei den damaligen Hilfsmitteln hätte erreicht werden können. Die französische Verwaltung war nichts weniger als einwandfrei. Wie die aller romanischen Länder hat sie sich niemals durch saubere Redlichkeit ausgezeichnet und war in den letzten Jahren der Republik vollends verdorben. Auch Bonapartes glänzendem Ordnungsgenie war es nicht gelungen, die Schäden dieser Administration zu beseitigen. Vieles lag im Volkscharakter: Unpünktlichkeit neben schematischem Formalismus. Beide mussten mit der Größe des Reiches und der Ausdehnung der Kriege wachsen. Man gehorchte dem Buchstaben der Befehle, um hinter dem Rücken des kaiserlichen Befehlsgebers die gröbsten Unterschleife zu begehen. Während beispielsweise die französischen Regimenter infolge des Zusammenhaltens gewissenloser Armeebeamten mit trügerischen Lieferanten schlechtes Schuhwerk erhielten, das nach kurzer Zeit den Leuten von den Füßen fiel, ließen, wie wir hören werden, auf dem Rückzug die Magazinverwalter in Smolensk und Wilna die hungernden Soldaten vor den Türen sterben, wenn sie nicht ganz ordnungsmäßige Befehle ihrer Truppenführer zum Empfang von Lebensmitteln aufzuweisen vermochten.
Schon in dieser ersten Phase des Feldzugs zeigten sich die Vorboten kommenden Verhängnisses. Dass die Deutschen in mancher Beziehung hierunter noch mehr als die eigentlichen Franzosen litten, brachte ihre Stellung als Hilfstruppen in einem großen Heeresverbände mit sich, dessen Spitzen einem fremden Volke angehörten, das von der Höhe seines Nationalstolzes und im Gefühl errungener Erfolge auf die im Grunde doch nur als minderwertige Gehilfen eingeschätzten »Bundesgenossen« herabschaute, denen man überdies vielfach misstraute. Auch von Seiten der französischen Abteilungsführer geschah das nicht selten. Bitter beklagen sich z. B. die sächsischen Offiziere der Brigade Thielmann darüber, dass Oberst Serrion, der Generalstabschef des 4. Reiterkorps, den Korpskommandeur Latour-Maubourg gegen ihre Landsleute eingenommen habe, bis beide einander näher kennen lernten und von nun an ein auf gegenseitiger Achtung gegründetes Verhältnis zwischen dem General und den ihm unterstellten Sachsen eintrat. Wir werden ähnlichen Zügen noch oft begegnen.
Besonders unfreundlich aber waren die Beziehungen zwischen der französischen Intendantur und den Angehörigen der fremden Truppenteile. Suckow, ein allerdings etwas abgünstiger Beurteiler der Franzosen, berichtet darüber aus der Zeit seines Aufenthalts in Posen: »Man muss mit den Franzosen gelebt haben, um sich von der Arroganz jener Mehlwürmer, wie man diese commissaires ordonnateurs usw. in der Armee spottweise nannte, gegenüber ihren deutschen Verbündeten eine Idee zu machen. Jeden Laib Brot, jedes Pfund Fleisch musste man bei den Fassungen dieser Lebensbedürfnisse aus den französischen Magazinen erstreiten, ja, mitunter fast buchstäblich erkämpfen«.
Die von Suckow gerügte Kargheit hing mit einem weiteren Fehler der französischen Verwaltung zusammen, die im Bestreben, die hinteren Magazine immer gefüllt zu halten — die doch zu guter Letzt den Russen in die Hände fielen — mit der Verausgabung von Vorräten an die weiterziehenden Truppen äußerst sparsam war. Diese waren daher — und auch infolge ihrer Eilmärsche — auf Requisitionen angewiesen. Aber das in den früheren Kriegszügen, am Rhein, in Thüringen, in Österreich, erfolgreich angewandte Requisitionssystem musste in den schlechtangebauten Ländern des Ostens mit ihrer dünnen und der eindringenden Armee gegenüber größtenteils sehr übelgesinnten Bevölkerung versagen. Die Offiziere halfen sich, solange sie Geld hatten, bei den schachernden Juden und den Marketendern durch, die ihnen einige Lebensmittel teuer verkauften. In den jüdischen Wirtschaften war auch bisweilen ein erträgliches Bett zu finden, eine Wohltat, die bald ein unbekannter Genuss werden sollte.
Im Übrigen wurde requiriert, mit aller Rücksichtslosigkeit, die dieses Verfahren mit sich brachte. Schon in dem befreundeten Polen hat das begonnen. Nächst der politischen Zurückhaltung, die Napoleon den polnischen Wünschen gegenüber zeigte,2 hat gerade diese schonungslose Ausbeutung des Landes viel dazu beigetragen, die Sympathien der Polen abzukühlen.
Noch ein besonderer Umstand trat hinzu, um die Lage zu verschlimmern: eine Missernte, die infolge Futtermangels in vielen Gegenden Polens den Viehstand verringert hatte. Ein bayrischer Offizier erzählt, dass er in der Plozker Gegend ganze Ställe voll verhungerter Rinder und Schweine getroffen habe.
Was noch übrig war, wurde den Leuten abgenommen — in Güte oder mit Gewalt. Heinrich v. Brandt besuchte auf dem Durchmarsch seine Eltern, die in Strzelnow im Posenschen ein Gut besaßen: »Die Meinen empfingen mich mit Tränen«. »Du kommst heute in das Haus eines Bettlers,« sagte ihm sein Vater. Der bayrische Hauptmann v. Gravenreuth suchte eine adelige Familie auf, mit der er aus dem Feldzuge von 1807 her bekannt war. Er kam gerade recht, um zu verhindern, dass man seinen Freunden die letzte Kuh aus dem Stalle trieb. Die Führer der Requisitionskommandos, die sich selbst in oft nicht minder peinlicher Lage befanden als die von den Beitreibungen Betroffenen, hielten sich schließlich für entschuldigt, wenn nur alles nach Befehl und Vorschrift ausgeführt wurde.
Natürlich wurden bei steigender Not auch alle »Vorschriften« bald außer Acht gelassen, und ein allgemeines Plünderungssystem riss ein, bei dem jegliche Schonung aufhörte. »Die verschiedenen Nationen halten hierbei gleichen Schritt,« klagte ein polnischer Offizier seinem deutschen Kameraden Brandt, »Franzosen, Italiener, Württemberger, Badener, Bayern, ja, selbst Polen sind hierin völlig gleich.« Napoleon war entrüstet, und, wie nach Lage der Sache natürlich, blieben vor allem die Bundesgenossen vom seinem Tadel nicht verschont, zumal die Württemberger, deren Führer er mit den bittersten Vorwürfen überschüttete. Schon vor dem Überschreiten der russischen Grenze war zwischen dem Generalstabschef Berthier und dem württembergischen Kronprinzen ein unangenehmer Briefwechsel geführt worden, und der Kaiser selbst hatte bei einer Begegnung den Prinzen hart angelassen. Hiermit hing auch die Enthebung zweier württembergischer Generale von ihren Kommandos zusammen. Anlass zu diesen Maßregeln oder wenigstens einen Vorwand dazu boten die Ausschreitungen, über die sich der Kaiser als oberster Kriegsherr heftig beklagte. Ganz unbegründet waren diese Klagen nicht, und auch wenn man, wie es hier geschehen, die Notlage zugibt, so kann nicht in Abrede gestellt werden, dass in verschiedenen württembergischen Regimentern von vornherein die Disziplin keine besonders gute war. Der Kronprinz selbst hat das in einem Schreiben, das er am 3. Juli an seinen Vater richtet, ziemlich offen zugegeben. Es heißt darin: »Was die Exzesse dieser (Reiter-)Regimenter, über die so sehr geklagt wird, betrifft, so sind mir, solange dieselben unmittelbar unter meinem Kommando gestanden sind, keine zur Anzeige gebracht worden, die ich nicht sogleich mit gebührender Strenge bestraft hätte.
Ein Beweis davon ist der Major v. Seebach, den ich wegen seines brutalen, überall Klagen veranlassenden Benehmens von dem Regiment entfernt und Eurer Majestät gemeldet habe. Getrennt von dem übrigen Armeekorps, mögen diese Regimenter, die in Schlesien sich ganz eigene Begriffe vom Feldleben gemacht haben, sich ihrem Hang zu Ausschweifungen umso mehr überlassen haben, als sie für ihre Verpflegung selbst zu sorgen hatten. Im allgemeinen habe ich ohnehin bemerken müssen, dass bei einigen dieser Regimenter keine rechte Autorität von oben herab gehandhabt wird, dass zwischen Untergebenen und Vorgesetzten viel zu große Familiarität und kameradschaftlicher Ton herrscht und gleichsam hergebracht ist«, Wirklich waren verfängliche Redensarten höherer und niederer Offiziere des schwäbischen Kontingents laut geworden, und Napoleon hatte durch Zwischenträger davon erfahren. Man hatte tüchtig auf den Kaiser geschimpft, besonders, weil er die württembergischen Truppen auseinandergerissen und das Reiterregiment Herzog Louis von den übrigen vollständig getrennt hatte.
Dieses willkürliche Schalten erregte auch bei den übrigen deutschen Truppenkörpern, die davon betroffen wurden, viel Verdruss, und nur der sächsische General Thielmann, ein äußerst ehrgeiziger Charakter, hatte eine Auszeichnung darin gesehen, dass ihn der Kaiser mit seiner Brigade von den Sachsen fort und mit in die erste Linie nahm; ja, er soll diese Versetzung selbst eifrig betrieben haben. Die andern dachten hierin anders, und der Deutsche blieb in dem bunt zusammengesetzten Heere, in dem ein babylonisches Sprachengewirr herrschte, naturgemäß am liebsten mit seinen Landsleuten zusammen.
Inzwischen war das Heer am Njemen angelangt, in einer fächerförmigen Aufstellung. Die linke Hauptkolonne unter Napoleons eigener Führung stand bei Kowno; etwas südlich davon mehrere Armeekorps unter Eugen Beauharnais; noch weiter südlich, gleichfalls mit starker Macht, des Kaisers Bruder Jérôme. Der Schutz der linken Flanke war dem zum Einrücken in Kurland bestimmten 10. Armeekorps (Macdonald) anvertraut, der der rechten einem österreichischen Hilfskorps unter Schwarzenberg. Napoleons Absicht ging dahin, durch einen Marsch auf Wilna zwischen die ihm gegenüberstehenden beiden russischen Westarmeen einen Keil zu treiben. Von diesen befand sich die eine, unter Barclay de Tolly, zurzeit im nördlichen Litauen, die andere, schon einmal erwähnte, unter Bagration, weiter südlich. Von der französischen Hauptkolonne wurde bald darauf ein Teil unter Davout abgezweigt, um Bagration entgegenzugehen, den ihm nach Napoleons Plan von Süden her Jérôme in die Arme treiben sollte. Der Vizekönig sollte diese auf Einschließung des Gegners abzielende Bewegung unterstützen. Aber der kaiserliche Bruder zeigte sich, wie hier nochmals mit Betonung gesagt werden muss, der ihm gestellten Aufgabe nicht gewachsen. Zum Teil mag vielleicht die Schuld Napoleon selbst zuzuschreiben sein, der sich nicht mehr wie in früheren Jahren von allen Vorgängen durch den Augenschein überzeugte und sich persönlich zu lange in Wilna aufgehalten hat, wo ihn freilich allerlei Geschäfte fesselten. Auch waren die Entfernungen und dadurch die Unübersichtlichkeit des Schauplatzes größer als in irgendeinem der bisher von ihm geführten Kriege. Sei dem, wie ihm wolle: genug, Bagration wird entwischen, und indem sich auch Barclay zurückzieht, wird es Napoleon nicht möglich, einen von beiden zu fassen. So kommt sein Plan zum Scheitern, und der erste Akt des großen Dramas findet einen für ihn und alle, die mit ihm waren, unbefriedigenden Abschluss.
Die Eröffnungsscene war pompös gewesen, der Übergang über den Njemen, der in der letzten Juniwoche erfolgte. In den Zeitungen der Epoche wird er aufs glänzendste geschildert. Mit einem »Lavastrom«, einer »wandelnden Zitadelle« werden die gepanzerten Reiterzüge verglichen, die in unabsehbarer Länge über die Brücken bei Kowno zogen, der damals ersten der russischen Städte, dem »kleinen schmutzigen Nest«, wie es Heinrich v. Brandt nannte, »das schon so viele Schicksale erlebt hatte.« Selbst die »vorweltlichen Riesentiere« mussten zum Vergleich für die Journalisten herhalten. Aus der Ferne gesehen, schieben sich die Kulissen ineinander, und die Einzelheiten entschwinden dem Blicke.
Diese Einzelheiten waren freilich für die Beteiligten nicht alle so reizvoll, wie die Zeitungsschreiber behaupteten und bildliche Darstellungen es Verwandten und Freunden in der Heimat übermittelten. »Ich habe mehrere Bilder gesehen«, schreibt v. Brandt, »welche den Übergang über den Njemen darstellen. Hätte man die damit verknüpfte Unordnung zugleich wiedergeben können, so wären dieselben für die Geschichte gewiss belehrender gewesen. Das Durcheinander dort war unglaublich. Alles wogte der Brücke zu, jeder wollte der erste werden, jeder seine Equipage mitnehmen. Gendarmen taten Einspruch — Ungehorsam, Widersetzlichkeit offenbarte sich. Dies war namentlich der Fall, wenn geschlossene Truppenteile ihren Übergang bereits vollbracht hatten und dann deren Bagagen folgen sollten. Dies wollten dann meistens die Artillerieparks, welche ihre Offiziere an der Brücke hatten, nicht leiden, und dann ging es an ein Zanken und Streiten, in welchem in der Regel der den Vorrang erhielt, der seine Mannschaft und Fahrzeuge zuerst in Bereitschaft hatte.«
Zudem hatte sich während des Überganges ein Gewitter entladen,3 unter heftigem Donner, in dessen Rollen der Aberglaube die Mahnrufe einer überirdischen Stimme hören wollte. Der preußische Fragmenteschreiber, der mit dem 1. Reiterkorps über den Fluss ging, bemerkt darüber: »Als das Kavalleriekorps zum Abmarsche bereit stand und die Besichtigung des Kaisers, der sich in der Nähe befand, erwartete, um dann den ferneren Marsch anzutreten, wurde beides durch den Ausbruch eines Gewitters, das sich unbemerkt während der Beschäftigung zum Übergang zusammengezogen hatte, augenblicklich verhindert. Der Donner krachte, und der Regen fiel in Strömen herab. Eilig hüllte sich jeder in seinen Mantel und erwartete duldend das Ende des Unwetters. Ein so zufälliges Zusammentreffen mit der ersten entscheidenden Unternehmung des Krieges erregte den Aberglauben des gemeinen Mannes und ließ die Höheren nicht unberührt. Durch die Reihen liefen die Worte: ‚Das ist ein schlechtes Zeichen! es werden wenige zurückkehren!‘ und dergl. mehr, welche Äußerungen den allgemeinen Eindruck erkennen lassen. Diese Stimmung wurde durch die Trompeterchöre der französischen Kürassiere, welche, dem Sturm trotzend, die muntersten Weisen und Fanfaren schmetterten, passend unterbrochen. Selten kann, hinsichtlich der Wirkung, von der kriegerischen Musik eine vorteilhaftere Anwendung gemacht werden«.
Neben dem Fanfarengeschmetter war es der Anblick der gewaltigen Heeresmassen,4 der das Gleichgewicht in der Seele des Kriegers wiederherstellte. Imposanter fast noch als bei Tage erschien dieses Heer zur Nachtzeit, die die Dinge vergrößert und alles in noch weiteren Dimensionen erscheinen lässt. »Die Tausende der die Gegend erhellenden Lagerfeuer«, schreibt ein Augenzeuge, »machten in der dunklen Nacht einen noch mächtigeren Eindruck als der Anblick des Heeres bei Tage. Man sieht am Tage alles, während die Nacht nur einzelne Punkte zeigt und der Phantasie einen weiten Spielraum lässt. Dazu kam die lärmende Geschäftigkeit des Lagers, die Fröhlichkeit der Soldaten, das Stampfen und Wiehern mutiger Rosse, die Hoffnung auf Sieg, Ehre und Lohn im nahen Kampfe«.
So zog man denn nach Litauen hinein, in ein wüstes, waldiges Land, noch unwirtlicher als Polen, in dem sich die bisherigen Mühsale unaufhörlich steigern und nach und nach bis zur Unerträglichkeit anwachsen sollten. Die Verpflegungsschwierigkeiten erhöhten sich durch Eilmärsche, die von den Magazinen immer weiter entfernten und zudem durch das Stocken der Kolonnen auf den Wegen Ungemach aller Art, Stoßen und Drängen, Fallen der Pferde und rohes Überfahren der Ermüdeten im Gefolge hatten. Hierzu traten ungünstige Witterungsverhältnisse, die die Märsche außerordentlich erschwerten und den Ausbruch gefährlicher Krankheiten nach sich zogen, die durch faules Wasser und schlechte Nahrung noch befördert wurden. Dem beim Übergang über den Njemen erwähnten Unwetter waren weitere starke Niederschläge gefolgt, die streckenweise in einen Landregen aus? arteten, der die ohnehin sehr schlechten Pfade — »bestimmte Wege gibt es in Litauen nicht«, sagt v. Wedel charakteristisch — völlig grundlos machten.
Wir geben im Folgenden dem Leutnant v. Martens das Wort, aus dessen genau mit den Daten geführtem Tagebuch bezeichnende Stellen angeführt werden, zu denen sich Ergänzungen aus an dem mit Leichtigkeit bieten werden. »Bis Janowo,«5 heißt es dort, »hatten wir drückende Hitze und einen unerträglichen Staub zu bestehen. Nachmittags rollte der Donner mit mächtigen Schlägen, und ein Gewitterregen durchnässte uns bis auf die Haut«. Am 28. Juni »hielt der Regen an, und das erste Geschäft dieses Morgens war Barackenbau; die Strapazen dieser und der nachfolgen;: den Tage legten den Grund zu den nicht ausbleibenden Krankheiten, Ruhr und Nervenfieber, die nur zu bald unaufhörlich in unseren Reihen wüteten und solche bei weitem mehr lichteten als das feindliche Geschoss.« Am 29. Juni dauerte der Regen fort und »versetzte uns in die traurigste Lage«. »Im Sturm und Regen«, heißt es am 30., »verließen wir in aller Frühe unser Sumpflager«. Auch am 1. Juli »blieben wieder Menschen und Pferde im Kot liegen«. Am 3. belebte »die wiedererscheinende Sonne die tiefgesunkenen Kräfte, aber die Ruhr griff immer weiter um sich, und mehrere hundert Kranke mussten in dem zu Maliaty eiligst errichteten Feldspital untergebracht werden.«
In dieser Weise geht es weiter. Am 6. Juli entlud sich ein neues Gewitter; am 9. ist wieder »drückend schwüle Hitze«, der abermals furchtbare Güsse folgen. Die Witterung bleibt noch ein paar Tage »abscheulich«. Schon sterben Soldaten vor Schwäche: Der Kronprinz von Württemberg meldet seinem Vater, dass in der Zeit vom 15. — 29. Juli 21 Mann in den Biwaks an Entkräftung verschieden sind.
Der Prinz konnte diesen Bericht nicht mehr unterzeichnen. Er selbst war von der herrschenden Krankheit (der Ruhr) ergriffen und musste nach Wilna und von dort in sein Heimatland zurückgeschafft werden. Auch der General v, Scheler, der nachher an seiner Statt die 25. Infanteriedivision kommandierte, ein Oheim v. Martens‘, war wie dieser schwer erkrankt; Neffe und Onkel wären beinahe der ekelhaften Krankheit erlegen. Letzterer schreibt am 18. Juli: »Man roch nichts als Pfefferminze und Hofmännische Tropfen im Lager, deren starker Geruch uns wie Leichendunst in die Nase stieg«. Das waren die Mittel, die die damalige Medizin dem tückischen Leiden entgegenzusetzen hatte. Regimentsarzt Roos und seine Kollegen wanderten in den Städten, durch die sie kamen, von einem Apothekerladen zum andern, um die lebenspendenden Tropfen aufzutreiben.
Wie bei den Schwaben so bei den Bayern. »Von Lyck (in Ostpreußen) bis Olitta mehrt sich das Elend mit jedem Schritt«, schreibt der Unterapotheker Grasmann in sein Journal. Am 8. Juli meldet er einen Krankenbestand von 129 Mann, der am folgenden Tage auf 200 und am 13. auf 345 Mann gewachsen ist. Auch er klagt über den Mangel an Medikamenten.
Unter diesen Umständen wird es erklärlich, dass schon jetzt in der Armee, auch bei den deutschen Kontingenten, trotz immer wiederholter Verbote zahlreiche Mannschaften zurückblieben. Nicht nur die Kranken und Sterbenden, sondern auch Marodeure, die plünderten, stahlen, raubten, das Land unsicher machten und dessen Bewohner gegen die Franzosen und ihre Verbündeten aufbrachten. Das war umso bedenklicher, als die Stimmung des litauischen Volkes für die weiteren Schicksale des Heeres von großer Bedeutung werden sollte.
Der Litauer ist ein kalter Schlag, der sich für den hohen Ton der napoleonischen Proklamationen weniger empfänglich zeigte als der leichter entzündliche Pole. Die vornehme Welt machte ja in Wilna dem fremden Imperator ihre Aufwartung, und der — größtenteils polnische — Adel des Landes, der sich gleichfalls in Träumen einer Wiederherstellung des alten Jagellonenreiches wiegte, stellte ihm seine Dienste zur Verfügung, Er hat im Ganzen die Treue gehalten, und gar mancher polnisch-litauische Edelmann hat noch in den letzten schweren Wochen mit Aufopferung seines Lebens dem aufgelösten Heere als Kundschafter und Nachrichtenvermittler wichtige Hilfe geleistet.
Aber abkühlend hat auch in diesen Kreisen die politische Zurückhaltung Napoleons gewirkt, und der gemeine Mann, der von Politik keine Ahnung hatte, ergrimmte über die Verwüstung, die der über Litauen sich ergießende Heuschreckenschwarm weit und breit anrichtete. Schon bei Kowno waren Ortschaften völlig zerstört worden, wie wegrasiert durch die Soldaten, die das Gebälk der Häuser für ihre Lagerfeuer verbraucht hatten.
»Nirgends ein Bewohner!« klagt Brandt schon am 27. Juni, zwei Tage nach dem Übergang über den Njemen, »ein Dorf in unserer Nähe war fast ganz vom Boden verschwunden — die vor uns hier eingetroffenen Truppen hatten sich Biwaksbedürfnisse daraus geschaffen.« In vandalischer Weise wurde ein dem General v. Bennigsen gehöriges Schloss Zakred in der Nähe von Wilna verwüstet. Die Beispiele ließen sich häufen, aber sie würden zusammengenommen nur ein einförmiges Gesamtbild ergeben. Zudem wird noch später von ähnlichen Vorgängen oft genug die Rede sein.
Auch von den Requisitionskommandos wurden Land und Bewohner in übelster Weise misshandelt, schlimmer noch als im Großherzogtum Warschau. Dabei war der Ertrag dieser Requisitionen oft recht gering, und es trat die Erscheinung zutage, dass die Deutschen in der Beschaffung und Verteilung der herangeholten Vorräte viel ungeschickter verfuhren als die Franzosen, denen der Grundsatz, sich vom eroberten Lande ernähren zu lassen, seit den Rheinfeldzügen im Blute steckte.
Wenn aber unsere Landsleute in der Kunst des Requirierens zurückstanden, so waren die deutschen Reiter, ebenso wie die polnischen, den französischen in der Pflege der Pferde überlegen. Natürlich ist das mit Vorbehalt zu verstehen, und beispielsweise die Trainknechte aller Nationen pflegten mit den ihrer Obhut anvertrauten Gäulen in einer Weise umzugehen, deren Mitteilung ungläubigem Zweifel begegnen mag. Die Tiere hatten wie die Menschen von den übergroßen Anstrengungen zu leiden: dazu waren sie matt und entkräftet, infolge des nassen Grünfutters und des unreifen Getreides oder des faulen Dachstrohs, das sie zu fressen bekamen. Diese unzweckmäßige Fütterung erzeugte Verdauungsstörungen verschiedener Art: neben Durchfall und Abmagerung kam hartnäckige Verstopfung vor, die nach Aussage eines Rossarztes Diem u. a. durch Klistiere von »schlechtem Rauchtabak« bekämpft wurde. Ein Artillerieoffizier erzählt, dass seine Leute mit der ganzen Länge des Armes den Pferden in den After fahren mussten, um sie von den im Darm angehäuften Kotmassen zu befreien. Nach Roos hatte das Grünfutter eine Auftreibung der Leiber zur Folge, die man durch angestrengtes Laufen der Tiere manchmal beseitigen konnte. In vielen Fällen aber gingen diese ein. Hunderte von Pferden mit geplatzten Bäuchen sah der bayrische Stabsauditeur Stubenrauch schon an den Brücken von Pilony herumliegen. In der Nähe von Wilna, behauptet derselbe, waren es mehr als 1600: »Der Gestank war unerträglich«, das Biwak der Bayern bei Wilna infolge der mephitischen Dünste ganz grässlich.
Auf den Märschen brachen die Tiere zusammen. »In Gräben und Löchern«, sagt der Sachse Röder v. Bornsdorff, der mit dem Korps Davouts gegen Bagration zog, »liegen sie mit stierem brechendem Auge und versuchen kraftlos in die Höhe zu kommen. Aber der Versuch ist fruchtlos, und nur selten bringen sie einen Fuß auf die Straße, der dann ihren Zustand noch bejammernswürdiger macht. Gefühllos fahren Train- und Artillerie!-Soldaten mit dem Geschütz darüber weg, dass man das Bein zerknirschen, des Tieres dumpf brüllenden Schmerzenston hört und sieht, wie es, von Angst und Entsetzen getrieben, Kopf und Hals konvulsivisch hebt, mit ganzer Last zurückfällt und sogleich von zähem Schlamm begraben wird.«
Dabei bleibt bestehen, dass der deutsche Reiter in der Regel für seinen Gaul doch besser sorgte als der Franzose. »Le Français n‘est pas komme de chevah, pflegte Napoleon zu sagen, und der russische Feldzug hat dem großen Kapitän darin recht gegeben. Deutsche Tierfreunde konnten es oft nicht mit ansehen, mit welcher Leichtfertigkeit die Soldaten fremder Regimenter, die mit jenen in denselben Brigaden standen, ihre Pferde behandelten, und ein Kavallerist spricht seinen Ärger darüber aus, dass die Franzosen aus Nachlässigkeit die gedrückten Tiere, aus deren wunden Rücken der Eiter hervorquoll, auch wenn sich die Möglichkeit bot, des Abends im Lager nicht absattelten, um ihnen wenigstens für die Nacht eine Erleichterung ihrer Schmerzen zu gewähren.
Der bayrische Chevauleger, der auf dem Rückzuge zwischen der Beresina und Wilna sein Pferd nicht im Sumpfe versinken lassen wollte und als alle Anstrengungen, das kraftlose Geschöpf herauszuziehen, missglückten, zu ihm hinabsprang, um gemeinsam mit seiner »Liesel« zu sterben — er ist gewiss eine Ausnahme. Aber es wird doch kein Zufall sein, dass die Truppe, zu der dieser brave Mann gehörte, wie gemeldet wird, während des Feldzuges in dem von der französischen Armee stark vernachlässigten Aufklärungsdienste noch das Beste tat.
Auch bezeugt der bayrische Major Fürst Thurn und Taxis, dass bei einer am 14. Juli in Wilna von dem Kaiser selbst abgehaltenen Revue die Pferde seines Korps, auch die der Artillerie, in trefflichem Zustand, die Mannschaft von schöner Haltung und noch gut montiert gewesen sei.
»Es war daher natürlich, dass man sehr zufrieden war und mehrere aus Napoleons Umgebung sich äußerten, das 6. Korps sei schöner noch als die kaiserliche Garde«. »Doch seine Stunde hatte auch geschlagen«, fügt der Berichterstatter wehmütig hinzu.
Denn auch bei den Bayern machten sich die oben besprochenen Übel geltend. Das schlimmste von allen war das schon erwähnte Marodeurwesen, das in besorgniserregender Weise um sich griff und die Existenz der Armee auf die Dauer gefährden musste. Die bayrischen Feldzugsakten beweisen unwiderleglich, wie sehr die Generale Wrede und Deroy in ihren Divisionen gegen den immer mehr überhandnehmenden Unfug eiferten. Auch Napoleon selbst hatte, zuerst in Wilkowiczki, dann wieder in Wilna, die strengsten Maßregeln dagegen erlassen. Eine eigentliche Schuld an diesem Übel ist ihm also nur insofern beizumessen, als die ganze Art seiner Kriegführung, die auf Russlands Boden versagte, dem Nachzüglerwesen indirekt Vorschub leistete. An die 50 000 dieser Menschen sollen sich in Litauen vagabundierend herumgetrieben haben. »Viele sammelten sich in Banden,« sagt Wedel, »quartierten sich in Dörfer und Schlösser ein und stellten Vorposten aus, gegen Russen wie gegen Franzosen, welche gleichmäßig ihre Feinde waren.« Nachrückenden Abteilungen wurden sie nicht selten unbequem, einzeln von der Armee Zurückkehrenden vielfach gefährlich. Schonjetzt erwachte gegen diese schlimmste Plage die Volkswut in so hohem Grade, dass es — ein warnendes Vorzeichen kommender schrecklicher Ereignisse — »zur Gegenwehr und zu martervoller Ermordung der Gefangenen« kam. Auch die Kugeln der eigenen Kameraden streckten auf Befehl des Kaisers ganze Haufen dieses Gesindels zu Boden. Roos hat gesehen, dass sie vor der Hinrichtung ihre Gräber schaufeln mussten. Wie es bei solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, traf oft genug das Los die kleinen Diebe, während die großen ungehängt davonkamen. So ward ein bayrischer Chevauleger erschossen, ein sonst braver Soldat, der in Wilna eine Uhr genommen hatte. Nicht ohne Bitterkeit sagt Meerheim, der mit dem Korps Davouts gezogen, von den gegen die Marodeurs erlassenen strengen Befehlen, die man den versammelten Truppen an der später zu so düsterer Berühmtheit gelangenden Beresina vorlas: »Es musste uns unendlich überraschen, als gerade hier, in diesen grauenvollen Waldsümpfen, die allerhöchste Maßregel bekannt gemacht und im Angesicht des Korps auch zugleich die Kommission sofort zusammen berufen wurde, um in einer nahe gelegenen Hütte mit der ersten Session zu debütieren. Eindruck machte die Sache allerdings, aber schwerlich den gewünschten, denn nur ein wehmütiges Lächeln war auf den von Mangel und Beschwerden abgezehrten Gesichtern der Gemeinen zu bemerken«.
So hatten die große Armee und mit ihr die deutschen Truppenkörper schon erhebliche Einbuße erlitten, bevor sie eigentlich an den Feind gekommen waren. Denn im Ganzen hatten nur unbedeutende Gefechte mit den überall weichenden Russen in Litauen stattgefunden. Die erste Westarmee unter Barclay zog sich nach der Düna zurück, wo man einen Augenblick daran gedacht hat, ein nach dem Rat des Generals Phull, eines konfusen Theoretikers, angelegtes verschanztes Lager bei Drissa zu beziehen, dessen Unbrauchbarkeit sich bei näherer Untersuchung bald herausstellte. Doch war es vorher wenigstens einmal den deutschen Reitern vergönnt gewesen, sich mit der russischen Kavallerie zu messen. Am 5. Juli bei Kotschergischki an der Disna, einem der linken Zuflüsse der Düna. In dieser Affäre hatte sich das 2. preußische Husarenregiment derart hervorgetan, dass es im 6. Bulletin der großen Armee öffentlich belobt wurde und mehrere Ehrenlegionskreuze erhielt.
Das Lager von Drissa hatten die Franzosen unbesetzt gefunden. Man war auf einen schweren Kampfgefasst gewesen, und die Herzen hatten Montbruns Reitern höher geschlagen, als sie sich der größten Schanze des Lagers näherten. Fast komisch war die Enttäuschung. »Je näher wir kamen, desto stiller wurden alle; man hörte weder Waffengeklirr noch Räuspern noch Husten; kein Pferd wieherte; es war, als ob auch sie auf den Zehen gehen könnten. Mit jedem Augenblick glaubten wir aus dieser Verschanzung und ihren Metallschlünden begrüßt oder angedonnert zu werden, und stille rückten wir immer näher. Auf einmal schwand der Nebel vor unsern Augen; die Stille verwandelte sich in ein Gemurmel und dann in ein Gelächter; es war weder eine Kanone noch ein Soldat mehr in dem Koloß von Schanze. Ein Bäuerlein wandelte oben umher, das man früher für eine Schildwache gehalten hatte, und die ausgeschickten Patrouillen brachten bald die Nachricht, dass die Russen in der Frühe ihr Lager und diese Schanze verlassen hätten«.
Soweit die Worte von Roos, der bei dem Ereignis zugegen war. Man mag den braven Reitern eine Stunde fröhlichen Lachens wohl gönnen. Denn schon harrten ihrer neue Bedrängnisse. Barclay zog die Düna hinauf, um der geplanten Vereinigung mit dem Fürsten Bagration entgegenzustreben. In der Gegend von Urissa blieb nur eine russische Abteilung unter dem General Wittgenstein zurück, der zwei Korps der großen Armee, das 2. und bald darauf auch das 6. (bayrische) gegenübergestellt wurden. Da inzwischen auch im Süden ein Heeresteil — das 7. Korps, die Sachsen — von der Hauptarmee abgezweigt worden ist, um im Verein mit dem österreichischen Hilfskorps Schwarzenbergs das Großherzogtum Warschau zu decken und zugleich eine russische sogenannte Reserve-Armee unter dem General Tormassow im Schach zu halten, während gleichzeitig im Norden das in Kurland eingedrungene Korps Macdonalds gegen Riga vorgeht: so hat die Gesamtaufstellung der großen Armee die Gestalt eines Fächers angenommen, aus dem die Mitte hervorragt. Wir folgen einstweilen dieser Mitte, dem Hauptheer, das jetzt teils die Düna hinauf-, teils an sie heranzieht, den Russen nach, deren beide Westarmeen sich noch immer rückwärts zu vereinigen suchen.
Es gelingt Napoleon nicht, den immerfort weichenden Gegner festzuhalten, und erst nach weiteren vierzehn Tagen wird es bei Smolensk zwischen ihm und den inzwischen vereinigten Armeen seiner Gegner zu einer größeren Schlacht kommen, die auch die Fechte weise beider Teile charakteristisch hervortreten lässt. Eine Reihe von Einzelkämpfen, mehr kleinere Treffen als im eigentlichen Sinne sogenannte »Schlachten«, hat bis dahin doch stattgefunden. Von Seiten der Russen waren es Rückzugsgefechte, und nur einmal wird sich Barclay durch die in seinem Lager herrschende, dem steten Zurückgehen widerstrebende Stimmung zu einem Offensiv-Vorstoß bewegen lassen, der zu der für die Russen günstigen Affäre bei Inkowo führte. Trotz des glücklichen Ausgangs des Tages setzte er seinen Rückzug nach Smolensk weiter fort. Wir werden diese einzelnen Kämpfe nur insoweit zu betrachten haben, als die Teilnahme deutscher Truppen besonders dabei hervortritt. Im ganzen interessanter ist die Betrachtung, wie das Heer immer weiter abbröckelt, in einer solchen Weise, dass der französische General Gouvion St. Cyr behauptete, jeder Tag raube ihm ein Regiment, und der bei seinem Korps befindliche Major Thurn und Taxis sagen konnte, »dass uns jeder Marsch mehr Leute und Pferde kostete als ein hitziges Gefecht.«
Das Gesamtbild hat sich inzwischen etwas geändert. An Stelle des litauischen Landregens war glühende Hitze getreten, und die Truppen hatten jetzt ebenso sehr vom Staube zu leiden als früher von der Nässe. Die Verpflegungsschwierigkeiten dauerten zwar im ganzen fort, so dass in Witebsk sogar schon die zum Ärger der andern Truppen stets am besten versorgten Soldaten der Garde plünderten; doch war das Land besser angebaut. Auch einige Viehtransporte kamen an, oder es konnte Schlachtvieh in der wohlhabenderen Gegend beschafft werden. Aber gerade dieser Überfluss an animalischer Nahrung und der Mangel an geistigen Getränken, »die durch trübes Wasser ersetzt wurden«, steigerte nach Aussage des zuletzt genannten Zeugen die eingerissene Dyssenterie in einem »jede Beschreibung übersteigenden Grade«. »Der Mangel an trinkbarem Wasser,« berichtet auch Martens, »trug wesentlich zu den verheerenden Krankheiten bei; gierig schöpften die durstigen Soldaten aus jedem Brunnen, aus jeder Pfütze, und das wenige Wasser war bald so schlammig, dass es nur durch ein Tuch genossen werden konnte.« »Sie ließen sich eher totschlagen«, bemerkt ein bayrischer Offizier (La Rosee), »als sich von diesem ihnen so schädlichen Getränk abhalten.« Schon jetzt ist der Selbstmord aus Verzweiflung nicht selten. Martens ermahnt einen Unteroffizier, der nicht mehr weiter kann, sich zusammenzunehmen und seinen Leuten mit gutem Beispiel voranzugehen. Alsbald verschwindet der Mann im Gebüsch und erschießt sich mit dem eigenen Gewehre. Das war an einem Julisonntag des Jahres 1812. Tags darauf wird ein württembergischer Oberleutnant vom Regimentskommandeur heruntergeputzt; er entreißt dem nächsten Soldaten das Bajonett und rennt es sich durch die Brust. Nach dem, was diese Männer um sich sahen, begreiflich.
Der württembergische Generalchirurgus v. Schuntter vergleicht in einem offiziellen Bericht einen der Biwakplätze der 25. Divsion mit einem Spital; Generalmajor v. Kerner, der Bruder des bekannten schwäbischen Dichters, spricht in einer Meldung von den »schwankenden Gestalten« der württembergischen Infantenristen, die vor dem Marschall Ney vorbeidefilierten, und wundert sich, dass ihr Aussehen auf den harten Kriegsmann keinen tieferen Eindruck gemacht habe. Offiziere aller Grade schrieben Jammerbriefe nach Hause; sie machten die Runde in den Stuttgarter Kreisen, verbreiteten Unruhe und Aufregung im Schwabenlande. Der König Friedrich, ohnehin kein milder Herr, donnerte gegen die Führer seiner Truppen, die sich ihrerseits vergeblich abmühten, der Not zu steuern.
Doch auch freundlichere Szenen zeigt der Marsch im Lande an der Düna, die mit ihrem breiten Wasserspiegel und den plattenförmigen flachen Schiffen, die man verankert sieht, einen angenehmeren Anblick gewährt als die öden Landschaften Litauens. Oft lagert man in üppig grünenden Saatfeldern, und Wedel, dem es mit seinen Chevaulegers besser ergangen zu sein scheint als den Württembergern, erzählt mit Behagen von Hühnern und Beefsteaks, die er gebraten, und selbstverfertigten Omeletten, die bei dem durch den beständigen Aufenthalt in freier Luft gereizten Appetit vortrefflich gemundet hätten. Auch die Städte erschienen freundlicher. Nicht übel präsentierte sich, namentlich aus der Ferne gesehen, Witebsk. »Als wir aus einem Walde in die freie Ebene vorrückten«, schreibt Roos, »überraschte uns in malerisch-schönen, aus Rauchwolken hervorragenden Gebäuden, Kirchen und Klöstern der Anblick der Stadt Witebsk, die wir schon längst hatten nennen hören.« Als der gute Doktor in den Ort hineinkam, der eine so »schöne und Wohlhabenheit versprechende Ansicht darbot«, fand er ihn freilich geplündert, und beim Verlassen bemerkt er trübselig: »Außer einem Stück Eis für den brennenden Durst ist mir in dieser vielversprechenden Stadt nichts zuteil geworden«. Alles in allem gewährte aber doch dieser zweite Aufzug des Völkerdramas wenigstens hier und da etwas freundlichere Aspekten als der erste. Nur die Bevölkerung wurde immer feindseliger, »Hier hat das Land, wo man es mit uns hält, ein Ende,« rapportierte ein vom Jägerregiment Herzog Louis vorausgeschickter Unteroffizier bei der Rückkehr von seinem Streifzuge, »da drüben sind die Menschen anders, alle wider uns; überall bin ich unfreundlich, mit Vorwürfen und Zank empfangen worden. Die Bauern sind mit Piken versehen, und viele sind beritten; die Weiber sind zur Flucht fertig und schimpfen ebenso wie die Männer auf uns. Von Ort zu Ort geben sie sich reitend Nachricht von dem, was vorgeht, haben außerdem Signalbretter, und die Edelleute kommandieren sie«.
Mit den Franzosen hielten nur noch einzelne Grundherren polnischer Abkunft; das übrige Volk stand ihnen in dumpfem Hass gegenüber, den nicht erst Raub und Plünderung zu entzünden brauchten. Hierfür hatten die Russen gesorgt; denn von nun an begannen diese jene an die alten Skythen erinnernde Kriegführung, die darauf abzielte, durch planmäßige Verwüstung des eigenen Landes den Fremden den Aufenthalt darin unmöglich zu machen. Zugleich verband sich damit die wohlüberlegte Absicht, den Gegnern die Brände in die Schuhe zu schieben, um dadurch und durch fanatische Proklamationen den Hass der stumpfen Muschiks gegen die in das heilige Russland eindringenden Ketzer und Ungläubigen zur Wut zu entflammen.
Dass schon damals auch von Soldaten der großen Armee viele Ortschaften angezündet wurden, ist freilich richtig und bei der herrschenden Unordnung nicht zu verwundern. Doch geschah es mehr aus Unachtsamkeit als aus bösem Willen, da bei der Sommerhitze ein Funke genügte, um die Strohdächer der russischen Holzhäuser in Feuer aufgehen zu lassen, wie ihrerseits die davonsprengenden Kosaken nur einen Pistolenschuss in ein Haus abzufeuern brauchten, um diesen Zweck zu erreichen. Der westfälische Hauptmann v. Borcke schreibt darüber: »Hin und wieder zeigten sich schon die ersten Brandscenen, Durch die nächtlichen Biwaks in der Nähe der Ortschaften, das Feueranmachen in Häusern und Scheunen durch die nach Lebensmitteln suchenden und umherschwärmenden Soldaten gingen stündlich einzelne Gebäude in Flammen auf. Nicht Mutwillen oder Absicht waren die Ursachen, welche diese Schrecknisse immer weiter verbreiteten und die bald zur Einäscherung ganzer Dörfer und ansehnlicher Städte führten, sondern die durch Mangel an allem herbeigeführte Not und die aus dieser entstehende gänzliche Ausartung der Kriegszucht. Oft waren kleine, unter Bienenstöcken, um die Bienen daraus zu vertreiben, oder zum Kochen angemachte Feuer, die man nach gemachtem Gebrauch sorglos brennen ließ, oder ein überhitzter Backofen, in dem von gefundenem Mehl Brot gebacken war, der Grund, dass ganze Orte in Flammen aufgingen«.
In den in der Nähe der Düna ausgefochtenen Kämpfen, zu denen wir jetzt wieder übergehen, hatte namentlich die Reiterei der Verbündeten Gelegenheit gehabt, ihre Lanzen und Säbel mit den russischen zu kreuzen.
Am Morgen des 15. Juli war die Kavallerie Sebastianis von den Russen bei Druia überfallen worden, und ein polnisches und ein französisches Husarenregiment hatten große Verluste erlitten. Die Württemberger, die ihnen zu Hilfe eilten, kamen zu spät. Roos erwähnt diesen Vorfall nur flüchtig, und doch war er von großer Bedeutung, die ein Mann in seiner Stellung freilich kaum ahnen konnte. Denn durch diese Affäre wurde Napoleon, der die Hoffnung, dass ihm Barclay standhalten werde, schon beinahe aufgegeben, anderen Sinnes, und das hat auf seine weiteren Entschließungen einen nachhaltigen Einfluss geübt. Wirklich kam es zwischen Russen und Franzosen in den Tagen vom 25. bis 27. Juli in der Gegend von Witebsk zu lebhaften Kämpfen, an denen sich bayrische Kavallerie beteiligte. Diese Gefechte werden in der Regel mit dem Namen des Treffens von Ostrowno bezeichnet. Auch das preußische Husarenregiment, dessen Oberst v. Czarnowsky hier die Ehrenlegion erwarb, hatte sich wiederum hervorgetan. Der Fragmenteschreiber hat hierüber einen Bericht hinterlassen, der seiner Länge wegen nicht vollständig abgedruckt werden kann. In bitteren Worten wird darin der König von Neapel getadelt, der als glänzender Avantgardekommandeur mit seiner Person überall hervortritt, aber die schon ohnehin stark dezimierte Reiterei der Franzosen und ihrer Verbündeten durch Abhetzen und rücksichtsloses Draufgehen vorzeitig zugrunde richtet, ein verhängsnisvoller Fehler angesichts eines Feindes, der eine starke Kavallerie besaß, und in einem Lande, dessen eigentümliche Beschaffenheit eine der wichtigsten Aufgaben dieser Truppengattung, den Aufklärungsdienst, für den angreifenden Teil sehr erschwerte.
Doch hat anderseits Murats Heldentum den von Kampf und Strapazen Ermüdeten oft als Vorbild geleuchtet, und seine nonchalante Verachtung jeder Gefahr, auch das Phantastische seiner Erscheinung, war echten Reiternaturen nicht unsympathisch. Hören wir, wie Wedel über des Königs Auftreten bei Ostrowno spricht:
»Murat hatte die russische Arrieregarde erreicht, welche hier eine feste Position genommen hatte und entschlossen zu sein schien, den Weitermarsch der französischen Armee wenigstens einige Zeit aufzuhalten. Mit Ungeduld erwartete der König von Neapel die Ankunft der Infanterie, weil er mit der Kavallerie allein gegen die im Holze versteckte Infanterie der Russen nichts ausrichten konnte. Nach etwa einer Stunde langte ein leichtes italienisches Regiment im Laufschritt an und ward sogleich zum Angriff geführt. Jetzt wurde das Gefecht lebhafter und allgemeiner, zumal da bald Artillerie und mehr Infanterie ankam. Das niedrige Gebüsch vor uns ward gänzlich gesäubert, und wir konnten uns im freien Felde aufstellen, von wo aus das ganze Gefecht zu übersehen war. Murat hielt nicht weit von uns, ohne das feindliche Feuer, dem er ausgesetzt war, im Mindesten zu beachten.
Da wurde das vor uns stehende italienische Infanterieregiment, durch das heftige feindliche Feuer besonders zweier an der Ecke eines Holzes aufgestellten Geschütze stark mitgenommen, wankend und begann zu weichen, als plötzlich hinter dem Holze ein russisches Dragonerregiment hervorbrach, sich auf die weichende Infanterie warf und dieselbe zur Flucht brachte, auch ein großes Blutbad unter ihr anrichtete. Der ganze Flügel geriet durch dieses Weichen in Gefahr Murat sah dies; wie ein Pfeil schoss er herbei und setzte sich an die Spitze unseres zunächst stehenden Regimentes. Seine mächtige Stimme schallte laut durch das Getöse der Schlacht: »Braves chevau-légers! Suivez-moi, chassons ces bougres-là. En avant! au galop! marche!« Durch sein Beispiel enthusiasmiert, stürmte das Regiment fest geschlossen mit eingelegter Lanze im schnellsten Laufe auf den andringenden Feind. Bald war alles durcheinander; im Staub und Pulverdampf konnte man seinen Nebenmann nicht erkennen; nach kurzem Handgemenge ergriff der Feind die Flucht«.
Anders lautete das Urteil über Sébastiani, der sich am 8. August — bei dem früher erwähnten Offensivvorstoße Barclays — vor Inkowo6 hatte überraschen und schlagen lassen. Das Gefecht scheuchte die Truppen des 2. Reiterkorps aus einer mehrtägigen Ruhe empor, die Napoleon seiner Armee als Heilmittel für die eingetretene Zerrüttung verordnet hatte und die den Erschöpften in ihrer bedrängten Lage recht wohl zustatten gekommen war — ein freundlicher Haltepunkt in dem rastlosen Umherjagen der letzten Wochen, der als solcher in den Berichten aller Beteiligten ausdrücklich erwähnt wird. »Wir hatten in jenem Lager bei Liozna sieben Tage zugebracht«, meldet Roos, »als am 8. August mit den ersten Sonnenstrahlen, die da viel früher, als an der Donau in Schwaben, sichtbar werden, plötzlich das Kriegsgeschrei ertönte: ,Der Feind ist da!‘ Schüsse und Alarmtrompeten hörte man überall ebenso schnell, und schon sahen wir die Russen nahe vor uns, die französischen Regimenter, die bei Inkowo standen, in größter Unordnung vor sich herjagend. Ich war in solchen Fällen immer einer der ersten zu Pferde und sah also den üblen Ausgang der Affäre an der Verwirrung der flüchtenden Franzosen. Schon jetzt und abermals waren wir, die Alliierten, es wieder, welche Geistesgegenwart behielten, standen, in Ordnung vorrückten und dem raschen Andringen der Russen Schranken setzten. Mit sichtbarem Erfolge trieben die preußischen Ulanen in geschlossener Ordnung den rechten Flügel der Russen zurück; unsere Jäger waren im Zentrum tätig, während die polnischen Husaren die Landstraße zu unserem Rückzuge frei hielten und die Kosaken und Baschkiren in ihrem Vordringen lange hinderten. Hier sahen wir zum ersten Mal Pfeilgeschoss gegen uns, größtenteils aber wie Kugeln durch die Luft fliegen, sausen und pfeifen. Einen polnischen Offizier traf ein Pfeil in die rechte Hüfte, und einem unserer Reiter blieb ein solcher in der Kleidung stecken; beide Pfeile führten wir lange zum Andenken mit uns. Mittlerweile gab es blutige Beschäftigungen genug für die Ärzte, wobei denn auch meine Hände tätig wurden. Es waren indessen die Streitkräfte unserer drei schon sehr geschwächten Regimenter7 zu gering, den Platz gegen das erneuerte Andringen der uns an Menge und Kraft weit überlegenen Russen zu behaupten. Ihr neuer Angriff hatte nun auch den Erfolg, dass unsere Brigade verdrängt wurde. Sie zog zwar in geschlossenen Reihen zurück, aber auch diese Ordnung bestand nicht lange, denn die Russen waren rasch, kräftig und an Zahl überlegen; kurz, ihr rascher Choke warf auch jetzt alles gleichsam über den Haufen. Unser Rückzug ging schnell gegen Rudnia, welches über eine Meile hinter unserm Lager lag. Die Ankunft des Generals Montbrun auf der Hälfte des Weges mit frischer Kavallerie und leichter Artillerie rettete uns vom Untergange und machte der blutigen Affäre ein Ende«.
Die Württemberger traf in diesem Kampf ein ganz eigenartiges Missgeschick, dessen Roos nicht gedenkt, das aber mindestens als Kuriosum notiert zu werden verdient. Bei der plötzlichen Alarmierung hatten die reitenden Jäger des Regiments Herzog Louis ihre Fouragierleinen nicht mitgenommen, und diese waren wie gewöhnlich zwischen den Pikettpfählen ausgespannt geblieben, an die man die Pferde zu binden pflegte. Nun wollte der Zufall, dass die Jäger vom Feinde über diesen nämlichen Platz gedrängt wurden, wobei eine Anzahl der Leute über die von ihnen selber ausgespannten Leinen stürzte und gefangen wurde.
Bei dem auch von Roos erwähnten Rückzuge wurde die Division Sebastiani durch das preußische Ulanenregiment gedeckt, das dafür das Lob der Franzosen und ihres Kaisers erntete. Als besondere Auszeichnung erhielt der Kommandeur des Regiments Major v. Werder, das Offizierkreuz der Ehrenlegion, ohne das Ritterkreuz vorher besessen zu haben.
Nicht zu übersehen ist noch eine fernere, die Affäre des 8. August betreffende Bemerkung des Doktors v. Roos: »Unser Unglück bei Inkowo,« sagte er, »hatte den General Sebastiani der wenigen Liebe, die wir alle für ihn hatten, vollends verlustig gemacht.« Wieder eine der Äußerungen, die beweisen, einer wie geringen Beliebtheit sich manche der französischen Führer unter den Bundesgenossen erfreuten.
Viel schlimmer war das bei den Westfalen, die in dieser Beziehung unter besonderer Ungunst der Verhältnisse zu leiden hatten. Sie gehörten, wie wir wissen, zum rechten Flügel der Hauptarmee, der bestimmt gewesen war, gegen Bagration zu operieren und diesen dem von der Hauptkolonne in südöstlicher Richtung abmarschierten Davout entgegenzutreiben. Da das Manöver misslang, unterstellte Napoleon, aufgebracht über die Untätigkeit seines Bruders, dem Marschall den ganzen Heeresteil, und als der gekränkte Jérôme darauf die Armee verließ, bekamen die Westfalen als neuen Befehlshaber den General Junot, Herzog von Abrantes, einen der ältesten Kriegsgefährten des Kaisers, dem dieser um der alten Waffenbrüderschaft willen vieles hingehen ließ und der sich und sein Korps um den besten Teil des Ruhmes brachte, den beide bei tüchtiger Führung hätten erwerben können. Die unglücklichen Westfalen waren unter einen General gekommen, der, durch Strapazen und Ausschweifungen zerrüttet, dem Wahnsinn nahe war, dem er im folgenden Jahre offensichtlich verfiel.
1 Das Großherzogtum Warschau wurde bekanntlich 1807 aus den im Tilsiter Frieden von Preußen abgetretenen Teilen Polens gebildet. Es um* faßte die jetzt preußische Provinz Posen sowie Teile von Russisch-Polen. Zum Großherzog hatte Napoleon den König Friedrich August von Sachsen ernannt.
2 Die Polen wünschten (vergl. S. 13) die Herstellung ihres ehemahgen Reiches. Napoleon konnte sie gar nicht aussprechen, mit Rücksicht auf das verbündete Österreich und auch im Hinblick auf einen späteren Friedenss Schluß mit Rußland, den, auch im Fall selbst des günstigsten Ausgangs seines Feldzugs, eine Herstellung Polens außerordentlich erschwert haben würde.
3 Die Hauptkolonne, von der hier die Rede ist, ging unter Napoleon selbst am 25., zum Teil allerdings schon am 24., bei Ponjemon, nahe Kowno, über den Njemen; die zu Macdonalds Korps gehörigen Preußen
4 (d. h. alle außer den beiden mit nach Moskau ziehenden Reiterregimentern und den zwei Kompagnien der preußischen Artilleriebrigade) ebenfalls am 24. Juni bei Tilsit; die Bayern mit dem Vizekönig Eugen erst anfangs Juli bei dem südöstlich von Kowno gelegenen Pilony; die unter Jerome gegen Bagration geschickten Westfalen — gleichfalls in den ersten Julitagen — noch weiter südlich bei Grodno.
5 Ort nördlich der von Kowno nach Wilna gehenden Straße. Der Schrei? her marschierte auf dem linken Flügel des Hauptheeres.
6 Stadt an der Straße zwischen Witebsk und Smolensk.
7 Gemeint sind das württembergische Jägerregiment Nr. 3, zu dem Roos selbst gehörte, das preußische Ulanenregiment und das 10. polnische Husarenregiment.