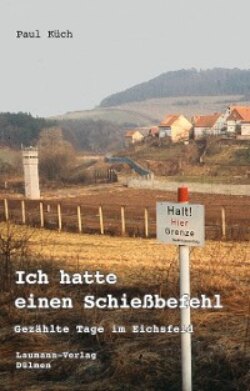Читать книгу Ich hatte einen Schießbefehl - Paul Küch - Страница 9
Im wehrpflichtigen Alter
ОглавлениеMeine erste Begegnung mit dem Militär im Jahre 1973 verlief recht außergewöhnlich. Zwei Vorlaubenhäuser, die Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden, bildeten die Sehenswürdigkeiten in der Gemeinde, denen wir es zu verdanken hatten, dass unser Dorf als Kulisse für den DEFA-Spielfilm „Unterm Birnbaum“ ausgewählt wurde. Neben Agnes Kraus, Angelica Domröse, Erik S. Klein und Hanjo Hasse durfte ich in einer Statistenrolle mitwirken. Gemeinsam mit einigen Mitschülern spielte ich einen armen Bauernjungen in zerrissenen Lumpen und Holzpantinen. Mit dieser Verkleidung erweckten wir sogar in unserem Dorf Mitleid.
Auf dem Weg von der Maske im Saal zum Drehort kamen uns Lastkraftwagen der Nationalen Volksarmee (NVA) entgegen, deren Fahrer entsetzt anhielten. Die Soldaten, die nichts vom Filmdreh ahnten, waren bei unserem Anblick so schockiert, dass sie ihren Lebensmittelvorrat für den Ernstfall hervorkramten und aus dem Fenster warfen. Brot und Wurst in Büchsen, Kekse sowie Schokolade landeten direkt vor unseren Füßen. Die Aktion gefiel mir und ich freute mich, dass ausgerechnet diese Soldaten unsere Paten in der Schule wurden. Bei gegenseitigen Besuchen und gemeinsamen Manövern haben wir später oft über die Episode gelacht.
Der enorme Druck auf uns Jugendliche, sich für einen längeren Armeedienst zu verpflichten, nahm ab der neunten Schulklasse immer mehr zu. Wir wurden ständig agitiert, entweder die Offizierslaufbahn einzuschlagen oder wenigstens drei Jahre als Unteroffizier zu dienen. Einige Lehrer verbogen sich regelrecht, um Nachwuchs für die NVA zu gewinnen. Konnte ich mich bis zur zehnten Klasse noch erfolgreich vor Arbeitsgemeinschaften wie Flugmodellbau, Kraftsport und Schießen drücken, gab es für mich in der Abiturstufe keine Ausreden mehr, eine Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST), die das Sprungbrett zur Armee bildete, zu verweigern.
Im elften Schuljahr absolvierten wir Jungen einen militärischen Lehrgang auf der Insel Rügen. Während der Zugfahrt ins Wehrlager fielen unsere graugrünen Uniformen und schwarzen Schnürschuhe auf, weil sie sich krass von der knappen Mode der Urlauber unterschieden. So standen wir beim Umsteigen auf den Bahnhöfen in Stralsund und Sagard isoliert da.
Die Ausbildung mit Holzgewehren in den Wäldern zwischen Breege und Juliusruh machte uns zu einer absoluten Lachnummer. Nach Dienstschluss übten wir Nahkampf in den Dünen am Tromper Wiek, tranken heimlich Bier und bändelten mit vernachlässigten Urlauberinnen an. Heute tummeln sich Camper auf dem Gelände des ehemaligen GST-Lagers in Breege, wo nur der verwahrloste Schießplatz an alte Zeiten erinnert. Nur gut, dass unser Lehrer ein sehr verständnisvoller Vorgesetzter war, der dem Pseudodrill nichts abgewinnen konnte und unsere Freizeitaktivitäten tolerierte. So entstand kein zusätzlicher Druck von außen. Da fünf Mitschüler ihr Hobby zum Beruf wählten, brauchte ich keine Verpflichtungserklärung für eine längere Dienstzeit zu unterschreiben. Zwei wollten unbedingt, zwei mussten von den Eltern aus und einer wurde irgendwie mitgerissen. Die hohe Quote überraschte selbst den verantwortlichen Lehrer, so dass ich überhaupt nicht gefragt wurde. Ich sah die 18 Monate Grundwehrdienst als notwendiges Übel, denn ich verabscheue den Umgang mit Waffen und habe großen Respekt vor deren Wirkung. Trotzdem musste ich wie die meisten männlichen Jugendlichen zur Fahne. So hieß es früher, wenn der Grundwehrdienst in der NVA bevorstand. Seit der Einführung der Wehrpflicht in der DDR am 24. Januar 1962 waren anderthalb Jahre Pflicht. Alles darüber hinaus war freiwillig. Die Rekruten mussten Anfang Mai oder Anfang November einrücken. Bei den Grenztruppen wurde zusätzlich im Februar und August eingezogen. Ich wusste damals nicht, dass man den Waffendienst ablehnen durfte. Eine Verweigerung wäre für mich auch nicht in Frage gekommen, weil ich meinen Eltern keine Schwierigkeiten bereiten wollte. Nach der Verordnung des Nationalen Verteidigungsrates vom 7. September 1964 bot sich jedoch die Chance, den Militärdienst in einer Baukompanie abzuleisten. Erst als ein Freund die Uniform mit einem kleinen Spaten auf den Schulterstücken trug, nahm ich Notiz davon. Trotz seiner pazifistischen Einstellung wurde Detlef Teil der Arbeiter- und Bauernarmee. Der gelernte Betonfacharbeiter mauerte dicke Wände auf einer abgesperrten Baustelle in der Nähe von Berlin, wo ein großer Militärkomplex entstand. Das emsige Treiben beobachtete ich heimlich durch ein winziges Astloch im übermannshohen Bretterzaun, wenn ich Detlef am Wochenende mit dem Moped abholte. Die schwere körperliche Arbeit war mein Kumpel gewöhnt, aber der militärische Drill machte ihm zu schaffen. Aus grauen Lautsprechern schepperte Marschmusik, die das monotone Geschrei der Vorgesetzten übertönen sollte. Trotzdem konnte ich das Gebrüll bis auf die Straße hören. An allen Ecken standen bewaffnete Aufpasser, die dafür sorgten, dass sämtliche Tätigkeiten im Laufschritt erledigt wurden. Die befohlene Eile führte zwangsläufig zu Pfusch am Bau, was Strafen nach sich zog. Detlef musste Überstunden leisten, so dass ich freitags oft vergeblich auf meinen Freund wartete. Er sprach nicht über den Dienst, weil ihm die Verweigerung nur Nachteile einbrachte. Niemand interessierte sich für die Gründe, warum Detlef keine Waffe in die Hand nehmen wollte. Er galt fortan als Drückeberger in unserem Dorf, was ich unter keinen Umständen wollte. Berufliche Perspektiven für Spatensoldaten waren eingeschränkt und Studienplätze gab es nicht mehr für sie. Davor hatte ich Angst.
Mit dem obligatorischen Musterungsbescheid forderte man mich zur Überprüfung meiner Diensttauglichkeit auf. Ein Nichterscheinen beim Wehrkreiskommando hätte strafrechtliche Folgen gehabt. Geprägt durch die Erziehung im Elternhaus machte ich mir selbst Mut, denn ich wollte nicht vor der Verantwortung davonlaufen. Das war ich meinen Eltern und mir persönlich schuldig. An die Verpflichtung dem Staat gegenüber dachte ich weniger. Wenn man genau das tat, was von einem verlangt wurde, hatte man seine Ruhe. Wohl wissend, dass jeder Situation etwas Gutes abzugewinnen ist, bereitete ich mich auf die Armeezeit vor.
Im Bekanntenkreis fragte ich ehemalige Grundwehrdienstler nach ihren Erinnerungen. Leider konnte ich daraus keinen Nutzen ziehen, weil die Auskünfte zwiespältig waren. Einige Leute prahlten damit, bei der NVA erfahren zu haben, wer man wirklich war. Bei anderen gewann ich den Eindruck, dass sie die Armeezeit bewusst verdrängten, da sie abwertend über diesen Lebensabschnitt sprachen. Folglich beschlich mich ein Gefühl zwischen Angst und Neugier.
Die Untersuchung meiner körperlichen und geistigen Eignung für den Wehrdienst erfolgte am 21. April 1981 in unserer Kreisstadt. Ich war vorher beim Friseur und trug keine Matte mehr wie die Hippies im Musical Hair. In der Nacht vor dem Termin träumte ich vom Hochstapler Felix Krull aus dem Roman von Thomas Mann, der mit einem epileptischen Anfall seine Ausmusterung erreichte. Das lag mir fern. Schon beim Aufstehen am frühen Morgen begann das erwartete Muffensausen. Unser Personenzug bekam am Umsteigebahnhof keine Einfahrt, so dass ich befürchtete, den Anschlusszug zu verpassen. Ich war Pünktlichkeit gewöhnt, was man von unseren öffentlichen Verkehrsmitteln nur bedingt behaupten konnte. Deshalb plante ich reichlich Zeit für die Anreise ein, um viel zu früh am Musterungsstützpunkt einzutreffen.
Hinter einem Tross orangefarbener Rangierloks auf dem Nachbargleis sah ich den D-Zug von Stralsund zur Weiterfahrt nach Berlin-Lichtenberg stehen. Ich spurtete los und erreichte ihn auf dem letzten Drücker. Hastig schlug der Schaffner die Tür von außen zu. Im selben Augenblick fuhr der Zug an. Das heftige Rucken schleuderte mich in den überfüllten Gang, wo man überhaupt nicht umfallen konnte. Wer nun hoffte, dass bei dem Gedränge keine Fahrausweise kontrolliert wurden, der hatte sich getäuscht. Als sich der Schaffner einen Weg durch den Zug bahnte, rammte er mir seinen Ellenbogen in die Seite. Zum Glück fiel mir noch rechtzeitig ein, dass mein Musterungsbescheid gleichzeitig eine Fahrkarte 2. Klasse war. Zwei Stunden vor meinem Termin erreichte ich den Musterungsstützpunkt, der direkt hinterm Bahnhof lag. Bei der Anmeldung musste ich nicht warten. Jeder Kandidat ist sofort abgefertigt worden, woraus sich für mich die Möglichkeit ergab, den Mittagsbus nach Hause zu schaffen. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass mich niemand kannte. Ich brauchte keine Zeugen, die mir später nachsagten, dass ich mich blöd angestellt hätte. Diese Anonymität ließ meine Unsicherheit langsam weichen. Im Gegensatz zu den Szenen im Film „Pearl Harbor“ mit Ben Affleck verlief meine Musterung ernst und sachlich. Meine Angst, diesen Kittel- und Uniformträgern ausgeliefert zu sein, legte sich rasch. Die Übermacht hatte ich mir wesentlich größer vorgestellt. Natürlich flößten mir Menschen in Uniformen Respekt ein, aber ich gewöhnte mich schnell an die durchdringenden Blicke. Die Prozedur selbst bestand aus vier Abschnitten, die akribisch im Gesundheitsbuch festgehalten wurden. Dieses G-Buch musste ein wichtiges Dokument sein, denn auf der Titelseite prangte das Wappen unseres Arbeiter- und Bauern-Staates.
Der Teil A beinhaltete Namen, Adresse, Geburtsdatum und Schulbildung. Im Teil B erfolgte eine Aufnahme von Erkrankungen in unserer Familie. Ein freundlicher Weißkittel mit Hornbrille auf der untersten Nasenspitze fragte nach Unfällen, ambulanten und stationären Behandlungen. Als er das schwere Gestell abnahm, glich er einem schlitzäugigen Chinesen. Er rieb sich ein Auge und kniff das andere zu, was Krähenfüße in den Winkeln entstehen ließ. Der Brillensteg hatte auf der Nase einen terrassenähnlichen Abdruck hinterlassen. Sein Zinken wirkte in diesem Moment wie eine Skisprungschanze. Der Arzt hauchte gegen die Gläser, polierte sie blank und riskierte einen flüchtigen Kontrollblick. Das benutzte Stofftaschentuch verschwand jedoch nicht wieder in seiner Hosentasche. Er zwirbelte eine Ecke zu einer fingerdicken Wurst zusammen und steckte sich die Spitze abwechselnd in beide Nasenlöcher. Dazu bückte er sich unter den Schreibtisch, wobei seine Stirn um ein Haar gegen die Tischkante gestoßen wäre. Ich verschwieg bewusst, dass mein Vater während des Afrikafeldzuges im Zweiten Weltkrieg mit einer Malaria im Lazarett lag. Besonderen berufsbedingten Einflüssen wie Lärm, radioaktiven Strahlen und giftigen Substanzen war ich als Schüler der elften Klasse nicht ausgesetzt. Die Frage nach Nikotin konnte ich verneinen, denn der Gestank ekelte mich an. Heimliche Versuche, Zigaretten zu rauchen, hatte ich bereits hinter mir. Allerdings traute ich mich nicht, den Qualm zu inhalieren. Schokolade schmeckte mir besser. Beim Thema Alkohol nickte ich zwar, aber der Doktor fand keine Anzeichen von Abhängigkeit. Bettnässer war ich schon lange nicht mehr. Die Schwimmfertigkeit lag mit erreichter dritter Schwimmstufe vor. Bei sportlicher Betätigung trug der Arzt ein, dass ich organisiert Fußball spielte.
Teil C umfasste die körperliche Untersuchung durch einen pausbackigen Musterungsarzt. Nur in Unterhosen betrat ich barfuss einen Raum, in dem Einzelabfertigung herrschte. Ich wog bei einer Körpergröße von 185 Zentimetern 82,5 Kilogramm. Als mir der Arzt einen trockenen Holzspatel in den Rachen schob, musste ich würgen. Die Blutentnahme wurde von einer Krankenschwester vorgenommen, die vorher Protokoll führte. Der Doktor prüfte Ohren, Augen, Nase, Mundhöhle, Hals, Wirbelsäule, Lunge, Herz, Milz, Nieren und die Haut. Mein leichter Silberblick störte ihn nicht. Den dezenten Griff an die Männlichkeit begleitete ein „Husten sie mal!“ In diesem Moment blickte die Schwester neugierig auf, was mich nicht im Geringsten störte. Die Tippse würde ich sowieso nicht wiedersehen. Auf Grund der vorliegenden Befunde sollte im Teil D eine geeignete Waffengattung für mich festgelegt werden. Die Entscheidung der Musterungskommission bestand lediglich aus zwei Worten.
Ich sollte motorisierter Schütze werden, was Angehöriger der Landstreitkräfte der NVA oder kurz Mucker bedeutete. „Ich, warum ausgerechnet ich?“, bohrte sich eine Frage in mein Hirn, die gewiss tausende Rekruten vor mir beschäftigt hatte. Keine andere Waffengattung hätte mich mehr treffen können. Ich war ganz unten angekommen, denn motorisierte Schützen galten im Krieg als Kanonenfutter. Enttäuscht von dieser Einstufung überhörte ich fast die Frage nach der Dauer der Dienstzeit. Die 18 Monate erschienen mir ausreichend.
Ich erhielt den grauen Wehrdienstausweis und eine persönliche Erkennungsmarke, auf der meine Personenkennzahl und die Staatsangehörigkeit DDR eingeprägt waren. Die so genannte Hundemarke sollte im Ernstfall um den Hals getragen werden. Von meinem Vater wusste ich, dass er einst das ovale Aluminiumschild eines Kameraden in der Mitte auseinanderbrach, als der Soldat im Zweiten Weltkrieg verstarb. Er nahm den unteren Teil mit und gab ihn beim Vorgesetzten ab. Der obere Teil verblieb zur Identifizierung bei der Leiche. In dem Zusammenhang erzählte mein Vater auch von ehemaligen Kameraden, die vor ihrer Erschießung im Kriegsgefangenenlager die Hundemarken zusammenrollten und verschluckten, um später erkannt zu werden. An ein solches Szenario wagte ich überhaupt nicht zu denken.
Hundemarke und Wehrdienstausweis des Autors
Trotz der düsteren Aussichten fiel mir ein Stein vom Herzen, weil ich die Musterung überstanden hatte. Dafür belohnte ich mich mit ein paar Gläsern Bier in der Wildgaststätte „Weidmannsheil“, die sich in der Nähe des Busbahnhofes befand. Kurz nach 11.00 Uhr war ich der erste Gast, der den kalten Rauch vom Vorabend einatmen musste. Das vergilbte Hinweisschild „Bitte warten, Sie werden platziert!“ am Hirschgeweih überm Eingang ignorierte ich bewusst. Hastig setzte ich mich an den verwaisten Stammtisch vorm Tresen und orderte den Gerstensaft, weil mir nur eine halbe Stunde bis zur Abfahrt des Busses blieb. Das erste Glas leerte ich in einem Zug und bestellte sofort ein zweites Bier nach. Als ich eine Soljanka verlangte, riet mir die freundliche Kellnerin ab, weil die Suppe vom Vortag angeblich aus dem Topf stank. Dafür bekam ich einen doppelten Kräuterlikör auf Rechnung des Hauses, mit dem der Objektleiter unbedingt einen Eintrag ins Gästebuch, dem Beschwerdebuch in unseren Kneipen, verhindern wollte. Entgegen der Annahme des Wirtes war ich nicht der Typ, der sich bei der erstbesten Gelegenheit beklagte. Wenn mir etwas nicht schmeckte, habe ich es stehengelassen, meine Rechnung bezahlt und das Lokal fortan gemieden.
Im September 1982, genau am 10., fand meine Einberufungsüberprüfung statt, die ich kommentarlos über mich ergehen ließ. Jede Veränderung gegenüber den Musterungsbefunden wurde penibel ins Gesundheitsbuch eingetragen. Die trügerische Routine unterbrach ein Offizier mit einer Frage, die soviel Sprengstoff in sich barg, dass ich ihre Bedeutung nicht gleich erfassen konnte. „Genosse Küch, würden sie bei einem Angriff auf ihre Person von der Schusswaffe Gebrauch machen?“, bohrte der Uniformierte. In diesem Moment, in dem man mich mit einer scheinbar simplen Frage konfrontierte, deren Tragweite ich nicht übersah, fühlte ich mich überfordert. Selbstverständlich hätte ich mich verteidigt. Jeder Mensch verteidigt sich, wenn er angegriffen wird und mit einer Waffe ist das noch einfacher als mit bloßen Händen, sagte mir meine innere Stimme. Deshalb antwortete ich mit dem Wort, das aus zwei Buchstaben bestand. Ich hielt mein Ja in dieser Situation für absolut normal und bemerkte, dass alle Anwesenden mit dieser Antwort gerechnet hatten. Die Mitglieder der Einberufungskommission, die nicht an meiner Einstellung zweifelten, werteten meine Zustimmung als Bereitschaft und steckten mich an die innerdeutsche Grenze. Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik hörte sich wichtiger an als motorisierter Schütze oder gar Mucker. Ich sah in der neuen Einstufung eine Auszeichnung, denn ich war ein Kind zweier Genossenschaftsbauern, die in der Hierarchie der Klassen und Schichten hinter den Angehörigen der Arbeiterklasse lagen. Irrtümlich dachte ich, dass nur Söhne von Betriebsleitern, Kombinatsdirektoren oder Parteisekretären an die Grenze kamen. Doch bei den Grenztruppen herrschte eine bunte Mischung, was die Herkunft der Rekruten betraf. Damals habe ich dem Grenzdienst gleichgültig gegenübergestanden, weil sich mein Wissen darüber auf wenige Fakten beschränkte. Ich kannte die olivgrünen Uniformen, die mit einem raffinierten Muster aus einem Strich und dann wieder keinem Strich abwechselnd verziert waren. Von dieser Anordnung stammte der Begriff Einstrich-Keinstrich, das Kurzwort für unsere Verkleidung.
Zur Ausbildung musste ich im November 1982 ins Grenzausbildungsregiment 11 nach Eisenach. Bisher verband ich mit dieser Stadt die Wartburg und den gleichnamigen Pkw, das Aushängeschild der einheimischen Automobilindustrie. Dabei zählt Eisenach neben Weimar zu den deutschen Kulturhochburgen. Martin Luther übersetzte auf der Wartburg das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche und schuf somit die Grundlage der deutschen Schriftsprache. Der Musiker Johann Sebastian Bach wurde am Frauenplan 21 geboren, Walter von der Vogelweide und Goethe waren in der Stadt zu Gast und der Dichter Fritz Reuter verbrachte hier seine letzten Jahre. Ich befand mich also auf dem besten Wege, die Reihe deutscher Größen zu vervollständigen.
Die Vorgesetzten befahlen mich, Paul Küch, aus dem Bezirk Frankfurt an der Oder in den Bezirk Erfurt. Unser Staat simulierte kriegsähnliche Verhältnisse und schickte viele junge Leute aus dem Osten des Landes an die Westgrenze und umgekehrt. Jungs aus dem Norden mussten im Süden dienen und anders herum. Doch nicht jeder kam in den zweifelhaften Genuss, zum Wehrdienst quer durch die Republik zu reisen. Wie überall im Staat spielten Beziehungen eine große Rolle. Einem Funktionärssohn war es beispielsweise möglich, in der Nähe des Heimatortes zu dienen.
Vorteilhaft fand ich, dass mir zwei Winter bevorstanden und nicht zwei Sommer, da man sich in der warmen Jahreszeit angenehmer vergnügen konnte als in der kalten. Das galt vor allem, wenn eine Freundin, Verlobte oder Ehefrau existierte, denn der Grundwehrdienst bildete einen echten Prüfstein für die Liebe. Genau an diesem Punkt begann mein Problem. Sollte ich so kurz vor der Armeezeit das Risiko einer neuen Beziehung eingehen?