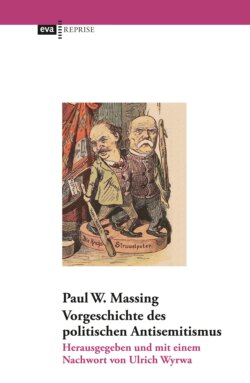Читать книгу Vorgeschichte des politischen Antisemitismus - Paul W. Massing - Страница 9
KAPITEL II Der christlich-konservative Gegenangriff (1879-1886)
ОглавлениеIn den Jahren stockender Wirtschaftsentwicklung und gesellschaftlicher Malaise zwischen 1874 und 1878 setzte sich im neuen Reich eine verwickelte soziale und politische Umorientierung durch. Das Elend der großstädtischen Massen und ihre zunehmende Entfremdung von Kirche und Staat erregte allgemeine Besorgnis; die »soziale Frage« wurde zum Thema der Zeit, zu einem Gegenstand endloser Diskussionen in Presse und Predigt. Überall war der Schrei nach »Reformen« zu hören, Reformvereine aller Art schossen aus dem Boden. Der Zentral-Verein für Sozialreform, angefeuert von dem evangelischen Pfarrer Rudolf Todt, lenkte die Aufmerksamkeit auf das Elend von vernachlässigten städtischen und ländlichen Gruppen und verlangte Abhilfe durch die Regierung. Die Gewerbetreibenden riefen nach »Steuer- und Gesetzreformen«, die Industriellen verlangten »Schutz der nationalen Arbeit«. Der 1873 gegründete Verein für Sozialpolitik war die Organisation der Reformer an den Universitäten, denen ein nationalliberaler Journalist, H. B. Oppenheim, den Spitznamen »Kathedersozialisten« anhängte. Nicht der Sozialismus hatte sie zusammengeführt – sie gehörten den verschiedensten politischen Richtungen an – sondern die ihnen gemeinsame Ablehnung des »Manchestertums« der Nationalliberalen und die Besorgnis über die sozialen Folgen des entfesselten Kapitalismus. Im Verein für Sozialpolitik fanden sich solch hervorragende akademische Lehrer wie Gneist, Roscher, Schmoller, Brentano, Knapp, Conrad und Adolph Wagner zusammen.
Die Programme dieser neuen Reformbewegungen und -organisationen zeigten oft deutliche Spuren von Antisemitismus; sogar bei den Kathedersozialisten konnte man sie finden. Wagner, einer ihrer bekanntesten Führer, war ein persönlicher Freund von Adolf Stoecker und übernahm für einige Jahre das Amt eines Ehrenvorsitzenden von Stoeckers Christlichsozialer Partei und die Präsidentschaft des Stoeckerschen Evangelisch-Sozialen Kongresses. Es war wohl nicht reiner Zufall, daß der Verein für Sozialpolitik in einer seiner ersten Studien das Problem des ländlichen Wuchers aufgriff; der vorgelegte Bericht hob die Rolle der Juden bei dieser Geißel der Bauernschaft hervor.
In einer Schrift des Königl. Stadtgerichtsrats C. Wilmanns trat die enge Verbindung von mittelständischer Sozialreform und Antisemitismus offen zutage. In »Die ›goldene‹ Internationale und die Notwendigkeit einer sozialen Reformpartei« befürwortete Wilmanns die Aufhebung der Macht des »Geldkapitals« gegenüber Landwirten, Handwerkern und kleinen Industriellen, und zwar sollte das durch eine neue Finanzpolitik erreicht werden. Er trat besonders für ein neues Landrecht ein. Es sollte das römische Recht ersetzen, das er als ein für eine freie Bauernschaft verderbliches Stadt- und Sklavenrecht bezeichnete. Seine Ansichten von der Notwendigkeit neuer Rechtsinstitutionen, welche »den Bedürfnissen und dem Charakter des Deutschen Volkes entsprechen«49), wurden später von den Rechtsphilosophen des Nationalsozialismus wieder aufgegriffen.
Alle diese Reformvorschläge zielten im wesentlichen darauf, das Vertrauen des Arbeiters in den Staat wiederherzustellen und die Position des kleinen Mittelstandes zu festigen. Der Widerhall, den die Bestrebungen der Reformer hervorriefen, war jedoch bei den beiden ungleich strukturierten gesellschaftlichen Schichten sehr verschieden.
Die Industriearbeiter hatten begonnen, das herrschende System mit steigendem Selbstvertrauen herauszufordern und durch ihre eigenen beruflichen, politischen und kulturellen Organisationen am Leben der Nation teilzunehmen. Sie erwarteten eine Verbesserung ihrer Lage aus eigener Kraft, nicht vom Wohlwollen eines Staates, der sich weigerte, die Herrschaft des Parlamentes anzuerkennen. Die entmutigten, entwurzelten und unorganisierten Mittelstandsgruppen dagegen waren nicht gewöhnt, auf sich selbst zu stehen; sie setzten ihre Hoffnung auf die Führung »starker Männer«.
Bis in die sechziger Jahre hatte sich der kleine Mittelstand den oberen Schichten des Bürgertums, die dem christlich-konservativen Staat noch immer feindlich gegenüberstanden, angeschlossen und die liberalen Bestrebungen unterstützt. Vom Liberalismus enttäuscht, unter starkem wirtschaftlichen Druck, begannen sie jetzt mehr und mehr, beim Staate Schutz und Gönnerschaft zu suchen. Ihrer Sache nahm sich ein Heer von Wortführern an, Geistliche und Professoren, Kurpfuscher und Besessene, verbitterte Journalisten und reaktionäre Romantiker. Ein evangelischer Pfarrer, Adolf Stoecker, war der erste, dem es gelang, die vielfältigen Klagen und Hoffnungen dieser Schichten zu kanalisieren. Er gab ihnen einen Namen, ein Ziel und eine politische Organisation (50).
Stoecker stammte selbst aus einer sehr bescheidenen Mittelstandsfamilie. Sein Vater hatte das Schmiedehandwerk gelernt, war ins Heer eingetreten und erwarb sich nach siebenundzwanzig Jahren Dienstzeit das Amt eines Gefängnisinspektors. Unter großen Entbehrungen brachten die Eltern es fertig, den 1835 geborenen Sohn durch Gymnasium und Universität zu schleusen. Er studierte Theologie, erwarb seinen Lebensunterhalt zuerst als Hauslehrer in ostpreußischen Adelsfamilien und wurde dann, nach den üblichen Anfangsstellungen in kleinen Gemeinden, Militärpfarrer. In Metz, bald nach der Annexion von Elsaß-Lothringen, fiel dem kaiserlichen Hof der patriotische Eifer des Divisionspfarrers auf; 1874 wurde er als Hof- und Domprediger nach Berlin berufen.
Seit seiner frühen Jugend hatte Stoecker eine Schwäche für den alten preußischen Adel, der für ihn die Gesellschaft verkörperte, in welcher sich christliche Tugenden und politische Prinzipien, persönliche und öffentliche Lebensführung ideal verbanden. Bei der Aristokratie glaubte er noch die Werte zu finden, die ihm alles bedeuteten: Liebe zum Vaterland, Ehre, Pflicht, Gehorsam und nicht zuletzt das Bewußtsein, daß der dem Adel zukommende Anspruch auf politische Herrschaft eine Verantwortung dem Volk gegenüber einschloß.
Stoeckers Amt und Persönlichkeit machten ihn zum rechten Mann für die Aufgabe, die er sich gesetzt hatte: die unteren Volksschichten in den christlich-konservativen Staat zurückzuführen. Als Hofprediger schien er auch für seine politische Tätigkeit die Billigung höchster Stellen zu finden. Durch seine engen Beziehungen zur Kreuzzeitung erhielt er Einfluß auf die angesehensten Gesellschaftskreise, und als Leiter der Berliner Stadtmission, der Wohlfahrtspflege der evangelischen Kirche, kam er in unmittelbare Berührung mit der großstädtischen Armut. Er war ein glühender Patriot (51), ein hervorragender Redner und unermüdlicher Arbeiter, von dem sein einstiger Schüler, der spätere Pazifist Hellmut von Gerlach, sagte, daß man ihm gegenüber nicht gleichgültig bleiben konnte: man mußte ihn hassen oder lieben52). Binnen weniger Jahre schmiedete Stoecker aus den Beschwerden des Mittelstandes, aus der Furcht vor der Sozialdemokratie und dem Haß gegen das »jüdische« Kapital eine machtvolle Bewegung.
Ein Brief, den Stoecker zur Rechtfertigung seiner sozialen und politischen Agitation 1878 an den Kronprinzen Friedrich schrieb (aber erst 1907, zwei Jahre vor seinem Tode, veröffentlichte), gibt uns einen ausgezeichneten Einblick in seine Beweggründe:
»… was mich trieb, war die Verzweiflung um mein armes Volk, das ich in den Abgrund rollen sah, und die Liebe zu den Seelen, die ich retten wollte … Seit beinahe zehn Jahren widme ich der sozialen Frage ein reges und ununterbrochenes Studium. In Berlin ergriff mich das Bewußtsein der Notwendigkeit, daß etwas geschehen müsse, um das Volk vom Abgrund zurückzurufen. Ich fand, daß Leute, die sich zur Kirche hielten, mit denen ich in freundschaftlicher Beziehung stand, dennoch mit den Sozialdemokraten stimmten, weil sie in dieser Partei die Vertretung ihrer Arbeiterinteressen erblickten. Da habe ich dann unter Gebet und Flehen den Entschluß gefaßt, mitten hinein in die Sozialdemokratie zu gehen, den wilden Stier bei den Hörnern zu fassen und mit demselben zu ringen … Seit fünfzehn Jahren ist das sozialistische Element der Köder, mit welchem die Arbeiter um ihren Glauben wie um ihren Patriotismus betrogen worden sind. Will man an ihre Herzen heran, so muß man die sozialen Dinge mitbesprechen.«53)
Stoecker nahm wirklich »den wilden Stier bei den Hörnern« in einer Massenversammlung, die in der Geschichte seiner Berliner Bewegung eine ähnliche Rolle spielt wie die erste Hitlersche Massenversammlung in München in der Geschichte der Nazibewegung (53a). Als Hauptredner war ein gewisser Emil Grüneberg angekündigt. Diesen Grüneberg, einen ehemaligen Schneider, hatte der Geschäftsführer der Berliner Stadtmission als einen augenscheinlich bekehrten Sozialdemokraten zu Stoecker geschickt. Stoecker, der für seinen Feldzug gegen die Sozialdemokratische Partei nach geeigneten Helfern suchte, nahm Grüneberg gern in Dienst, obwohl er über seinen zweifelhaften Charakter und seine Vorstrafen Bescheid wußte. Nach dem Polizeibericht war Grüneberg als sozialistischer Agitator Wohlhabende um Geld angegangen und aus der Sozialdemokratischen Partei ausgeschlossen worden; zweimal saß er im Gefängnis, zuerst wegen Majestätsbeleidigung, dann wegen Bettelei. Aber das hinderte den Hofprediger nicht, sich seiner zu bedienen (54). »Ohne einen Mithelfer aus den Arbeiterkreisen hätte ich die Sache nicht anfangen können«, bemerkte Stoecker nachträglich55).
Die Männer, die in den Eiskellersaal kamen, um Grüneberg zu hören, waren größtenteils Sozialdemokraten. Unter ihnen befand sich der Reichstagsabgeordnete Johann Most, einer der besten Redner der Partei und bekannt für seinen streitbaren Atheismus56). Die Sozialdemokraten bemächtigten sich sogleich der Versammlungsleitung, gewährten aber Redefreiheit. Grünebergs frömmelnde Plattheiten erregten nur Gelächter. Die Versammlung war nahe daran, statt zur Wiege der Christlichsozialen Arbeiterpartei ihr Grab zu werden. Da ergriff Stoecker das Wort. Seine Rede zeigte sofort, daß er auch eine feindselige Zuhörerschaft aufmerksam machen konnte. Er sprach zunächst von seiner eigenen niedrigen Herkunft; obwohl er jetzt den hohen Rang eines Hofpredigers habe, sei er doch selber aus der Welt der Arbeit gekommen und kenne ihr Elend. Dann beschrieb er die unheilvollen Auswirkungen der wirtschaftlichen Depression auf das Leben der Arbeiter und griff den Kapitalismus an, »diese Herrschaft der schrankenlosen Konkurrenz und des krassesten Egoismus«, die »von Krisis zu Krisis« führe. Als Abhilfe verlangte er soziale Reformen: Fürsorge für Arbeitsunfähige, Beschränkung der Frauen- und Verbot von Sonntagsarbeit. Schließlich drängte er die Arbeiter, seiner neuen Organisation beizutreten:
»Ich denke dabei an eine friedliche Organisation der Arbeit und der Arbeiter; ist diese geschaffen, dann kann man gemeinsam beraten und erstreben, was not tut. Aber das ist Ihr Unglück, meine Herren, Sie haben Ihren Sozialstaat im Kopfe. Und wenn man Ihnen die Hand bietet zu Verbesserungen, wenn man Ihnen helfen will, dann weisen Sie das höhnisch zurück und sagen: Wir sind mit nichts zufriedenzustellen, wir wollen den Sozialstaat. Damit verfeinden Sie sich die anderen Klassen, und der Haß verdirbt alles.
Ja, meine Herren, Sie hassen Ihr Vaterland. Aus Ihrer Presse glüht dieser Haß schrecklich heraus. Und das ist schlecht; das Vaterland hassen, das ist, wie wenn einer seine Mutter haßt. Auch haben Sie dazu keinen Grund. Gewiß ist auch bei uns nicht alles, wie es sein sollte; wir sind eben auf der Erde und nicht im Himmel. Aber dazu hat Ihnen das deutsche Reich das allgemeine Stimmrecht aus freien Stücken gegeben, damit Sie in Frieden mit den andern beraten und beschließen, was zum Besten dient. Nicht dazu dürfen Sie Ihr Recht mißbrauchen, daß Sie auf Zertrümmerung Ihres Vaterlandes sinnen, das ist unvernünftig und undankbar. Aber Sie hassen auch das Christentum, Sie hassen das Evangelium von der Gnade Gottes. Man predigt Ihnen Unglauben, man lehrt Sie den Atheismus und Sie trauen den falschen Propheten …«57)
Ein Sozialdemokrat, der sich auf dieser Versammlung zu der neuen politischen Anschauung bekehrte, schrieb später seine Eindrücke nieder. Die Zuhörer, berichtete er, wurden unruhig während Stoeckers Rede, bewahrten aber Disziplin und ließen ihn ausreden. Dann begann Johann Most unter wildem Beifall eine heftige Ansprache, in der er das Christentum angriff und die Geistlichkeit der Unterwürfigkeit vor den Ausbeutern bezichtigte.
Mit großer Mehrheit nahm die Versammlung einen Beschluß an, der die »christlichsozialen« Vorschläge zurückwies. Er lautete:
»In Erwägung, daß ein fast 1900 Jahre währendes Christentum nicht im Stande gewesen ist, das Elend, die äußerste Not der überwiegenden Mehrheit der Menschheit zu lindern, geschweige denn ihnen ein Ende zu machen; in fernerer Erwägung, daß die heutigen Diener der Kirche keine Miene machen, das seither von ihnen beobachtete Verfahren zu ändern; in schließlicher Erwägung, daß selbst jede wirtschaftliche Errungenschaft, sei sie groß oder klein, völlig ohne den gleichzeitigen unbeschränkten Besitz politischer Freiheit wertlos ist, und selbst bei Erfüllung des christlichsozialen Programms die Sache beim alten bleibt, dekretiert die Versammlung, daß sie lediglich und allein von der sozialdemokratischen Partei eine gründliche Beseitigung aller herrschenden politischen und wirtschaftlichen Unfreiheiten erhofft, und daß es ihre Pflicht ist, mit allen Kräften für die Lehren dieser Partei einzutreten und dafür zu wirken.«58)
Stoecker ließ sich durch den anfänglichen Mißerfolg nicht entmutigen, sondern fuhr fort, eine Reihe wöchentlicher Versammlungen einzuberufen; schließlich wurde »auf dem Boden des christlichen Glaubens und der Liebe zu König und Vaterland« seine Partei organisiert. Sie lehnte die Sozialdemokratie als »unpraktisch, unchristlich und unpatriotisch« ab, befürwortete »eine friedliche Organisation der Arbeiter, um in Gemeinschaft mit den anderen Faktoren des Staatslebens die notwendigen praktischen Reformen anzubahnen«, und sah ihr Ziel in der »Verringerung der Kluft zwischen reich und arm« und in der »Herbeiführung einer größeren ökonomischen Sicherheit« (59).
War das Programm der neuen Partei auch zusammengestückelt, so hatte es doch seine innere Logik. Es mußte radikal genug sein, um Arbeiter von der Sozialdemokratie wegzulocken, durfte sich aber andererseits wichtige Mächte in Staat, Regierung und Wirtschaft nicht zu Gegnern machen. An peinlichem Befremden und offener Warnung vor den Folgen seiner Tätigkeit fehlte es Stoecker nicht; er klagte oft über die mangelnde Einsicht seiner konservativen Freunde. Das sensationelle Ereignis, daß ein Hofprediger am Getümmel politischer Agitation teilnahm, mußte natürlich mancherlei Kritik hervorrufen. Die Würde des Thrones drohte in Mitleidenschaft gezogen zu werden, und die evangelische Kirche fürchtete, man könne sie in kritischen sozialpolitischen Fragen auf eine Stellungnahme festlegen, die nicht mit der Billigung konservativer Kreise rechnen durfte. Außerdem betrachteten die Konservativen die Gründung dieser neuen Partei als Verletzung ihrer traditionellen Interessen.
Um das Mißtrauen seiner konservativen Freunde zu beschwichtigen, mußte Stoecker ihnen vor Augen führen, welch bedrohliche Folgen die Einführung des Systems der allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen im Reich mit sich bringen könne. In Preußen war seit der Gegenrevolution 1849/50 der überwiegende Einfluß der Konservativen immer noch zweifach gesichert, durch die feudale Zusammensetzung der oberen Kammer des Landtages – des Herrenhauses – und durch das indirekte »Drei-Klassen-Wahlrecht« zum Abgeordnetenhaus (60).
Wollten aber die Konservativen ihren Einfluß außerhalb Preußens ausdehnen und ihre Macht im Reich befestigen, wo das gleiche Wahlrecht für die männliche Bevölkerung herrschte, so gab es dafür nur einen Weg: die Partei des landbesitzenden preußischen Adels, der Hofkreise, der Armee und der protestantischen Hierarchie mußte eine Massenpartei im Reich werden. Das erforderte manche Konzessionen, die den eingefleischten Konservativen mit ihrer tiefverwurzelten Abneigung gegen demokratische »Pöbelherrschaft« höchst widerwärtig waren. Aber selbst wenn sie sich bereit gefunden hätten, ihrer Partei ein demokratischeres Gesicht zu geben, wäre es den Konservativen nicht leicht gefallen, die neue Rolle als Freunde der unteren Stände zu spielen. Die Erinnerung an 1848 und die nachfolgende Reaktionszeit war noch zu lebendig. Stoecker bestand daher auf der Bildung einer eigenen Organisation, die zwar in Freundschaft und Bündnis mit den Konservativen operieren, aber doch unabhängig bleiben sollte in ihrem Bestreben, der Sozialdemokratie eine christliche Arbeiterpartei entgegenzustellen und ein Sammelbecken für die »wertvollen Elemente in der Welt der Arbeit« zu bilden.
Die Beziehungen zwischen Stoecker und den Konservativen waren nicht unähnlich denen, wie sie ein halbes Jahrhundert später in der »Kampfzeit« zwischen Hitler und den Deutschnationalen bestanden. Um politisch zu gedeihen, brauchte die Christlichsoziale Arbeiterpartei ebensosehr Bewegungsfreiheit wie die National-Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Es mußte ihr erlaubt sein, die privilegierten Schichten zu kritisieren und im Namen der Unterdrückten zu sprechen. Als »Anhängsel der konservativen Fraktion« konnten die Christlichsozialen keinen Erfolg haben. Die Arbeiter verlangten eine unabhängige Organisation zur Verteidigung ihrer Interessen. Wollte Stoecker dieses Versprechen geben, so mußte er die Freiheit haben, soziale Forderungen zu vertreten, auch wenn sie gegen Vorrechte verstießen, welche die Konservativen zu verteidigen entschlossen waren. Konflikte dieser Art sind unvermeidlich, wo ein Agitator zwei divergente politische Richtungen verkoppeln will. In den dauernden Reibungen und dem steten Mißtrauen, zu denen sie führen, drücken sich die objektiven Gegensätze der Kräfte aus, die der Agitator zu einigen unternommen hat.
So paradox es klingen mag, es war das Verlangen nach Demokratisierung des Staates, das bei der in Deutschland vorherrschenden Gesellschaftsschichtung dem politischen Antisemitismus den größten Antrieb gab. Die Feinde der Demokratie mußten sich schon damals demokratischer Methoden bedienen, um die alte Machtstruktur aufrechtzuerhalten. Der von der Aristokratie verachtete und gefürchtete städtische »Pöbel« war ein Machtfaktor geworden, soweit politische Entscheidungen von allgemeinen Wahlen abhingen. Man konnte die Organisierung der Massen nicht länger einfach dem Liberalismus oder Sozialismus überlassen. Stoecker erkannte das deutlich. Am 1. April 1881 sagte er in einer öffentlichen Versammlung in Stuttgart:
»Es gibt konservative Schichten, die sind so vornehm kühl, daß sie meinen, es schicke sich nicht, in Volksversammlungen hineinzutreten und da im Staube des Schlachtfeldes Kämpfe auszufechten … Wir haben den Gegnern die Positionen des Volkslebens überlassen; nun stehen sie auf den Höhen mit dem ganz groben und feinen Geschütz der Presse, der Volksversammlungen ausgerüstet; und wir müssen eine Stellung nach der anderen erst wieder zurückerobern … Was gerade den Konservativen fehlt, das sind große, das ganze Volksleben umfassende, anregende, bewegende Gedanken. Die anderen Parteien haben solche Gedanken gehabt; der Nationalliberalismus hatte die nationale Einheit, er hatte den großen Begriff der persönlichen Freiheit … Die Einheit haben wir, und der Freiheit mehr als zuviel. Auf dem Boden der Freiheit suchen wir heute wieder mehr Ordnung herzustellen, heute werden es andere als jene liberalen Gedanken sein, die unserem Volk eingehaucht werden müssen. Ich glaube, sie bewegen sich um diese beiden Worte ›christlich und sozial‹«.61)
Die Demokratisierung des Staates erhöhte gleichzeitig die Chancen, als Gegenmaßnahme gegen die demokratische Mehrheitsherrschaft eine Massenbewegung von rechts organisieren zu können. Der anonyme, von Rang und Stand unabhängige Stimmzettel erschien nicht nur der Aristokratie als ein Ausdruck sozialer Gleichmacherei. Daß bei den Wahlen die Stimme eines Arbeiters, eine Sozialdemokraten, eines Juden, eines arbeitslosen Taugenichts ebensoviel gelten sollte wie die Stimme achtbarer Leute – die von Beamten, Lehrern, Gewerbetreibenden und Landwirten – war auch standesbewußten Mittelstandsgruppen unerträglich. Sie weigerten sich, die peinliche Tatsache hinzunehmen, daß das industrialisierte Deutschland ihnen nicht mehr die Stellung einräumte, deren sie sich in den idyllischen Zeiten der Kleinstaaterei erfreuen durften. Über die Minderung ihres gesellschaftlichen Ansehens konnten sie sich mit defensiven Ideologien trösten; der Verlust der wirtschaftlichen Sicherheit jedoch ließ sich nur durch politischen Druck kompensieren. Voraussetzung dafür war politische Organisierung. Die Konservativen, die sich nach Massenunterstützung umsahen, trafen auf Mittelstandsgruppen, die ihrerseits darauf drängten, »in die Politik zu gehen«.
In der ersten Phase seiner politischen Laufbahn hatte Stoecker offen den Kampf gegen die Sozialdemokratie als die Hauptaufgabe seiner Partei bezeichnet. In dem oben erwähnten Brief an den Kronprinzen Friedrich von 1878 schrieb er:
»Wir stehen eben vor der Wahl. Ich denke nicht daran, einen Sitz im Reichstag zu erhalten, aber ich denke, wir werden in den drei Wahlkreisen, in denen die Sozialdemokraten mächtig sind, soviel Arbeiterstimmen absplittern, daß die Sozialdemokratie nicht siegt. Sollten wir diesen Erfolg haben, so würde jeder die Richtigkeit unserer Aktion anerkennen müssen.«62)
Stoeckers Hoffnungen sanken, als die Wahlen mit einer völligen Niederlage der Christlichsozialen Arbeiterpartei endeten. In ganz Berlin erhielten Stoeckers Kandidaten weniger als 1500 Stimmen, die der Sozialdemokraten dagegen 56000. Der Versuch, die revolutionäre Organisation der Arbeiter durch eine konservativ-klerikale zu ersetzen und das Berliner Proletariat wieder mit Kirche und Staat zu versöhnen, war gescheitert.
Damit trat Stoeckers Bewegung in eine neue Phase. Ihr Programm enthielt zwar weiterhin die Forderung nach arbeiterfreundlichen Sozialreformen, aber die Partei nahm nach 1878 sehr schnell einen anderen Charakter an: »christlichsozial« wurde gleichbedeutend mit »antijüdisch«. Mit dem Angriffsziel der Partei wandelte sich auch ihre politische Anziehungskraft. 1881 verschwand das Wort »Arbeiter« aus ihrem Namen; sie nannte sich jetzt einfach Christlichsoziale Partei und gestand damit, daß der Angriff auf die Sozialdemokratie mißlungen war. Stoeckers Partei setzte sich fast nur noch aus Angehörigen des kleinen Mittelstandes zusammen.
Stoecker hatte die Versöhnung von Staat und Proletariat vor Augen gehabt; durch systematische Staatsintervention sollte das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit menschlicher gestaltet werden; dafür hätten die Arbeiter die Autorität des christlichen Staates anzuerkennen. Weltanschaulich richtete sich dieses Programm gegen den Wirtschaftsliberalismus. Einige seiner Forderungen, wie Börsensteuer oder Wiedereinführung von Gesetzen gegen Wucherei, ließen erkennen, daß es den Liberalismus mit jenen wirtschaftlichen Übeln identifizierte, die man jüdischen Geschäftsmethoden zuzuschreiben pflegte. Solange Stoecker sich jedoch hauptsächlich an die industrielle Bevölkerung wandte, stand der Antisemitismus nicht im Vordergrund seiner Agitation. In der Parteiliteratur fanden sich in der Anfangsphase der Bewegung nur gelegentlich Äußerungen prinzipiell antisemitischen Charakters. So hieß es in einem Flugblatt, das Stoecker während des Wahlkampfes 1878 verteilte:
»Wir achten die Juden als unsere Mitbürger und ehren das Judentum als die untere Stufe der göttlichen Offenbarung. Aber wir glauben fest, daß ein Jude weder in religiöser noch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Führer deutscher Arbeiter sein kann. Die Christlich-soziale Arbeiterpartei schreibt das Christentum auf ihre Fahne …«63)
Wer um die Arbeiter warb, durfte sich nicht auf eine offen antisemitische Agitation einlassen. Seit die Sozialdemokratie ihren Anhängern einhämmerte, daß es gleichgültig sei, ob ihre Ausbeuter jüdische oder christliche Kapitalisten seien und daß eine Judenhetze nur antirevolutionäre Zwecke verfolge, waren den Arbeitern antisemitische Demagogen verdächtig. Tatsächlich hatte der ungehemmte Antisemitismus seiner eigenen Parteigänger Stoecker häufig in Verlegenheit gesetzt, und er mußte ihre Ausbrüche auf seinen Parteiversammlungen mehr als einmal eindämmen. Erst am 19. September 1879, als die Aussichtslosigkeit des Versuchs, die Sozialdemokratie zu schwächen, offenbar geworden war, startete er seinen ersten unverbrämten antisemitischen Angriff mit einer Rede über »Unsere Forderungen an das moderne Judentum« (64).
Die Rede verschlug dem politischen Leben Berlins den Atem. Stoeckers Agitation bekam neuen Auftrieb, seine schwache Partei erwies sich plötzlich als eine Kraft, mit der man rechnen mußte. Von 1879 bis in die Mitte der achtziger Jahre hielt die sogenannte Berliner Bewegung, mit Stoecker als ihrem hervorragendsten Führer, die Hauptstadt in Aufruhr. Ihr Gedankengut war ein Gemisch aus christlichsozialen, konservativen, orthodox-protestantischen, antisemitischen, sozialreformerischen und staatssozialistischen Elementen. Das Konservative Zentralkomitee wurde ihr Hauptquartier; Handwerker, Büroangestellte, Studenten, untere Beamte, kleine Geschäftsleute und andere Mittelständler stellten den größten Teil ihrer Anhängerschaft.
Das Ziel, das Stoecker sich gesetzt hatte, trieb ihn dazu, den Antisemitismus zum Mittelpunkt seiner Agitation zu machen. Zwar war es ihm mißlungen, die Sozialdemokratische Partei zu verdrängen oder ihre Wählerschaft zu spalten, aber die Regierung hatte sich dieser Bedrohung auf ihre eigene Weise entledigt. 1878 war die Sozialdemokratie für gesetzwidrig erklärt worden; sie konnte nur noch unterirdisch weiterarbeiten. Der politische Liberalismus war jetzt der Hauptgegner, und im Kampf gegen »jüdischen Liberalismus« gab es keine bessere Waffe als Antisemitismus. Hinzu mag gekommen sein, daß Stoecker aus Furcht, von anderen Agitatoren überflügelt zu werden, den antisemitischen Kurs einschlug. Sein Freund und Biograph Oertzen stellt fest: »Die Notwendigkeit des Kampfes [gegen die Juden] ergab sich aus dem überschäumenden Interesse, das er erweckte. Tausende von Zeitungsartikeln, hunderte von Broschüren, ungezählte starke Bücher wurden verfaßt, um die [jüdische] Frage zu erörtern und klare Ziele herauszuarbeiten.«65)
Stoecker selber betrachtete sich nie als Antisemiten; sein erklärtes Ziel war, die Flamme des Christentums in den Herzen seiner Anhänger zu schüren und seine Bewegung auf den Felsen des christlichen Glaubens zu gründen, nicht auf den Haß gegen die Juden. Am 23. September 1880 schrieb er dem Kaiser:
»Im übrigen habe ich in allen meinen Reden gegen das Judentum offen erklärt, daß ich nicht die Juden angreife, sondern nur dies frivole, gottlose, wucherische, betrügerische Judentum, das in der Tat das Unglück unseres Volkes ist.«66)
Offenbar aber lockten seine antijüdischen Attacken und seine mittelständlerischen Forderungen mehr Zuhörer an als der christliche Inhalt seiner Reden (66a). Stoeckers Biograph Frank ermittelte aus Polizeiakten, wie stark der Besuch verschiedener seiner Veranstaltungen war67):
| DATUM | THEMA | BESUCHERZAHL |
| 5. März1880 | König Hiskia und der Fortschritt | 1000 |
| 9. April1880 | Die Judenfrage | 2 000 |
| 30. April1880 | Ist die Bibel Wahrheit? | 500 |
| 24. September 1880 | Die Judenfrage | 2 000 |
| 19. November1880 | Das Dasein Gottes | 1000 |
| 17. Dezember1880 | Das Alte und Neue Testament | 700 |
| 21. Januar1881 | Das Handwerk einst und jetzt | 2 500 |
| 28. Januar1881 | Die Sünden der schlechten Presse | 3 000 |
| 4. Februar1881 | Die Judenfrage | 3 000 |
| 11. Februar1881 | Obligatorische Unfallversicherung | 3 000 |
Wie tief die öffentliche Meinung aufgerührt war von dem Kampf gegen die Juden, geht aus der zeitgenössischen Literatur hervor. Wawrzinek stellt in seiner Studie »Die Entstehung der deutschen Antisemitenparteien (1873–1890)«68) eine Bibliographie von über fünfhundert Büchern, Broschüren und Artikeln aus jener Zeit zusammen, die sich ausschließlich mit der »Judenfrage« beschäftigen. Was sich in diesen Jahren in Berlin ereignete, wirkt wie ein Vorspiel zu dem, was fünfzig Jahre später geschehen sollte. Zwei Berichte – einer aus christlicher, der andere aus jüdischer Feder – mögen das politische Klima der Reichshauptstadt veranschaulichen. 1885 schrieb ein Berliner Mitarbeiter der Christlichen Monatsschrift in Barmen:
»Welche Wendung in Berlin vor sich gegangen ist, kann nur derjenige würdigen, der die Stadt zehn Jahre nicht gesehen und plötzlich wieder hineinversetzt wird. Er würde schon staunen, wenn er in ein kleines bescheidenes Restaurant eintritt und hier den ›Reichsboten‹ nicht bloß ausgelegt, sondern auch von dem kleinen Handwerker und Arbeiter begierig gelesen findet. Er müßte, bei den Erinnerungen an ehemals, wo man in diesen Kreisen das reaktionäre Blatt samt seinem Leser zur Tür hinausgeworfen hätte, sich geradezu an die Stirn fassen, ob er nicht träumt. Er würde dasselbe tun müssen, wenn er die Zeitungsfrau in das Hintergebäude drei oder vier Treppen hoch das ›Deutsche Blatt‹ tragen sieht. Ist denn da oben unter dem Dach nicht mehr die exklusive Domäne der ›Volkszeitung‹? Woher der Eindringling? Nun, er kommt von Stoecker und keinem anderen. Er hat die Umwandlung bewirkt. Der Fremde, der zehn Jahre lang Berlin nicht gesehen hat, sieht plötzlich gegen Abend das Gedränge in den Straßen eines Stadtviertels immer dichter werden. Er läßt sich vom Strom mit fortreißen und kommt in eine konservative Wahlversammlung. Tausende sind versammelt, Tausende müssen aus Mangel an Platz draußen zurückgehalten werden. Alle Stände sind vertreten, vom Arbeiter hinauf bis zum Offizier in Zivil und bis zu dem auf einer Tribüne hinter einer Säule sich nur schlecht verbergenden Minister. Es geht ein lebhaftes Geflüster durch die des Redners harrende Versammlung. Mit einemmal wird es still, dann atemlos still und dann wieder stürmisch laut. Hofprediger Stoecker ist in den Saal getreten, und ein donnerndes Hoch aus den Tausenden von Kehlen, ein Hoch, das nicht enden will, empfängt den populärsten Mann Berlins, einen Hofprediger! Der Fremde denkt nach, er verweilt mit seinen Gedanken bei jener konservativen Versammlung, die er vor zehn Jahren besucht hatte. Er hat davon noch die Empfindung einer Krankenstube. Vornehmer war die damalige Versammlung, aber klein und gichtbrüchig. Wer hat dieses Wunder vollbracht?«69)
Der andere Bericht stammt von dem nationalliberalen Reichstagsabgeordneten Bamberger; als er 1883 von einer mehrmonatigen Auslandsreise nach Berlin zurückkehrte, schrieb er angeekelt in sein Tagebuch:
»Gleich in den ersten Tagen hörte ich im Vorübergehen zweimal gemeine Äußerungen über Juden, ohne daß damit eine Absicht auf mich im Spiele war, sondern nur weil mein Ohr sie erhaschte. Einmal waren es sogar Arbeiter. Jetzt, nach längerem Aufenthalt, ist man wieder aguerri. Ich sage, man muß nicht hinaus, damit der Gestank nicht weicht, wenn man einmal die Nase voll hat. Lüftet man sich, so muß man das Experiment von neuem durchmachen.«70)
Warum fand Stoeckers Agitation gerade um diese Zeit so großen Widerhall? Gründe für die Dynamik des Antisemitismus können nur in der Dynamik der Gesellschaft gefunden werden. 1870 war ganz Deutschland freihändlerisch71). In erster Linie war Preußen damals bestrebt, Beschränkungen des Binnenhandels aus dem Wege zu räumen und die dafür notwendige Einheitlichkeit der Gesetzgebung zu erreichen. Jeder Schritt zur wirtschaftlichen Einheit Deutschlands bedeutete einen preußischen Sieg im Kampf um die »kleindeutsche« Lösung.
Als Großproduzenten von Exportgetreide traten die preußischen Konservativen natürlich für Freihandel ein. »Der Schutzzoll ist der Schutz gegen die Freiheit der Inländer, da zu kaufen, wo es ihnen am wohlfeilsten und bequemsten scheint, also ein Schutz des Inlandes gegen das Inland.« Diese typisch manchester-liberale Gesinnung vertrat im Oktober 1849 ein Junker vor dem preußischen Abgeordnetenhaus – es war Bismarck72). Wie überall führte auch in Deutschland die Industrialisierung zu erhöhtem Verbrauch von Konsumgütern, also zu steigenden Getreide- und Bodenpreisen. Die Preissteigerung Anfang der siebziger Jahre veranlaßte Agrarier, mehr Land unter den Pflug zu nehmen und Verarbeitungsbetriebe anzugliedern. Die dafür nötigen Investitionen verschafften sie sich durch Aufnahme von Krediten. Dann brach der Markt zusammen. In anderen europäischen Ländern und in Übersee war es nicht anders; auch in den Vereinigten Staaten wurden die Landwirte von ihren Gläubigern – den Bankiers der Ostküste – bedrängt und mußten den Staat um Intervention bitten, aber ihre Beschwerden gegen »Wall Street« hatten nicht den antijüdischen Unterton, der die Beschuldigungen der deutschen Landwirte gegen die »Börsenmächte« charakterisierte.
Teilweise war das Fallen der Getreidepreise durch die Industriekrise in Deutschland verursacht, teilweise aber auch durch die Überflutung des ungeschützten deutschen Marktes mit amerikanischem und russischem Weizen. In Deutschland wie überhaupt in Mittel- und Westeuropa herrschte in der Landwirtschaft die intensive Bodenbearbeitung. Um die Mitte des Jahrhunderts hatten wissenschaftliche und technische Fortschritte diesem Verfahren weiteren Aufschwung gegeben. Die hohen Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse führten zu neuen Investitionen, um den Bodenertrag zu steigern. Seit den siebziger Jahren mußte die intensive Bebauungsweise mit der extensiven Methode in Konkurrenz treten, die sich auf den grenzenlos erscheinenden Flächen freien Landes in Übersee entwickelt hatte. Eisenbahn und Dampfer ermöglichten es jetzt, die amerikanische Ernte zu konkurrenzfähigen Preisen nach Europa zu werfen. Deutschland begann, Getreide einzuführen. Hatten die konservativen Grundbesitzer anfangs nur zögernd nach Schutzzollpolitik gerufen, so taten sie das seit der Mitte der siebziger Jahre mit steigendem Nachdruck.
In der Industrie fand eine ähnliche Entwicklung statt. Durch die Einverleibung von Elsaß-Lothringen war Deutschland in den Besitz von profitablen, technisch fortgeschrittenen Industrien gelangt. Die dortige Textilindustrie zum Beispiel verfügte über mehr als einhalbmal so viele Baumwollspindeln und über fast die gleiche Zahl mechanischer Webstühle wie das ganze Reich73). Deutschland hatte auch Eisenerzvorkommen in Lothringen und Kalilager im Elsaß erworben, beide von größtem Wert für die Entwicklung der deutschen Schwerindustrie. Damals glaubte man so fest an die Vorteile des Freihandels, daß die Meistbegünstigungsklausel in den Friedensvertrag mit Frankreich aufgenommen wurde. Um seinen internationalen Handelsverpflichtungen nachkommen zu können, hob Deutschland 1873 den Einfuhrzoll für Roheisen, Schrott und Schiffbaumaterial auf. Der Zoll, der auf Halbfabrikaten und Maschinen lag, wurde ermäßigt, nach vier Jahren sollte er ganz wegfallen. Diese Freihandelspolitik fand die Unterstützung der Konservativen. Einer von ihnen erklärte 1873 im Reichstag: »Nächst dem Brot und Fleisch ist nichts wichtiger als freies Eisen.« Im selben Jahre nahmen mehrere hundert landwirtschaftliche Vereinigungen an einer Riesendemonstration teil, die gegen die Beibehaltung des Zolles auf Roheisen protestierte74).
Kaum erst war die deutsche Schwerindustrie fähig geworden, mit der von Großbritannien, ihrem überlegenen Rivalen in Europa, zu konkurrieren (75), als die Engländer sich durch die internationalen Stagnationstendenzen veranlaßt sahen, in den ungeschützten deutschen Markt einzudringen. Die erhöhte Konkurrenz überzeugte daraufhin manchen eingefleischten Manchesterliberalen, daß eine »nationale« Handelspolitik an die Stelle des international orientierten Freihandels treten müsse. Der Ruf nach neuen Zöllen auf Eisen- und Stahlprodukte gesellte sich den Stimmen der bedrängten Landwirte zu.
Ohne gegenseitige Unterstützung konnten weder die Getreide produzierenden Junker noch die Schwerindustrie hoffen, die Schutzzollgesetzgebung durchzusetzen. Zwar wünschten die Industriellen niedrige Preise für Nahrungsmittel und die Agrarier niedrige Preise für Industrieprodukte, aber schließlich mußten beide Gruppen sich überzeugen, daß ein Kompromiß unumgänglich war. Um ihrer eigenen Interessen willen unterstützten die Agrarier die Schutzzollforderungen der Schwerindustrie, und die Schwerindustrie ihrerseits förderte der Landwirtschaft genehme Zolltarife. 1878 war mit der Annahme eines neuen Zolltarifs die kurze Ära des Freihandels beendigt und zugleich der Grundstein gelegt für das politische Bündnis zwischen Schwerindustrie und Großagrariern, das fortan Deutschlands wirtschaftliche und soziale Entwicklung lenken und seine auswärtige Politik entscheidend beeinflussen sollte.
Schutzzöllnerische Wirtschaftspolitik gab es nicht nur in Deutschland, aber in keinem anderen Industrieland zeitigte sie so drastische politische Folgen. Der Zusammenbruch der Freihandelsidee untergrub das Prestige des politischen Liberalismus, der ja mit den Freihandelsparteien eng verbunden war. Konservative Tendenzen konnten ihren Einfluß in dem Maße vergrößern, in dem der Obrigkeitsstaat seine Macht erweiterte. Der politische Druck, den die Anhänger des Schutzzolls auf die Regierung ausübten, störte den Reichskanzler wenig, obwohl er sich selber einst zu den Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus bekannt hatte. Niemals ließ sich Bismarck durch ideologische Neigungen oder politische Verpflichtungen von seinem eigentlichen Ziel, dem Ausbau der zentralisierten Reichsgewalt, ablenken. Wo es um dieses Ziel ging, scheute er vor nichts zurück. 1866 hatte er die preußischen Konservativen vor den Kopf gestoßen, indem er den König von Hannover entthronte und damit die geheiligten Rechte der Dynastien in Frage stellte; 1872 hatte er die ostpreußischen Junker verstimmt, indem er mit einer neuen Kreisordnung ihre alten Vorrechte in der ländlichen Selbstverwaltung aufhob; er hatte seine Gegner gedemütigt, indem er einen »Pairsschub« vornahm, das heißt fünfundzwanzig neue Mitglieder des Herrenhauses vom König ernennen ließ, um sein Reformgesetz durchzusetzen; er hatte konservative kirchliche Kreise verärgert, indem er hohe katholische Würdenträger einsperren ließ, als er zu der Überzeugung gekommen war, daß die Sonderinteressen der katholischen Kirche die Reichsautorität bedrohten. Während all dieser Jahre waren die Liberalen dem Kanzler treu geblieben, voller Jubel über jeden Schritt, mit dem er die Einheit des Reiches und die Zentralisierung der Regierung förderte. Dennoch gab es ein Spannungsfeld: selbst während der Jahre engster Zusammenarbeit führten die Liberalen einen stillen Krieg mit Bismarck um die Struktur der zentralistischen Regierung, um die Frage der autokratischen oder parlamentarischen Herrschaftsform.
Eine schwerwiegende Konzession an demokratische Forderungen war dem Kanzler 1867 abgerungen worden, als er mit den Nationalliberalen über die künftige Reichsverfassung verhandelte, nämlich das Recht des Reichstages, die Regierungsausgaben zu bewilligen. Man konnte es Bismarck nicht vergessen, daß er sich 1862 im »Verfassungskonflikt« mit dem preußischen Landtag kurzerhand über die Ablehnung seines Haushaltsplanes hinweggesetzt und vier Jahre lang ohne Etatbewilligung regiert hatte. Nach der Reichsgründung stellte sich bald heraus, wodurch des Kanzlers autokratische Hand zurückgehalten wurde: er brauchte eine Reichstagsmehrheit, die seiner Heeresvorlage zustimmte.
Es war schon zu Reibungen zwischen Bismarck und seinen nationalliberalen Freunden gekommen, als er 1869 eine Anleihe forderte, um die Flotte des Norddeutschen Bundes auszubauen. Ein Kompromiß beendete diesen Konflikt, und 1871 stimmten die Nationalliberalen dafür, daß der Reichstag, wie Bismarck wünschte, den Heeresetat auf vier Jahre im voraus genehmigte. 1874 mußte wieder eine Entscheidung getroffen werden; die Nationalliberalen waren zwar bereit, die von der Regierung beantragten zusätzlichen Ausgaben zu bewilligen, Bismarck jedoch verlangte ein »Äternat«, das heißt eine Blankoermächtigung der Regierung für Heeresausgaben auf unbestimmte Zeit. Dem Reichstag sollte nur das Recht verbleiben, die Stärke der Friedensarmee gesetzlich festzulegen, um dann innerhalb dieser Grenzen alle Ausgaben dem Ermessen der Regierung zu überlassen. Die Annahme dieses Vorschlags durch die Nationalliberalen hätte dem Parlament sein wichtigstes Vorrecht genommen: die jährliche Kontrolle des Staatshaushaltes, wozu nicht einmal der rechte Flügel des deutschen Liberalismus bereit war. Statt dessen wurde ein neuer Kompromißvorschlag ausgehandelt: das »Septennatsgesetz« erteilte dem Kanzler die Ermächtigung, die er dem Reichstag auf immer abzuzwingen versucht hatte, in abgeschwächter Form auf sieben Jahre. Diese Vorausgenehmigung wurde mit 224 gegen 146 Stimmen angenommen. Des nationalen Prestiges wegen hatten viele Fortschrittler, die Nationalliberalen aber ohne Ausnahme dafür gestimmt.
Das Septennat – es wurde 1880 erneuert – bedeutete einen Sieg für Bismarck, aber der Kampf um seine Annahme hatte wieder den Sprung im Unterbau des Reiches bloßgelegt: die Unvereinbarkeit des Prinzips des Obrigkeitsstaates mit dem der Mehrheitsherrschaft, ein Gegensatz, der sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens zeigte. Jede Äußerung gegen die Staatsautorität, sei es in der Kunst, der Politik, der Erziehung oder den Sozialwissenschaften, wurde als Bedrohung des Regimes angesehen. Besonders die liberale und sozialistische Presse ging dem Kanzler gegen den Strich und erregte leidenschaftlichen Haß in allen konservativen, christlichsozialen und »national gesinnten« Kreisen, denen die ganze »jüdische Journaille« als Nährboden autoritätsfeindlicher Gesinnung galt. Kritik an der Obrigkeit mußte als umstürzlerisch und unpatriotisch verdammt werden.
Dennoch weigerte sich der Reichstag 1874 und 1876, Gesetzesvorlagen des Kanzlers zuzustimmen, mit denen er die sozialdemokratische Presse zum Schweigen bringen wollte. Schnell war die junge sozialistische Arbeiterbewegung angewachsen, trotz aller Hindernisse, die ihr die Regierung in den Weg legte. Ende der siebziger Jahre schon mußte der Bismarcksche Staat in der Sozialdemokratischen Partei seinen wichtigsten und gefährlichsten Gegner sehen. Einer der Hauptgründe des Kanzlers für den Kurswechsel in seiner Innenpolitik war sein Entschluß, sich dieser revolutionären Bedrohung zu entledigen. Aber solange die beiden liberalen Parteien, Fortschrittler und Nationalliberale, sich gegen jede Ausnahmegesetzgebung sträubten, konnte Bismarck sein antisozialistisches Programm nicht durchsetzen. Der Widerstand der Liberalen mußte gebrochen werden.
Bismarck gelangte zum Ziel mit Hilfe eines politischen Zwischenfalls, bei dem es ihm meisterhaft gelang, sich die wirtschaftliche Unzufriedenheit, kulturelle Erbitterung und politische Furcht, die im deutschen öffentlichen Leben lauerten, zunutze zu machen. Am 11. Mai 1878 verübte der Klempnergeselle Hödel, ein Halbirrer, der kurze Zeit der Christlichsozialen Partei angehört hatte, jetzt aber von der Polizei als Sozialdemokrat bezeichnet wurde, ein mißglücktes Attentat auf Kaiser Wilhelm I. Das war die Gelegenheit, auf die Bismarck gewartet hatte. Als der Kanzler von dem Mordanschlag unterrichtet wurde, soll er triumphierend ausgerufen haben: »Jetzt haben wir sie.« »Die Sozialdemokraten, Durchlaucht?«, wurde er gefragt. »Nein«, antwortete er, »die Liberalen.«76)
Sofort brachte der Kanzler im Reichstag eine Gesetzesvorlage ein, die auf das Verbot der Sozialdemokratischen Partei hinzielte. Die Liberalen, glaubte er, könnten es sich jetzt, wo es um die Bestrafung einer »Mörderpartei« ging, nicht mehr leisten, für die Unverletzlichkeit von Bürgerrechten einzutreten. Aber er hatte sich verrechnet. Die Vorlage wurde abgelehnt, mit den Stimmen der meisten Nationalliberalen. Drei Wochen später verübte ein Anarchist, Nobiling, ein zweites Attentat auf den Kaiser; dieses Mal wurde der Monarch ernstlich verletzt. Die öffentliche Entrüstung war groß. Obwohl der Reichstag erst am 10. Januar 1877 gewählt worden war, löste Bismarck ihn sofort wieder auf und schrieb Neuwahlen aus. Jede Opposition wollte er in einer patriotischen Kampagne für »König und Vaterland« ersticken; alle Kräfte, die ihm im Wege standen, galten als Vaterlandsfeinde, als umstürzlerische Internationalisten, als Freunde und Beschützer von Mördern; die liberalen Elemente in der Beamtenschaft wurden eingeschüchtert; es sei ein Schaden für das Land, ließ der Kanzler verlauten, wenn so viele Anwälte, Beamte und Gelehrte – »Männer ohne produktive Berufe« – im Reichstag säßen.
Die Kampagne »gegen den roten Terror« führte zur Auslöschung der liberalen Reichstagsmehrheit in den Wahlen vom 30. Juli 1878. Die Nationalliberalen, die schon 1877 von 152 Abgeordneten auf 127 gefallen waren, brachten es nur noch auf 98 Sitze, die Fortschrittler auf 26 gegenüber 35 im Jahre 1877 und 49 im Jahre 1874. Die Konservativen dagegen erhielten 59 Mandate, während sie 1877 nur 40, 1874 sogar nur 21 hatten erringen können; die Mandate der Freikonservativen stiegen von 33 bzw. 38 in den vorigen Wahlen auf 56. Die Zentrumspartei konsolidierte ihre früheren Erfolge; sie behielt ihre 93 Sitze von 1877; schon 1874 waren es 91 gewesen (77). Jetzt konnte die Regierung auch mit den Konservativen und mit dem Zentrum regieren.
Die entmutigten Nationalliberalen gaben ihren Widerstand auf. Als Bismarck eine neue, nodi schärfere Gesetzesvorlage gegen die Sozialdemokratie einbrachte, stimmten sie für die Ausnahmegesetzgebung und halfen mit, das »Gesetz wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« vom 21. Oktober 1878 durchzubringen. Dieses berüchtigte »Sozialistengesetz« erklärte die Partei für gesetzwidrig und ermächtigte die Polizei zur Auflösung »sozialdemokratischer Vereine« – nämlich der Partei-Ortsgruppen – und von »Vereinen, in denen solche Bestrebungen zutage treten«; Gewerkschaften, Arbeiterclubs und praktisch alle sonstigen Organisationen waren damit der Polizeiwillkür ausgeliefert. Den Anhängern der Sozialdemokratie wurde Presse- und Versammlungsfreiheit genommen; die Polizei war befugt, »Agitatoren« (das heißt alle, in denen sie eine Gefahr für Ruhe und Ordnung sah) aus den Großstädten auszuweisen. Das Aufstellen von Wahlkandidaten blieb den Sozialisten jedoch gestattet, das Abhalten von Wahlversammlungen auch, aber nur in Anwesenheit der Polizei.
Viermal wurde das ursprünglich bis zum 31. März 1881 befristete Gesetz verlängert, jedesmal mit den Stimmen der Nationalliberalen. In ihrer Hoffnung, sich durch Zustimmung zum Sozialistengesetz die Gunst Bismarcks wieder erkaufen zu können, sahen sie sich jedoch schwer getäuscht. Sie hatten ihren politischen Feinden nur einen neuen Beweis dafür geliefert, daß es nicht mehr möglich war, gegen den Nationalismus, gegen bedingungslose Treue zu Kaiser und Reich, zu opponieren. Die konservativ-monarchischen Kräfte konnten ihre Ernte einbringen.
Kaum hatte Bismarck die Sozialdemokratie aus dem Wege geräumt, als er sich anschickte, den Liberalismus vollends niederzuringen. Die Regierung begann eine systematische Konsolidierung der Staatsverwaltung und eine Reorganisierung des Beamtentums, aus dem alle »unzuverlässigen«, das heißt alle liberalen Elemente entfernt wurden; besonders das Heer sollte vor Ansteckung durch den Liberalismus geschützt werden78). Die Konservativen aller Richtungen und das Zentrum–Bismarcks neue Reichstagsmehrheit – nahmen die Vorlage für eine neue Wirtschaftsund Sozialgesetzgebung an. Ideologisch und wirtschaftlich einigte diese Politik die Kräfte, die unter der Autorität von Thron und Altar einen »christlich-nationalen Staat« wünschten. Der Liberalismus, in die Enge getrieben durch die manipulierte Angst vor der sozialistischen Revolution, hatte ausgespielt. Sein rechter Flügel, die Nationalliberalen, war seitdem stets bereit, sich auf die Seite der herrschenden Macht zu schlagen, falls diese ihn überhaupt als Partner akzeptieren wollte. Die zusammengeschrumpfte Fortschrittspartei – »Vorfrucht der Sozialdemokratie« hatte Bismarck sie genannt79) – kam als Teilnehmer an einer parlamentarischen Mehrheit sowieso nicht in Frage.