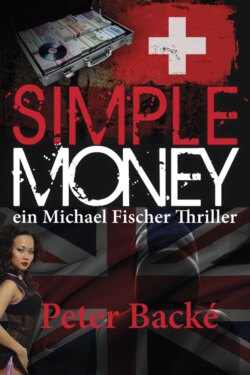Читать книгу Simple Money - Peter Backé - Страница 11
6
ОглавлениеIm Hochtaunus, am selben Tag
„In zweihundert Metern rechts abbiegen, dann haben Sie ihr Ziel erreicht.“ Na, gut daß wenigstens das Navi wußte, wo er hier war. Fischer wußte nur, er war irgendwo nördlich vom Großen Feldberg, auf dem Taunusrücken. Das Satellitenphoto hatte nicht gelogen, hier draußen sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht. Seit er am Bad Homburger Kreuz von der Autobahn abgefahren war, hatte er sich blind auf das Navi verlassen müssen. Fischer bremste scharf und schaltete herunter in den Zweiten, was der luftgekühlte Heckmotor seines betagten Neunelfers mit einem heiseren Grummeln quittierte.
Während er langsam in den unbefestigten, stockdunklen Forstweg einbog, blickte Fischer auf das Navigationssystem: Es war jetzt 19:55 Uhr, er war also einen sehr respektablen Schnitt gefahren, 457 Kilometer in einem Hauch unter drei Stunden, trotz des dichten Feierabendverkehrs auf der A5. Nur schade, daß es schon dunkel war. Falls es hier draußen außer Nadelwald überhaupt irgend etwas zu sehen gab, hätte er es sich lieber bei Tageslicht angesehen. Nun ja, das war nicht zu ändern.
Vorsichtig, um sich seinen heißgeliebten Porsche nicht an etwaigen herumliegenden Ästen oder Steinbrocken zu verschrammen, bog Fischer nach rechts auf den Parkplatz ab. Tatsächlich, dort waren schemenhaft die Umrisse eines Autos zu erkennen.
Fischer fuhr einen Bogen, um die Lichtkegel der Scheinwerfer direkt auf den Wagen zu richten: Bei dem Wagen handelte es sich um eine dunkle Audi A4 Limousine, neuestes Modell, mit einem Münchener Kennzeichen, M-IQ 7037. Das Kennzeichen gehörte zum Autovermieter Sixt. Fischer wußte das, weil seine speziellen Freunde vom Bundesnachrichtendienst häufig mit just solchen Kennzeichen unterwegs waren. „Immerhin“, dachte er hoffnungsvoll, „vom Kennzeichen her könnte das Wyss’ Wagen sein. Anscheinend hat sich die lange Fahrt also doch gelohnt!“
Fischer bremste, schlug das Lenkrad voll ein, ließ die Kupplung kommen und fuhr mit Standgas einen kleinen Kreis, um sich zunächst einen Überblick über den Parkplatz zu verschaffen. Außer dem Audi war hier nichts, und der Audi schien leer zu sein, war hier wohl nur abgestellt worden, bevor sich Wyss zu jenen Palmenstränden aufgemacht hatte, von denen sein Chef nur auf der Sonnenbank träumte. Trotzdem, Vorsicht war die Mutter der Porzellankiste: Fischer schaltete Licht und Motor aus, nahm seine Zweibrüder-P7-Taschenlampe und seine Pistole, eine SIG-Sauer P250 DC, aus dem Handschuhfach, zog ein Paar Latexhandschuhe an, griff sich seinen Parka vom Beifahrersitz und stieg aus.
Kalt war es hier, und still. Als er den Reißverschluß seiner Jacke hochzog, hörte er zur Antwort zunächst den Warnruf einer Eule und dann das Flattern ihrer Flügel, so laut, als flöge sie direkt über seinen Kopf hinweg. Hier war niemand, wenn die Eulen schon Panik schoben sobald jemand einen Reißverschluß zumachte. Fischer beschloß, den taktischen Komment zu vergessen, der von ihm verlangte, die Taschenlampe stets am seitlich ausgestreckten Arm zu halten, möglichst weit vom Körperzentrum weg.
Er hatte schon die Hand am Türgriff des Audis – Fischer war kein Mann, der offene Türen aufbrach –, als er stutzte: Was war das denn für ein weißes Zeug da überall auf den Sitzen und auf dem Boden, auf dem Armaturenbrett und auf der Hutablage? War das Schnee? Schimmel? Nein, das konnte nicht sein. Aber was war es dann? Absurde Gedanken an Anthrax-Attentate und andere Katastrophenszenarien schossen ihm durch den Kopf, bis er im Beifahrer-Fußraum den achtlos liegengelassenen Bordfeuerlöscher erspähte. Ach so, das weiße Zeug war Löschpulver! Aber was hatte das denn zu bedeuten? Hier war doch nirgendwo ein Brandherd gewesen? Sehr merkwürdig.
Fischer probierte systematisch alle Türen des Audis: abgeschlossen. Er leuchtete den Innenraum aus: scheinbar nichts darin, außer Löschpulver. Er ging zurück zu seinem Wagen, öffnete den Gepäckraum und suchte das passende „Polenschlüssel“-Bit für Fahrzeuge der VAG-Marken Volkswagen und Audi aus dem Sortiment im Werkzeugset heraus. Ein geübter Autoknacker, ob er nun aus Polen oder sonst woher stammte, brauchte keinen Polenschlüssel; selbst bei den modernsten PKW tat es notfalls auch ein simpler Schraubendreher. Doch Fischer war ein Mann, der stolz auf seine Ausrüstung war und gerne mit professionellem Werkzeug arbeitete. Er steckte das Schlüsselrohlings-Ende des Polenschlüssel-Bits in das Schloß der Fahrertür und drehte den Quergriff des Steckschlüssels, der das Bit hielt: Klack! Nun war das Schloß kaputt, der Schließzylinder überdreht, aber die Tür hatte sich auf diese Weise so einfach öffnen lassen wie mit dem Originalschlüssel.
Zunächst durchsuchte er systematisch den Innenraum vorne und hinten, Handbreit für Handbreit. Er fand nichts, außer den zu dem Wagen gehörigen Unterlagen – dem Mietvertrag, der Bedienungsanleitung und so weiter – im Handschuhfach, einer Parkscheibe und Fensterputztüchern im Seitenfach der Fahrertür und einer angebrochenen Rolle Vivil-Pfefferminzbonbons in der Ablage der Mittelkonsole. Dann erst entriegelte er den Kofferraum.
Der Kofferraumdeckel öffnete sich mit einem leisen Ploppen. Das Tableau, das Fischer darunter erblickte, erinnerte ihn an einen toten Polarforscher, der sich im Sterben an seinen letzten verbliebenen Husky geklammert hatte. Sein Atem stockte, er trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Eine menschliche Gestalt lag bäuchlings im Kofferraum, die Beine angezogen und das Gesicht zu Fischer hingewandt, die angewinkelten Arme lose um einen Koffer geschlungen, auf dem sein Oberkörper ruhte. Die Gestalt und der Rest des Kofferraums waren über und über mit Löschpulver bedeckt, so daß die Gesichtszüge der Person kaum zu erkennen waren.
Fischer überwandt seinen Ekel, beugte sich vor und pustete das Löschpulver aus dem Gesicht der Person. Ach du Scheiße, das brannte ja höllisch! Fischer hatte beim Pusten etwas von dem Löschpulver in die Augen bekommen. Seine Augen begannen, wie verrückt zu brennen und zu tränen. Er hastete zurück zu seinem Porsche, um sich mit der halben Flasche Evian, die er noch im Wagen hatte, die Augen auszuspülen. Während er sich fluchend das Wasser über die Augen rinnen ließ – Trottel, der er war, hatte er schlicht vergessen, wie aggressiv Feuerlöschpulver war – lief sein Gehirn auf Hochtouren. Das Gesicht des Toten hatte er noch erkennen können, bevor ihn das Löschpulver fast blendete. Es war Wyss. Wyss war also doch nicht abgehauen, und er hatte sich ganz bestimmt nicht selber zum Sterben in den Kofferraum gelegt und mit dem Feuerlöscher eingesprüht. Wyss war überfallen worden. Mit diesem verfluchten Löschpulver hatten die Täter versucht, den Kriminaltechnikern ein Schnippchen zu schlagen.
Als sein Mineralwasser fast nur Neige gegangen war und er wieder halbwegs klar sehen konnte, ging Fischer zurück zum Audi. Wider Willen mußte er dabei grinsen: Mit seinen tränenden, rotgeweinten Augen sah er zweifellos aus wie ein trauernder Verwandter, der an diesem einsamen Ort in Ruhe Abschied von seinem geliebten Onkel Urs nehmen wollte. Fischer nahm die Taschenlampe zwischen die Zähne, packte Wyss’ Leiche an Jackettkragen und Hosenbund, und zog. Wyss bewegte sich nur ein paar Zentimeter. Fischer zog fester. Wyss bewegte sich noch immer kaum.
Fischer dachte nach: Normalerweise, bei Zimmertemperatur, war die Leichenstarre sechs bis zwölf Stunden post mortem voll ausgeprägt; sie sollte sich eigentlich 24 Stunden nach dem Tod schon wieder zu lösen beginnen. Aber bei der Kälte hier draußen würden all diese chemischen Verfallsprozesse erheblich langsamer ablaufen. Es konnte gut sein, es war auch die wahrscheinlichste Variante, daß Wyss bereits gestern nachmittag zu Tode gekommen war, hier auf diesem Parkplatz. Aber wie?
Fischer griff noch fester zu, stemmte seinen rechten Fuß gegen die Stoßstange des Audis, zog mit aller Kraft und streckte zugleich sein Bein durch. Wyss’ Leiche gab langsam und störrisch nach. Dann stürzte Fischer hintenüber und ihm wurde einen Augenblick lang schwarz vor Augen. Panik durchfuhr ihn. Oh nein, jetzt war er wirklich geblendet! Als er sich Sekundenbruchteile später wieder etwas gesammelt hatte, begriff er, warum er nichts mehr sah: Wyss’ Leiche war auf ihn drauf gefallen, lag quer über ihm. Fischer schloß die Augen, um nicht noch mehr von dem Löschpulver abzubekommen, rollte sich angeekelt seitwärts unter der Leiche weg, tastete nach seiner Taschenlampe und stand auf, Löschpulver im Mund. Spuckend und würgend rannte er abermals zurück zu seinem Porsche, um sich mit dem letzten Rest Mineralwasser die Augen und den Mund auszuspülen.
Als er sich wieder beruhigt hatte, untersuchte er penibel Wyss’ Leiche. Freilich war Fischer kein qualifizierter Rechtsmediziner, aber er hatte so etwas schon öfters gemacht und wußte, wonach er suchen mußte.
Zu seiner Verblüffung entdeckte er jedoch keinerlei Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung an der Leiche. Fischer wollte es nicht glauben, suchte schließlich sogar nach Anzeichen selbst ziemlich abseitiger Tötungsmethoden, schnitt Wyss die Kleidung vom Körper, betastete dessen Schädel, Kehlkopf und Wirbelsäule, brach mit Gewalt die Leichenstarre in dessen Unterkiefer, leuchtete ihm in den Rachen: nichts, keine Anzeichen eines unnatürlichen Todes. Erst nach einer guten Dreiviertelstunde brach er seine improvisierte Leichenschau völlig perplex ab. Fischer war mit seinem Latein am Ende, konnte da nichts erkennen; diese Leiche würden sich Profis anschauen müssen.
Danach widmete er sich dem übrigen Inhalt des Kofferraums. Darin lagen zwei identische schwarze Koffer, beide mit deutlichen Hebelspuren an den Schlössern, also schon praktischerweise vorgeknackt. Fischer zog den linken Koffer hervor und öffnete ihn. Wie er bereits an dessen geringem Gewicht gespürt hatte, war der Koffer leer, beziehungsweise fast leer. Darin befanden sich nur das am Kofferdeckel angebrachte GPS-Ortungssystem, zwei Formularblöcke mit dem UCS-Logo, ein paar Fetzen Stretchfolie sowie jede Menge zerrissene Geld-Banderolen, ebenfalls mit dem UCS-Logo.
Fischer zögerte nicht lange: Das Zeug mußte hier weg. Eberle würde es ihm nicht danken, wenn er diese eindeutigen Hinweise auf einen illegalen Geldtransport, einen illegalen UCS-Geldtransport noch dazu, hier herumliegen ließe. Wyss’ Brieftasche und Handy packte er ebenfalls in den Koffer. Die würde er sich später in Ruhe ansehen.
Nachdem er den Geldkoffer in seinen eigenen Kofferraum geschafft hatte, widmete er sich dem zweiten Koffer: nichts, nur Klamotten, Waschzeug, ein zerfleddertes Buch mit dem Titel „KulturSchock Thailand“ und eine in eine Plastiktüte eingewickelte Festplatte. Fischer stutzte. Seltsam, wieso schleppte jemand wie Wyss eine Festplatte ohne den dazugehörigen Computer mit sich herum?
Fischer schossen Medienberichte über Daten-CDs mit Informationen über deutsche Steuersünder durch den Kopf, für die der BND Millionensummen gezahlt hatte. Konnte es sein, daß Wyss einen ähnlichen Deal geplant hatte? Die Chancen waren verschwindend gering, aber wenn Fischer sich diese Festplatte nicht zumindest einmal anschaute, würde er das nie erfahren. Und falls sich tatsächlich derart brisante Informationen auf der Festplatte finden sollten, dann würde er damit seinen eigenen Deal drehen, das war klar.
Fischer war über sich selbst erstaunt, wie eindeutig seine Entscheidung war, wie wenig Bedenken er dabei empfand, einen guten Kunden zu hintergehen, die Festplatte zu unterschlagen. Nun ja, er schätzte Eberle, hatte viel von ihm gelernt, aber auch das hatte er von ihm gelernt: Wenn es um Geld ging, hörte die Freundschaft auf. Fischer brachte auch die Festplatte zu seinem Porsche, packte sie aber in seinen eigenen Koffer. Dann klopfte er sich sorgsam die letzten Reste Löschpulver aus Haaren und Kleidung, setzte sich ans Steuer und fuhr ab.
Die Benzinstandsanzeige erinnerte ihn daran, daß er dringend tanken mußte. Bei zügigem Tempo bildete sich regelrecht ein Strudel im Tank des Porsches, und Fischer war auf dem Hinweg gerast, was die Karre hergab. Einer Intuition folgend, befahl er dem Navi, ihn nach Bad Homburg zu leiten. Vielleicht könnte er dort beim Tanken noch etwas in Erfahrung bringen.
Auf dem Weg nach Bad Homburg rief er wie versprochen Raoul an und erklärte ihm knapp, daß der Kurier tot und das Geld futsch sei. Raoul legte daraufhin wortlos auf. Fischer wunderte sich: Entweder Raoul war ein sensibleres Seelchen als Fischer vermutet hätte, oder er war ein richtiger Blitzmerker.
Nach dem Meeting mit Raoul hatte Doktor Eberle Fischer noch ein paar Minuten beiseite genommen und ihm sotto voce seine Einschätzung der Lage geschildert: Entweder Wyss hatte Mist gebaut oder Raoul, darauf lief es hinaus.
Einen unehrlichen Wyss hätte Raoul darum wohl verschmerzen können, wenn auch mit einigem Haareraufen, doch ein überfallener Wyss war der Super-GAU für ihn. Nun würde man sich nämlich innerhalb der UCS fragen, wie es zu dem Überfall hatte kommen können, würde folgern, daß es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Leck gegeben haben mußte, und mit anklagendem Finger auf Raoul als die wahrscheinlichste Quelle dieser Indiskretion zeigen.
Die Kundenberater der Leute auf Wyss’ Route schieden jedenfalls aus; jeder von denen würde nur seine eigenen Kunden kennen, nicht die der anderen Kundenberater. Da er selbst Kunde von Eberles Bank war, hatte Fischer inzwischen etwas Einblick in die Gepflogenheiten der Branche bekommen: Jeder Kunde hatte einen bestimmten Berater, der sein einziger Ansprechpartner bei der Bank war, den er rund um die Uhr anrufen konnte und der, einen entsprechenden Anlagebetrag vorausgesetzt, auch ohne Murren seinen Pudel für ihn ausführen oder ihm den Rasen mähen würde. Im Grunde waren die Kunden also eher Kunden eines bestimmten Kundenberaters als einer bestimmten Bank.
Die Kundenberater wiederum waren provisionsabhängige Drücker, deren Einkünfte fast ausschließlich davon abhingen, wieviel Geld ihre Kunden bei der Bank anlegten und wie provisionsträchtig die Produkte waren, die sie ihnen aufschwatzten. Deshalb behandelten sie ihre Klientel als ihr argwöhnisch behütetes Privateigentum. Sein Book, die Liste seiner Kunden und deren Kontaktdaten, war die Existenzgrundlage eines jedes Kundenberaters. Er würde den Teufel tun und diese Informationen mit Kollegen teilen.
Selbst der Bank, seiner Arbeitgeberin, verriet ein gewiefter Kundenberater stets nur das Nötigste. Die private Handynummer, über die ein Kunde tatsächlich erreichbar war, sowie dessen aktuellen Aufenthaltsort kannte zumeist nur sein Kundenberater. Wenn er klug war, speicherte der jene Informationen immer nur auf seinem privaten Handy ab, nie in irgendwelchen bankinternen Datenbanken: Es könnte ihm ja eine konkurrierende Bank ein besseres Angebot machen, ein paar Prozentpunkte mehr Prov bieten. In solch einer Situation war es entscheidend, daß nur er selbst seine Kunden erreichen konnte, um diese dazu zu bewegen, gemeinsam mit ihm die Bank zu wechseln. Die cleversten Kundenberater wurden mit den Jahren fast ebenso reich wie ihre Kunden.
Den Gesamtüberblick, welche Kunden auf Wyss’ Route lagen, wann und wo er sich jeweils mit denen treffen würde, hatten demnach wohl nur Wyss und Raoul gehabt. Nur die beiden würden gewußt haben, daß Wyss diesmal schon von Anfang an Geld im Koffer hatte. Raoul war Fischer zwar zutiefst unsympathisch, aber er glaubte trotzdem nicht, daß er etwas mit dem Überfall zu tun hatte. Dennoch hatte Raoul jetzt ein ernsthaftes Problem, denn der Anschein sprach eindeutig gegen ihn.
An einer Shell-Tankstelle in Bad Homburg wusch sich Fischer noch einmal gründlich die Augen aus und tankte den Porsche voll. Dazu kaufte er sich ein überbackenes Schinken-Käse-Sandwich, einen großen Becher Kaffee sowie die aktuelle Ausgabe der Taunus Zeitung. Das Sandwich hatte seine besten Tage zwar schon hinter sich, doch Fischer verspürte einen Bärenhunger und schlang es regelrecht hinunter. Dann nippte er geruhsam von seinem Kaffee und entfaltete die Zeitung auf seinem Stehtisch. Direkt auf der unteren Hälfte von Seite Eins wurde er fündig:
Gestern nachmittag hatten drei vermummte Gangster in einem ruhigen Neubauviertel Bad Homburgs in Chicago-Manier wie wild mit Maschinenpistolen um sich geballert, waren danach in einem dunkelgrauen Audi A4 mit Münchener Kennzeichen getürmt. Nach dem Wagen, dessen Kennzeichen laut Zeugenaussagen mit M-IQ begann, werde seitdem fieberhaft gefahndet.
Fischer prustete Kaffee, schüttelte sprachlos den Kopf. Das mußte er jetzt aber nicht verstehen, oder? Er las weiter:
Personen seien dabei wie durch ein Wunder nicht zuschaden gekommen. Die Frage nach einem möglichen Motiv für den Anschlag gebe den Ermittlern weiterhin Rätsel auf, zumal dieses Wohngebiet bislang nicht als krimineller Brennpunkt aufgefallen sei. Der Polizeipräsident Westhessens mochte etwaige Zusammenhänge mit der Frankfurter Drogenszene nicht ausschließen. Demgegenüber postulierte ein drittklassiger Kriminalpsychologe, eine mediengeile Rampensau, die seit Jahren als selbsternannter „Profiler“ durch die privaten Fernsehkanäle geisterte, ein Mann, dessen bloße Erwähnung Fischer mit heiligem Zorn erfüllte: Eine solch hemmungslose Bereitschaft, bei Bedarf von der Schußwaffe Gebrauch zu machen, sei absolut typisch für hochmobile, straff organisierte Tätergruppen aus den ehemaligen GUS-Staaten. Deren zügellose, menschenverachtende Gewaltbereitschaft sei ebenso einzigartig und charakteristisch wie die Handschrift oder der Fingerabdruck eines Menschen. Für eine Täterschaft dieses Personenkreises spreche ferner der Umstand, daß die Schützen anscheinend Kalaschnikow-Sturmgewehre verwendet hätten. Er habe die Befürchtung, dies sei erst der Anfang einer neuen Welle der Gewalt auf Deutschlands Straßen gewesen.
Fischer schüttelte abermals den Kopf. Kleiner hatte es der Spinner wohl nicht, was? Das war jetzt wirklich ein bißchen zuviel Irrsinn auf einmal, und Fischer war völlig groggy. Nachdenken konnte er morgen immer noch, aber jetzt sollte er sich besser mal wieder auf den Heimweg machen. Er blickte auf seine Vulcain-Nautical-Taucheruhr: schon fast halb elf. Natalie machte sich bestimmt schon Sorgen, es war höchste Zeit, sie anzurufen.
Zuvor jedoch mußte er noch ein paar Kollegen gründlich den Abend versauen. Auf dem Weg zum Autobahnzubringer hielt Fischer an einer Telefonzelle, wählte 110 und erklärte dem Beamten von der Leitstelle mit verstellter Stimme, wo der Gangster-Audi mit dem Münchener Kennzeichen zu finden sei, nebst einer Leiche. Fischer ignorierte die grantigen Fragen des Beamten, ob das ein Scherz sein solle, wer er denn überhaupt sei und was er denn bitteschön zu dieser späten Stunde noch da draußen im Wald zu tun gehabt habe. Vielmehr beschwor er den Beamten so eindringlich mit seiner verstellten Micky-Maus-Stimme, dieser möge gefälligst dafür sorgen, daß man der Leiche ein toxikologisches Screening angedeihen lasse, bis der zermürbt klein beigab.