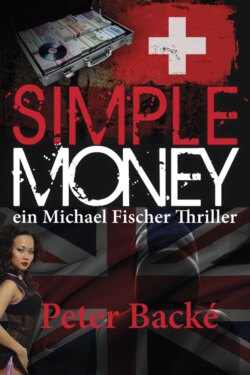Читать книгу Simple Money - Peter Backé - Страница 6
2
ОглавлениеZürich, am Sonntag, den 2. November 2008
Der Killer, den seine Kollegen nur als „Avi“ kannten, schätzte es, Körper und Geist zugleich zu trainieren. Darum löste er auch an diesem Sonntagmorgen wieder Kreuzworträtsel im Kopf, während er gleichzeitig sein tägliches Pensum an Liegestützen absolvierte. Heute war er langsamer als sonst. Von seiner Stirn fiel bereits der Schweiß in dicken Tropfen auf das Rätselmagazin, derweil er sich immer noch vergebens das Hirn zermarterte über einen Meeresvampir mit acht Buchstaben, _ _ U _ _ U _ E, aber bevor das Rätsel nicht vollständig gelöst war, würde er nicht zur nächsten Übung übergehen.
Sein Handy klingelte. Er nahm mit der Linken ab, meldete sich mit einem knappen „Ja?“ und wechselte zu einarmigen Liegestützen über, das Handy am Ohr. Etwas über eine Minute später beendete er wortlos das Gespräch, wischte das verschwitzte Handy kurz an seinem T-Shirt ab, legte es wieder beiseite und stieß einen aus tiefstem Herzen kommenden Fluch aus: „Ben zonah!“
Er rollte sich erschöpft auf den Rücken, machte halbherzig ein paar Sit-ups und preßte dabei mit hervorstehenden Nackenmuskeln und gebleckten Zähnen eine Haßtirade hervor. Einziger Gegenstand seines Monologs war die Zielperson seines Teams, Dr.-Ing. Christoph „Stöff“ Kessler: der Beruf von Kesslers Mutter, das Erbgut von Kesslers wahrem Vater, die Umstände von Kesslers Zeugung und Kesslers eigene sexuelle Präferenzen. Danach blieb Avi regungslos liegen, starrte an die Decke und grübelte.
Avi haßte Mißerfolge, aber Kessler würde es vermasseln, arabische Arbeit abliefern. Die Sache würde schon wieder schiefgehen. Alles, was Kessler zu tun hatte, war doch nur, die Daten durch Doktor Mohsen Derakshan vom Forschungszentrum Jülich statistisch auf ihre Plausibilität prüfen zu lassen, danach die Festplatte zur iranischen Botschaft in Bern zu schaffen, dort seine dreißig Silberlinge zu kassieren und nach getaner Arbeit wieder zurück unter seinen Stein zu kriechen. Kessler hatte die Festplatte gekauft, genauer: hatte sie vom Mossad gekauft, freilich ohne dies zu ahnen; nun sollte er sie einfach wieder verkaufen, an Israels Erzfeinde, die Iraner. War das denn wirklich zuviel verlangt? Um seinen Tod, der für die Iraner ein schlagender Beweis für die Authentizität der auf der Festplatte gespeicherten Daten wäre, würde sich Avi danach schon kümmern.
Die Bombe, die Kessler töten sollte, lag schon bereit: eine exakte Replik der Kopfstütze des Fahrersitzes seines Porsche Cayenne Turbo S, darin ein Stück C4 Plastiksprengstoff von der Größe eines Kaugummipäckchens sowie eine dicke konkave Stahlplatte, zum Fokussieren der Druckwelle, die Kesslers Kopf von seinen Schultern holen würde. Ferner ein Empfänger für den Funk-Autoschlüssel des Porsche, zum Scharfmachen der Bombe sobald Kessler die Zentralverriegelung des Wagens öffnete, und ein hochempfindlicher Druckzünder, derzeit noch durch einen Streifen roter Plastikfolie gesichert, der wie eine obszöne Zunge aus einem kleinen Schlitz an der Seite der Kopfstütze hervorragte.
Eigentlich mochte Avi keine Bomben – zu unpräzise, zu hohes Risiko von Kollateralschäden –, doch der Bombenbauer hatte Avi versichert, daß selbst ein etwaiger Passagier im Beifahrersitz von Kesslers Porsche nicht mehr zu befürchten hätte als geborstene Trommelfelle und eine gesalzene Rechnung von einer chemischen Reinigung. Außerdem war es taktisch zwingend notwendig, Kessler mit einem Signatur-Anschlag zu beseitigen, das heißt, ihn auf eine Weise zu töten, die es einerseits israelischen Diplomaten ermöglichen würde, achselzuckend und unter Berufung auf eine „Politik der gezielten Nichteindeutigkeit“ jede Beteiligung Israels an dem Attentat zu leugnen, die aber andererseits bei den Iranern keinerlei Zweifel zuließe, daß hier der Mossad zugeschlagen hatte.
Avis Kollegin Sylvia, eine zierliche junge Frau von Mitte Zwanzig mit langen braunroten Korkenzieherlocken und einem sonnigen Gemüt, streckte feixend den Kopf aus der Küche des möblierten Apartments, das sie für diese Operation angemietet hatte. Wie es ihre Gewohnheit war, hänselte sie ihren fast zehn Jahre älteren Kollegen mit seinem Alter: „Was, du machst schon schlapp, Avi? Was ist los? Soll ich dir beim Aufstehen helfen und dir deinen Rollator holen?“
„Haim hat eben angerufen. Dieser Hurensohn Kessler will sich jetzt doch nicht selber mit Derakshan treffen. Stattdessen schickt er ihm die Festplatte per Kurier.“
„Wie, per Kurier? Mit einem Paketservice, oder was?“
„Nein, nein, er schickt einen speziellen Wertkurier, ein Ein-Mann-Unternehmen. Der Typ heißt Wyss, Urs Wyss. Kesslers Kundenberater bei der UCS-Bank hat ihm den als extrem diskret und vertrauenswürdig empfohlen. Haim sagt, der Typ ist ein bißchen zu diskret für seinen Geschmack. Er hat zwar tatsächlich ein Gewerbe als Wertkurier angemeldet, steht aber in keinem Branchenbuch.“
„Merkwürdig. Und was machen wir jetzt?“
„Jetzt sagen wir den anderen Bescheid und packen unsere Koffer. Wir müssen das Team aufteilen: Haim als Qoph muß sowieso bei Kessler bleiben und die Abhörtechnik betreuen, die Ayin tanzen jetzt schon auf zwei Hochzeiten, mit Kessler in Zürich und den verdammten Iranern in Bern; bleiben also nur Aleph, Bet und Het. Ich schlage vor, wir lassen Bet in Zürich, gewissermaßen als strategische Eingreiftruppe für Notfälle. Unterdessen hängen Yossy und ich uns an den Kurier dran, gemeinsam mit Dina und dir, jeweils als Pärchen unterwegs. Einverstanden?“
„Einverstanden!“, erwiderte Sylvia lächelnd. Als einer der beiden Killer des Aleph-Elements, der todbringenden Spitze ihres „Bajonett“ oder Kidon genannten Teams, hatte Avi bei derartigen operativen Fragen ohnehin Entscheidungsvollmacht, desto netter war es von ihm, sie um ihr Einverständnis zu bitten.
Überdies arbeitete sie einfach gerne mit Avi zusammen. An seiner Seite fühlte sie sich sicher. Nicht etwa sicher vor Gewalt; wie alle Mitglieder der Kidon-Einheit hatte sie exakt das gleiche Training wie Avi durchlaufen und wußte darum genau, daß es kaum eine physische Bedrohung gab, mit der sie nicht selber spielend fertigwerden könnte, sondern sicher davor, durch irgendeinen dummen Fehler aufzufliegen. Avi war im Saarland aufgewachsen, sprach darum nicht nur perfekt Deutsch und Französisch, sondern bewegte sich allgemein im westlichen Ausland viel unauffälliger als ein in Israel aufgewachsener Sabra. Außerdem war er einfach ein netter Kerl, ein entspannter Beachboy, der jede freie Minute auf seinem Surfbrett verbrachte, kein dumpfer religiöser Fanatiker wie Yossy.
Für ihren Geschmack war das einzige Manko an Avi, daß er ein bißchen allzu verheiratet war. Dem Kantinenklatsch zufolge war er früher ein Herzensbrecher von einigem Renommee gewesen. Sylvia konnte sich das lebhaft ausmalen und wäre diesen Gerüchten gerne einmal auf den Grund gegangen, wenn Avi nicht diese Aura „Zutritt strengstens verboten!“ um sich gehabt hätte.
Schade, denn mit wem sollte sie schließlich sonst anbandeln, in einem Job, bei dem sie ein Drittel des Jahres im Auslandseinsatz verbrachte, zwei Drittel beim Training – innerhalb Israels, aber undercover und unter extrem realitätsnahen Operationsbedingungen –, einem Job, von dem sie niemandem, noch nicht einmal ihrer eigenen Mutter, erzählen durfte?
„Wann müssen wir los?“, fragte sie nach einer Pause.
„Kessler will sich heute um halb drei mit Wyss im Café Odeon am Limmatquai treffen. Also sollten wir spätestens um halb zwei in Position sein. Ein paar Ayin müssen uns unterstützen, damit wir Wyss dort sauber übernehmen können.“
„Derakshan kennt diesen Wyss doch nicht, oder? Und Kessler kennt ihn auch nicht persönlich, richtig? Die sind sich alle noch nie persönlich begegnet, oder mache ich hier gerade einen Denkfehler?“
„Exakt!“, entgegnete Avi mit einem schmalen Lächeln. „Genau derselbe Gedanke ist mir auch schon gekommen. Um Wyss noch vor seinem Treffen mit Kessler aus dem Verkehr zu ziehen, ist es leider schon zu spät, aber falls er danach irgendwelche Zicken machen sollte, beseitigen wir ihn und ich rede stattdessen mit Derakshan.“
Damit war das Thema erledigt. Sylvia nickte stumm und ging zurück in die Küche, um sich wieder ihren Cornflakes zu widmen.
Sylvia war alles andere als gefühllos, aber die Frage der moralischen Zulässigkeit ihres Handelns hatte sie sich vor rund dreieinhalb Jahren erschöpfend und zufriedenstellend selbst beantwortet, an jenem denkwürdigen Tag, an dem ein nichtssagendes Behördenschreiben sie in ein anonymes kleines Büro bei Neve Tsedek zitiert hatte. Dort hatte sie ein freundlicher älterer Herr in Zivil – wie sich später herausstellte, war es Haim, der erfahrenste Teamkommandeur und mit seinen mittlerweile achtundfünfzig Jahren der Nestor unter den Kidon – aus heiterem Himmel gefragt, was sie davon hielte, ihre sogenannte Karriere als freischaffende Webdesignerin ein paar Jahre lang zu unterbrechen und derweil für Israel zu töten. Zwei Jahre Ausbildung, drei Jahre im Feld, danach könne sie entscheiden, ob sie für weitere drei Jahre verlängern wolle. Haim hatte ihr einen Tag Bedenkzeit eingeräumt, doch Sylvia hatte noch nicht einmal zehn Minuten gebraucht, um sich zu entscheiden.
Die Antwort war so eindeutig, daß Sylvia seitdem nie wieder darüber nachgedacht hatte, nie das Bedürfnis gehabt hatte, mit einem Kollegen oder mit einem der die Einheit betreuenden Psychologen darüber zu sprechen. Sie hatte auch noch niemals mitbekommen, wie sich andere Kidon darüber unterhielten. Das Für und Wider war für alle Beteiligten längst kein Thema mehr, es gab keine Zweifel und kein Zögern.
Seit Beginn des unseligen amerikanischen „Krieges gegen den Terror“ tötete die CIA mit ihren Drohnenangriffen im Durchschnitt hundert Unbeteiligte, um einen einzigen Terrorverdächtigen zu eliminieren, der es in einem äußerst intransparenten und fehleranfälligen Verfahren auf ihre Todesliste geschafft hatte. Bei den Bomben- und Raketenangriffen der IDF-Luftwaffe in den Palästinensergebieten war die Quote zwar besser, aber ebenfalls längst nicht perfekt.
Kidon hingegen tötete selektiv, eliminierte nur Terroristen, die von einem ordentlichen Gericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt und deren Todesurteile vom Premierminister persönlich gegengezeichnet worden waren, und: Die rund fünfzig Männer und Frauen der Kidon-Einheit des Mossad töteten stets aus nächster Nähe, riskierten dabei jedesmal Leib und Leben, nur damit keine Unbeteiligten zuschaden kamen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und gewöhnlichen Henkern war, daß Kidon Hausbesuche bei den Delinquenten machte.
Was gab es darüber groß nachzugrübeln? Dies war die sauberste aller denkbaren Methoden, den Müll wegzuschaffen, und irgendwer mußte das ja schließlich tun. Zugegeben, einen Unschuldigen wie Wyss im Rahmen eines operativen Notfalls töten zu müssen, war weniger erbaulich, aber vom Erfolg oder Mißerfolg einer Operation hingen im Regelfall die Leben zahlloser anderer Unschuldiger ab. Deshalb gab es auch in einem solchen Fall nicht viel abzuwägen.
Die Observation von Wyss gestaltete sich schwieriger als erwartet. Zwei weibliche Ayin hielten seit Viertel vor zwei die Stellung im Café Odeon. Sie spielten den Part betuchter Shopperinnen, die sich nach einem nervenaufreibenden Friseurbesuch und einem stressigen Lunch zur Erholung unbedingt ein paar Cüpli Champagner und ein ausgiebiges Schwätzchen gönnen mußten. Unterdessen warteten andere Mitglieder des Teams außen vor dem Café, am Bellevue-Platz und am Limmatquai, wieder andere in der Nähe von Wyss’ Wohnbüro draußen in Thalwil.
Vielleicht spielte der Champagner dabei eine Rolle, aber die beiden Damen im Odeon unterhielten sich tatsächlich ausgesprochen angeregt und glitten dabei immer wieder von ihrer gemeinsamen ersten Muttersprache, Englisch, in ihre zweite, Hebräisch.
Als Kessler dann endlich gegen 14:35 Uhr das Odeon betrat, mußten die Ayin mit Schrecken feststellen, daß der Kurier, Wyss, niemand anderes war als der unauffällige Mann mittleren Alters, der die ganze Zeit mit einem Café mélange und der NZZ am Sonntag am Nebentisch gesessen hatte, der schon vor ihnen dort gewesen war und der ihre gesamte Unterhaltung mitbekommen haben mußte. Während Wyss aufstand, auf Kessler zuging und sich vorstellte, tippte eine der beiden Ayin-Agentinnen hektisch eine kurze SMS, um ihren Kollegen draußen mitzuteilen, daß Wyss längst im Café war.
Für diesen Schrecken wurden die beiden Ayin jedoch dadurch entschädigt, daß sie das Gespräch zwischen Kessler und Wyss zumindest in groben Zügen verfolgen konnten, soweit es ihre lückenhaften Kenntnisse des Schwyzerdütsch eben zuließen:
Kessler und Wyss waren sich offenkundig noch nie zuvor begegnet. Wyss sollte 2500 Franken für diesen Auftrag erhalten. Kessler sagte Wyss (natürlich) nicht, was für Daten auf der Festplatte gespeichert waren, sagte nur, es handele sich um streng vertrauliche Geschäftsunterlagen. Wyss hinterfragte das nicht weiter. Kessler schärfte Wyss wieder und wieder ein, der Wissenschaftler Doktor Derakshan dürfe die Daten auf der Festplatte zwar mit Hilfe seines Supercomputers prüfen, sie dabei aber auf gar keinen Fall kopieren. Wyss dürfe die Festplatte darum keine Sekunde lang aus den Augen lassen. Letzteres verstehe sich von selbst, entgegnete Wyss, aber wie er Ersteres denn verhindern oder auch nur erkennen solle? Dies war so ziemlich die einzige Frage, die Wyss im Verlaufe des Gesprächs stellte, doch Kessler hatte darauf keine sinnvolle Antwort. Wyss müsse eben aufpassen, ganz genau hinsehen, dürfe sich nicht ablenken lassen. Dann übergab er Wyss auch schon tausend Franken im Kuvert als Anzahlung, einen Zettel mit den Kontaktdaten von Doktor Derakshan und die Festplatte, achtlos in eine Coop-Plastiktüte eingewickelt. Ende der Unterredung, exit Kessler.
Etwas Neues erfahren hatten die beiden Ayin durch das Belauschen dieser Unterredung nicht, außer daß Wyss sofort bei ihnen hätte anfangen können, so vermaledeit unauffällig war er: weder jung noch alt, weder groß noch klein, weder dünn noch dick, weder attraktiv noch häßlich, weder gut noch schlecht angezogen.
Nachdem er das Café verlassen hatte, tat Wyss jedoch etwas, was das gesamte Team regelrecht in Panik versetzte. Wyss prüfte, ob er observiert wurde, stellte sich dabei sogar recht professionell an: Er schlenderte zunächst gemächlich den Limmatquai entlang in Richtung Hauptbahnhof, bog dann abrupt links ab und überquerte die Limmat auf einer schmalen Fußgängerbrücke, um das etwaige Verfolgerfeld zu teilen. Danach hastete er ein kurzes Stück die Bahnhofstraße entlang, betrat das Kaufhaus Jelmoli durch einen Seiteneingang und verließ es schnurstracks wieder durch einen anderen Seiteneingang. Das etwaige Verfolgerfeld würde dadurch erneut geteilt und die übriggebliebenen Verfolger gezwungen, ihm dicht auf den Fersen zu bleiben. Dann marschierte er auf dem schwer einsehbaren Fußpfad im Flußbett des Schanzengrabens, eines Nebenarms der Sihl, in Richtung Hauptbahnhof. Mögliche verbliebene Verfolger hätten nun keine andere Wahl, als sich entweder zu offenbaren oder den visuellen Kontakt abzubrechen, einen Umweg zu nehmen und Wyss am Bahnhof zu erwarten.
Schließlich am Bahnhof angekommen, nahm Wyss nicht die erste S-Bahn zurück zu seinem Wohnbüro in Thalwil, sondern lauerte zunächst eine gute halbe Stunde im unterirdischen Zwischengeschoß, einem nur über zwei Rolltreppen erreichbaren „Flaschenhals“, den etwaige Verfolger auf ihrem Weg zu den S-Bahn-Gleisen passieren mußten. Er nahm dort keine verdächtigen Personen wahr. Erst dann machte er sich beruhigt auf den Heimweg.
Das Team mußte die Verfolgung Wyss’ bereits nach wenigen Minuten abbrechen, sonst wären sie unweigerlich aufgefallen. Aber wenigstens gelang es während seiner Flucht zwei der insgesamt sechs Ayin des Teams, sich Zugang zur Tiefgarage von Wyss’ Apartmenthaus in Thalwil zu verschaffen und seinen VW Passat mit einem Macteq mini GTS Peilsender zu versehen. Es blieb ihnen nicht genug Zeit, um den Peilsender an die Autobatterie anzuschließen, doch zumindest für die nächste Woche, die Standzeit der im Peilsender eingebauten Akkus, würde ihnen Wyss nun nicht mehr entwischen.
Außerdem war die bloße Tatsache, daß Wyss nach seinem Treffen mit Kessler Gegenobservationstechniken angewendet hatte, wahrscheinlich interessanter als alles, was er angestellt haben könnte, während ihn das Team aus den Augen verloren hatte. Den ganzen Sonntagabend über redete sich das Team die Köpfe heiß, telefonierten Haim und Avi mit der Zentrale: Wer, zum Teufel, war dieser Wyss denn eigentlich wirklich? War das Ganze eine Falle der Iraner, arbeitete Wyss für die Iraner? Wußte oder ahnte Wyss, was für Daten auf der Festplatte gespeichert waren, wie sensibel sein Auftrag wirklich war? Hatten sich die beiden Ayin im Odeon irgendwie verraten?
Erst gegen 22:40 Uhr am Sonntagabend kam die Entwarnung aus Tel Aviv: Keine Panik, der Mann ist immer so, war nach einer Konditorlehre dreizehn Jahre lang beim Schweizer Armeenachrichtendienst, so etwas prägt, und fährt seitdem praktisch jede Woche für eine Schweizer Bank kofferweise Schwarzgeld durch ganz Europa, so etwas prägt noch mehr.