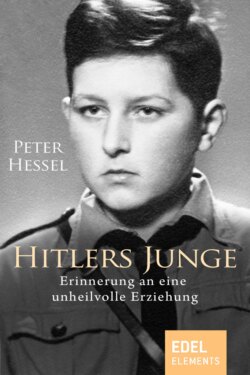Читать книгу Hitlers Junge - Peter Hessel - Страница 6
ОглавлениеKapitel 1
Morgengrauen
1934/1935
Ich bin wach, liege in meinem Gitterbett und sehe flackernde Lichter auf den Fensterbänken. Die Fenster stehen offen. Kalte Luft strömt ins Zimmer. Die Lichter kommen von zuckenden kleinen Flammen in flachen, bernsteinfarbenen Glasschalen, die sie vor dem Wind schützen. Hindenburglichter. Es ist Anfang Februar 1934. Heute verlasse ich die neblige Leere der frühen Kindheit und betrete das immer noch trübe Bewusstsein des heranwachsenden Kleinkinds. Mein Gedächtnis beginnt mit diesem Tag. Alles ist noch unsicher und vage. Es brennen Lichter in der Dunkelheit. Die Außenwelt hat Signale gesetzt. Die erste denkwürdige Berührung entsteht zwischen meinem Erleben und der Umwelt.
Schon vorher gab es verschwommene Kontakte. Zwischen meinen suchenden Lippen und einem feuchten, quietschenden Gumminippel, der süße, warme Milch spendet. Stimmen sind mir zu Ohren gekommen. Hände haben meinen Körper berührt. Diese Kontakte haben mir gefallen, ohne dauernde, tiefe Abdrücke als Erinnerungen zu hinterlassen. Ich bin Einzelkind in einem großen Erwachsenenhaushalt. Meistens lässt man mich allein. Dann weine ich mich in den Schlaf.
Die flackernden Lichter im Februar 1934 verkünden den wahren Anfang meines Lebens. Sie öffnen mir den Blick in die Außenwelt. Lange bleiben meine Augen auf die gelben Kerzen fixiert. Dann erfassen meine Ohren Klänge, die von der Straße kommen. Erst sind es leise, ferne Klänge wie leicht fallender Regen. Sie werden lauter und dringlicher, bis ein rhythmischer Lärm mein Zimmer füllt, meinen Raum einnimmt. Trapp-trapp, trapp-trapp, trapp-trapp. Eine riesige Maschine ist in Bewegung. Trapp-trapp, trapp-trapp, trapp-trapp. Hunderte von Männern erzeugen das Geräusch, Männer in Stiefeln mit Nagelsohlen. Sie marschieren im Gleichschritt. Es dröhnt wie Hammerschläge auf dem Steinpflaster der Zwickauer Straße in Chemnitz.
Deutschland feiert den ersten Jahrestag der Machtübernahme durch den Führer. Ich weiß noch nichts vom Führer, noch nichts vom neuen Deutschland. Ich bin zweieinhalb Jahre alt. Noch ist mein Verstand ein dunkles, braches, unbestelltes Feld. Nur die Kerzen bieten mir einen hoffnungsvollen Lichtschimmer, versprechen mir ein Erwachen. Ich werde wachsen. Die Hammerschläge der Marschierenden durchzucken meinen Kopf. Sie dringen in mein Gehirn ein und erfüllen es mit Energie.
Ich will aus meinem Gitterbett steigen und ans Fenster laufen, um zu sehen, was ich nur hören kann. Aber wie immer sind meine Handgelenke an beiden Seiten mit Mullbinden fest an die weiß gestrichenen Holzrungen der Gitter gefesselt. Frustriert schaue ich auf die tanzenden Lichter an der Decke – Widerschein der Lichter an den Fenstern. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aus dem Bett heraus. Mit meinen bandagierten Handgelenken schüttle ich an den Gittern, die mich gefangen halten. Jemand hat mich festgebunden, um meine Fingernägel am Kratzen zu hindern. Ich habe hässlich entzündete, juckende Ekzeme nicht nur an den Handgelenken, sondern auch in den warmen, feuchten Armbeugen und Kniekehlen. Jetzt aber fühle ich keinen Juckreiz, nicht bei dem Geschehen draußen.
Ich bäume mich auf und zerre, aber die Binden halten mich fest. Ich heule vor Wut. Ich rattere an den Holzgittern, bis das ganze Bett wackelt. Meine salzigen Tränen vermischen sich mit Schleim, der mir aus der Nase in den Mund läuft. Endlich öffnet sich die Tür. Eine junge Frau kommt ins Zimmer. Sie spricht beruhigend mit mir, wischt mein Gesicht mit einem feuchten Lappen, entknotet meine Binden und hebt mich aus dem Gitterbett.
Das Zimmer hat drei hohe Fenster. Die Frau trägt mich an eines und hält mich hoch. Sie stellt mich auf einen Stuhl, und ich schaue auf die Straße hinunter. Die Frau umfasst meinen Hals von hinten. Es ist wohltuend, wenn ihre weichen, warmen Arme mich berühren. Ich bin enttäuscht, wenn sie eine Strickjacke anzieht, ihre bloße Haut bedeckt und eine Decke um mich schlägt. Ich habe etwas verloren. Aber der Anblick und die Klänge sind noch da. Die hohe Häuserreihe gegenüber ist mit Dutzenden von gelben Kerzen beleuchtet. Rote Flaggen mit schwarzen Hakenkreuzen im weißen Kreis wehen im Wind. Ich sehe Leute, die sich zum Fenster hinauslehnen und mit weißen Taschentüchern winken. Andere drängen sich unten auf den Fußwegen auf beiden Straßenseiten und recken die Köpfe, um die Marschkolonnen der Fackelträger in Braunhemden zu sehen. Trapp-trapp, trapp-trapp, trapp-trapp.
Ein rauer Befehl durchschneidet die kalte Nachtluft: „Trommeln – schlagen!“ Es ertönt ein Donnern. Die Schlägel krachen auf die Ziegenhäute der Landsknechtstrommeln: Bumm, bumm, bumm-bumm-bumm! Das Dröhnen der Trommeln, die Hammerschläge der Stiefelsohlen auf dem Pflaster, die Kerzen und Fackeln, die das Dunkel der kalten Winternacht erhellen, erfüllen mich mit Staunen und Ehrfurcht. Meine Kopfhaut kribbelt vor Behagen. Ein neuer Befehl erschallt, als mehr Marschierende am Haus vorbeiziehen: „Abteilung, ein Lied! Es zittern ...“ Der den Befehl schreit, marschiert hinter den Fahnenträgern und an der Spitze der Trommler. Er singt die erste Zeile des Liedes, bevor Hunderte von rauen Männerstimmen einfallen:
Es zittern die morschen Knochen
der Welt vor dem großen Krieg.
Wir haben den Schrecken gebrochen,
für uns wird’s ein großer Sieg.
Wir werden weitermarschieren,
wenn alles in Scherben fällt,
denn heute gehört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt.
Die braunen Kolonnen der singenden Männer ziehen unter meinem Fenster vorbei. Ihnen folgt ein anderer Fahnenträger. Er marschiert an der Spitze seiner Kameraden und hält die Hakenkreuzfahne stolz im Wind. Das Hakenkreuz ist überall. Das Hakenkreuz brennt sich in mein Gedächtnis ein. Ich absorbiere das Hakenkreuz mit den machtvollen Klängen und Rhythmen. Ich stehe im Bann dieses Vorbeimarsches. Viele Reihen anderer Männer folgen. Sie tragen Stangen mit rechteckigen Standarten. Die Standarten haben ebenfalls Hakenkreuze, aber auch Schriftzüge. Was bedeuten die Worte? Die junge Frau liest vor: „Deutschland erwache!“
Ich bin erwacht. Ich bin hellwach. Ich bin zu jung, um Sprüche zu lesen und ihre Bedeutung zu verstehen, aber das Erlebnis hat mich im Innersten aufgewühlt. Nach dem Erwachen aus dem Schlaf meiner frühen Kindheit folgt die Ehrfurcht. Meine kindlichen Augen folgen den Reihen der Trommler, die mit ihrem beständigen Schlagen die Marschierenden im Gleichschritt halten. Der kriegerische, monotone Schlag der Landsknechtstrommeln dringt in mich ein, wird zum Teil von mir. Die Trommeln sind eine Naturkraft, die mich überwältigt und in Besitz nimmt. Ich weiß nichts, verstehe nichts, und doch bin ich tief bewegt und betroffen.
Hunderte von Männern in braunen Uniformen folgen den Trommlern. Alle tragen Fackeln in der linken Hand. Den rechten Arm halten sie steif ausgestreckt vor sich. Die Männer gehören zu Kompanien der SA. Sie tragen locker sitzende braune Reithosen. Blanke Ledergamaschen über schweren Stiefeln. Braunes Hemd mit großen Taschen und glänzenden Knöpfen. Hakenkreuzarmband am linken Ärmel. Braunes Halstuch, lederner Schulterriemen und Koppel. Auf dem Koppelschloss breitet der Reichsadler stolz seine Schwingen. Braune Mütze mit Adler- und Hakenkreuzabzeichen. Ein Wald von Fackeln erleuchtet die Straße. Fackelrauch steigt bis zu meinem Fenster hoch. Ich sehe, höre und rieche den Vorbeimarsch, dieses großartige, aufregende Schauspiel.
Eine andere Frau kommt ins Zimmer. Sie sieht das offene Fenster und schimpft uns beide aus. Sie hebt mich von der Fußbank und trägt mich in ihren starken Armen ins Gitterbett zurück. Sie riecht nach Arznei. Sie trägt eine weiße Kappe über ihrem grauen Haar. Es fallen zornige Worte. Ich verstehe ihre Bedeutung nicht, nur den Ton. Die ältere Frau nimmt die Kerzen von den Fensterbänken, bläst sie aus und klappt die Fensterflügel zu. Sie zieht die Vorhänge zu, deckt mich zu, bindet meine Handgelenke an die Bettrungen und sagt mit fester Stimme: „Genug von diesem Unsinn. Jetzt wird geschlafen!“
Wer sind alle diese Frauen um mich herum? Ich erkenne bereits, dass die wichtigste von allen meine Oma ist. Sie kommt öfter zu mir und spricht mehr mit mir als die anderen. Eine andere Frau heißt Mutti. An manchen Abenden beugt sie sich über mein Bett. Zu den anderen Frauen gehören meine drei Tanten, die jungen Dienstmädchen und Kinderfrauen, die kommen und gehen. Schatten, die sich bewegen. Schattenhafte Frauen. Die ich am wenigsten leiden kann, ist die grauhaarige Frau, die nach Arznei riecht und mir Schmerz zufügt, indem sie mit einem gläsernen Thermometer meine Körpertemperatur misst. Sie nimmt meine Bandagen ab, streicht Salbe auf meine Ekzeme, bandagiert mich erneut und fesselt mich wieder ans Gitterbett. Meine Haut sträubt sich, wenn sie in meine Nähe kommt. Am liebsten ist mir die junge Frau mit den weichen, warmen Armen, den langen blonden Locken und den funkelnden Augen. Sie ist die einzige, die viel lacht und dabei ihre Zähne zeigt. Meine Kopfhaut kribbelt, wenn sie mit mir spricht.
Nach dem Fackelzug im Februar 1934 schlafe ich zum langsam schwindenden Klang der Trommeln ein. Auch die Stiefel auf dem Pflaster höre ich nur noch von fern, im Halbschlaf. Im Traum sehe ich die Kerzen, Fackeln und Flaggen. Die Trommeln werden wieder gerührt. Ich höre die rauen Stimmen der SA-Männer. Diesmal singen sie kein Marschlied, sondern ein Schlaflied, aber nicht leise, wie es sich gehört. Sie schreien die Worte:
Morgen früh,
wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt ...
Wenn ich diese Zeilen höre, hoffe ich immer, dass Gott will. Ich fürchte, was geschehen könnte, wenn er einmal nicht will.
Wenn ich nicht in meinem Gitterbett liege, sitze ich auf dem Töpfchen im Badezimmer. Dort rutsche ich am Boden herum und singe vor mich hin. Man hat mir beigebracht, laut zu rufen, wenn ich mein Geschäft gemacht habe, damit es die Frauen hören. Ich soll schreien: „Ich bin fertig!“ Das letzte Wort dehne ich immer zum Gesang aus. Meistens dauert es eine Ewigkeit, bis jemand kommt. Bis eine der Frauen endlich zur Tür hereinkommt und mir den Hintern wischt.
„Rüberbeugen!“, befehlen sie, und ich gehorche. Gehorsam ist mir selbstverständlich. Schließlich bin ich das einzige Kind im Haushalt. Wie könnte ich auch gegen all diese Erniedrigungen rebellieren, die ich erdulden muss? Es wäre ja sinnlos. Ich bin die einzige kleine Person in einer Wohnung voll großer Frauen. Frauen gehen ein und aus in meinem Zimmer. Sie bestimmen mein Leben Tag für Tag. Die Frauen haben Macht über mich, sie bestimmen über mich. Ich bin ihnen ausgeliefert. Sie kommen einfach und tun etwas mit mir. Sie heben mich auf, drehen mich um und legen mich wieder hin. Sie befehlen mir, was ich zu tun habe. Selten beschäftigen sie sich mit mir. Manchmal gehen sie einfach vorbei und ignorieren mich. Manchmal winken sie oder stoßen gurrende Laute aus, die für Neugeborene gedacht sind. Selten, an ganz besonderen Abenden, besucht mich meine Mutter. Sie setzt sich neben mein Bett oder steht über mich gebeugt und singt mir ihr Schlaflied. Es ist das Lied von den kleinen Vögeln und Lämmern, von der Sternen und Kindern. Mutter singt immer dasselbe Lied, nie etwas anderes.
Es schaukeln die Winde
das Nest in der Linde,
da schließen sich schnell
die Äugelein hell.
Da schlafen vom Flügel der Mutter bedeckt
die Vögelein süß, bis der Morgen sie weckt.
Mutter hat eine liebliche, natürliche Singstimme, aber sie berührt mich nie, wenn sie singt. Sie konzentriert sich auf die Worte und die Kunst ihres Vortrags. Sie singt hauptsächlich für sich selbst. Es bleibt ein breiter Golf zwischen uns, zwischen Sängerin und Zuhörer, zwischen Mutter und Sohn. Ich sehe ihr mit weit aufgerissenen Augen zu. Sie gibt eine Vorstellung auf unsichtbarer Bühne. Dann tätschelt sie mir den Kopf, sagt „Schlaf gut!“ und verlässt das Zimmer.
Es ist ganz anders, wenn Oma mich in den Schlaf singt. Sie kennt das Wiegenlied meiner Mutter nicht. Sie hat ein großes Repertoire an anderen Liedern. Auch ihre Stimme ist wunderbar. Aber sie legt immer ihre Hand auf meine Stirn und streichelt sie ganz sacht, wenn sie singt. Am Ende legt sie beide Hände auf meine Augen und küsst mich Gute Nacht. Immer. Ich kann mich darauf verlassen. Eines ihrer einfachen Lieder ist wohl das häufigste unter allen deutschen Wiegenliedern:
Schlaf’, Kindchen, schlaf’.
Dein Vater hüt’ die Schaf’.
Deine Mutter schüttelt ’s Bäumelein,
da fällt herab ein Träumelein.
Schlaf’, Kindchen, schlaf’.
Als ich etwa drei oder vier Jahre alt bin, frage ich eine der Frauen in der Wohnung, wo mein Vater ist. Ich habe nur eine undeutliche Vorstellung von dem Begriff „Vater“. Das Wort hat sich in mein Vokabular eingeschlichen, aber ich verstehe den Ausdruck nicht so genau. Ist ein Vater – mein Vater – jemand wie Gott oder Jesus? Soviel ich weiß, hat es in meinem Leben nie einen Vater gegeben. Niemand spricht über ihn. Alle um mich herum sprechen dauernd von Opa, meinem Großvater. Ihn stelle ich mir als einen großen Vater vor, als ein großes, hochgewachsenes Wesen. Oma war seine Frau. Sie ist jetzt Witwe. Sie ist außerdem die Mutter meiner Mutter und die Mutter all meiner Onkel und Tanten. Ich verstehe, was Mütter sind. Aber Väter?
Ich flüstere meiner Mutter ins Ohr: „Wo ist mein Vater?“ Ich weiß nicht, warum ich flüstere, aber es kommt mir notwendig vor. Es scheint ein heikles Thema zu sein.
Sie flüstert zurück: „Er ist im Krieg gefallen. Er ist jetzt im Himmel. Aber darüber wollen wir nicht sprechen.“
„Warum nicht?“
„Weil es mich traurig macht“, und sie wischt eine Träne ab.
Eine Weile bin ich mit dieser Erklärung zufrieden. Mutter ist eine Erwachsene, und natürlich zweifle ich nicht an den Worten von Erwachsenen. Sie sprechen immer mit so viel Autorität. Oma erzählt mir von der Zeit, als sie und Opa sechs Kinder aufzogen. Opa hatte ein gut gehendes Geschäft, verlor aber viel Geld, als es einmal zu einem großen Krach kam. Mein Großvater konnte das Geschäft behalten, aber er musste sich verkleinern. Dann erlitt er einen Herzschlag und starb, als er 55 Jahre alt war. Ich weiß, dass 55 sehr, sehr alt ist, denn ich bin noch nicht einmal fünf. Ich sehe Fotos von Opa. Er hatte einen Spitzbart. Er war ein alter Mann, obwohl Oma sagt, er sei jung gestorben. Ich bin verwirrt. Wie kann ein Mensch alt sein und jung sterben?
Omas ältester Sohn ist mein Onkel Otto. Er hat in Marburg Jura studiert. Omas älteste Tochter ist meine Tante Gretchen. Noch vor meiner Geburt heiratete sie Onkel Willy, einen Ingenieur aus Köln. Oma erzählt, dass Opa zunächst zornig war, als seine Tochter einen Preußen heiraten wollte, denn Sachsen haben nicht viel übrig für Preußen. Aber schließlich gab Opa dem jungen Paar seinen Segen und zahlte für eine große, aufwendige Hochzeit. Sie leben in Berlin, wo Onkel Willy für Siemens arbeitet.
„Hat Mutti auch eine große, aufwendige Hochzeit gefeiert?“, frage ich. Oma schaut mich eine Sekunde lang an und sagt ganz leise: „Ihre Hochzeit war kleiner. Aber du stellst zu viele Fragen, mein Junge.“
Omas jüngere Töchter sind meine Tanten Liesel und Trautel. Tante Liesel ist Zeitungsredakteurin, und Tante Trautel lernt, Kindergärtnerin zu sein. Omas jüngstes Kind ist mein Onkel Gottfried. Er war erst zwölf Jahre alt, als ich geboren wurde, und dreizehn, als sein Vater starb. Onkel Gottfried ist jetzt siebzehn und wohnt noch bei uns zu Hause. Onkel Gottfried und ich sind gute Freunde.
Während ich Oma helfe, die Zimmerpflanzen im Wohnzimmer zu gießen, erzählt sie mir, dass Opa immer viel Ärger mit der Politik hatte. „Was ist Politik?“, will ich wissen. Sie erklärt, früher hätten die Menschen viele Gruppen gebildet, die sie Parteien nannten. Auch Opa war in seiner solchen Partei. Sie hieß die Deutschnationale Partei. Die Leute in dieser Partei konnten eine andere Partei nicht leiden, die man Kommunisten oder die Roten nannte. Das waren böse Leute. Eines Tages ging Opa von einer politischen Versammlung nach Hause und wurde von zwei Kommunisten verprügelt. Sie zerbrachen seinen Spazierstock auf seinem Rücken. Aber schon zwei Wochen nachdem Opa gestorben war, wurde Deutschland gerettet, als Adolf Hitler an die Macht kam. Er wurde unser geliebter Führer. Die Partei des Führers, die NSDAP, ist jetzt die einzige Partei. Alle anderen sind verboten worden, weil sie so viel Unheil angerichtet haben. Jetzt haben wir das neue Deutschland, und alles ist in Ordnung. Die Leute können wieder arbeiten und Geld verdienen. Die Kommunisten sind alle eingesperrt worden. Aber wir müssen auf der Hut sein, denn es gibt andere Feinde, die nicht wollen, dass Deutschland stark und gesund ist. Ich liebe unseren Führer. Er ist der beste Mensch der Welt.
Ich lerne immer mehr über meine Familie und die Stadt, in der wir wohnen. Sie heißt Chemnitz. Als mein Großvater seine Kohlengroßhandlung verkleinern musste, beschloss er auch, seine Wohnung vom teuren Kassberg in die nahe gelegene Vorstadt Kappel zu verlegen. Hier wohnt die Familie seitdem, und hier wachse ich auf, in einer geräumigen Mietwohnung auf der Zwickauer Straße 154. Das stattliche Gebäude war einst die Villa eines reichen Fabrikanten. Vor Kurzem wurde es jedoch in zwei Hälften geteilt. Die Kappler Post nimmt die linke, westliche Hälfte ein, während im rechten, östlichen Teil drei große Wohnungen eingerichtet wurden, eine auf jedem Stockwerk. Oma sagt, unsere Wohnung in Kappel sei nicht so elegant wie die ehemalige Kassberg-Wohnung, aber ich meine, sie ist riesengroß. Das größte Zimmer hat drei Fenster zur Straße hin. Es diente als Opas Kontor.
Wenn die Bestellungen von Kohleneinzelhändlern und Fabriken per Telefon oder Post eintrafen, leitete er sie an die Kohlengruben weiter, von wo aus die Ware dann direkt an die Kunden versandt wurde. Wir haben ein geräumiges Wohn- und Esszimmer mit einem schönen, bis an die Decke reichenden grünen Kachelofen. Dieses Zimmer ist voll von eleganten Möbeln, Teppichen, Bildern und Lampen aus der Kassberg-Wohnung. An die große sonnige Küche schließt eine Speisekammer an, die fast so groß ist wie die Küche selbst. Es gibt viele Schlafzimmer. Eines ist für Mutter und mich, obwohl sie fast nie zu Hause ist. Ein Schlafzimmer heißt das Mädchenzimmer, in dem die Dienstmädchen schlafen. Oma sagt, sie hätte früher mehr Hilfe gehabt, aber jetzt kann sie sich nur noch zwei Mädchen leisten. Sie kommen und gehen. Ich muss mich oft an neue Gesichter gewöhnen. Die jetzigen Mädchen heißen Helga und Hilde. Oma nennt sie unerfahrene Kinder, denen sie alles erst beibringen muss. Da sie beide blond sind und lange Zöpfe haben, fällt es mir manchmal schwer, sie auseinanderzuhalten.
Eines der Dienstmädchen fragt mich:
„Wo ist denn dein Vater?“
„Er ist im Weltkrieg gefallen.“
„Oh?“
Warum ist sie denn so erstaunt? Ich kann ihr aber nicht mehr erzählen, weil ich selbst nichts weiter über ihn weiß.
Ich lerne viel über den Weltkrieg – aus Geschichten und Bildern. Dann zeigt mir Mutter ihr Hochzeitsbild. Es ist das erste Mal, dass ich ein Bild meines Vaters zu Gesicht bekomme. Er ist ein hochgewachsener, dunkelhaariger, vornehm aussehender Herr, aber das Beste an ihm ist, dass sein Smoking mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse geschmückt ist. Jetzt weiß ich, dass mein Vater ein Held war.
Ich sehe ihn vor mir. Feldgraue Uniform. Auf dem Kopf den Stahlhelm mit Spitze. Eine Pickelhaube. Stolz trägt er die schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreichs in den Kampf gegen einen Feind ohne Gesicht. Über seinem Kopf bersten Granaten. Eine Kugel trifft ihn ins Herz. Er stürzt zu Boden. Er ist ein Gefallener. Ein gefallener Held. Er reicht die Flagge einem Kameraden. Mit seinem letzten Atemzug spricht er: „Sage meinem Sohn, dass ich für das deutsche Vaterland gefallen bin.“ Dann stirbt er und steigt zum Himmel auf, wo er zum Engel wird. Mit weißen Flügeln. Genau so ist meine Vorstellung.
Wenn ich Oma oder eine meiner Tanten nach meinem Vater frage, sagen sie immer: „Du musst deine Mutter fragen. Sie wird es dir erklären.“
Ich gebe nicht zu, dass ich sie bereits gefragt habe und dass meine Frage sie immer sehr traurig macht und zum Weinen bringt. Statt sie weiter zu quälen, verzichte ich lieber darauf, sie noch einmal zu fragen. Sie könnte womöglich vor Leid sterben. Manchmal ist Mutter sehr stark und aktiv. Aber dann wieder erscheint sie mir alt und schwach. Sie ist gesund, wenn sie in ihren Sportclub geht. Aber manchmal bleibt sie zu Hause und liegt den ganzen Tag im Wohnzimmer auf dem Sofa, wo sie entweder liest oder schläft. Dann fürchte ich, dass sie in großer Gefahr ist, vielleicht sogar kurz vor dem Tode. Das Schlimmste, das ich mir überhaupt vorstellen kann, ist, dass Mutter stirbt. Oder Großmutter.
Oma ist eine alte Frau, viel älter als Mutter. Trotzdem ist sie immer guter Laune und hat ein freundliches Lächeln. Sie singt oft oder pfeift eine Melodie. Es ist so viel einfacher, Oma Fragen zu stellen. Sie hat nie etwas dagegen und beantwortet sie mit einer guten, manchmal langen Erklärung. Fragen nach meinen Vater oder nach Gott beantwortet sie allerdings nie ausführlich genug.
„Wie sieht der liebe Gott aus?“, frage ich sie.
„Der liebe Gott? Das weiß niemand genau.“
„Denkst du, er sieht vielleicht aus wie mein Vater?“
„Nein, natürlich nicht.“
„Wie Opa? Mit einem Bart?“
„Na, er hat vielleicht einen Bart, aber du stellst viel zu viele Fragen. Sage du nur dein Gebet jeden Abend, und dann wird alles gut.“
Ich sage auch mein Abendgebet wie befohlen. Ich bete zu Gott. Meistens sage ich mein Reimgebet, das ich auswendig gelernt habe:
Lieber Gott, ich bitte dich,
behüt’ auf allen Wegen mich,
beschütze auch mein Mütterlein,
ich will auch immer artig sein.
Amen.
Gleich nach meinem Gebet stelle ich manchmal Fragen an Gott. Ich frage ihn, weil Oma sagt, dass Gott alles weiß. Ich möchte wissen, wo er wohnt, wie er aussieht. Aber Gott antwortet nie. Er spricht nie zu mir. Ich weiß ebenso wenig über Gott wie über meinen Vater. Dagegen höre ich viel über unseren Führer. Die Erwachsenen reden dauernd über unseren Führer, Adolf Hitler. Sein eingerahmtes Bild hängt im Wohnzimmer. Wir haben kein Bild von Gott oder von meinem Vater an der Wand hängen. Wir können die Stimme des Führers im Radio hören. Gottes Stimme oder die Stimme meines Vaters können wir nicht hören.
„Oma, ist der liebe Gott wie der Führer?“
„So viele Fragen! Wie der Führer? Ja, da hast du vielleicht gar nicht so unrecht. Unser Führer ist der wichtigste Mann der Welt, aber er ist menschlich. Gott hat uns den Führer beschert, damit er unser Vaterland vor unseren Feinden beschützt.“
„Wer sind denn unsere Feinde?“
„Hauptsächlich die Juden. Aber es gibt auch andere. Du bist noch zu jung, um das zu verstehen.“
Eine Familie kommt zu Besuch. Ich soll mit dem Jungen spielen, der ein paar Jahre älter ist als ich. Wir spielen mit meinen Soldaten auf dem Fußboden in einer Ecke des Wohnzimmers, weit weg von den Erwachsenen. Aber der Junge scheint sich zu langweilen. Nach einer Weile fragt er mich: „Was macht denn dein Vater?“ Stolz sage ich ihm: „Mein Vater ist im Weltkrieg gefallen.“
„Wie ist das denn möglich?“, wundert sich der Junge. „Der Krieg war doch schon lange vorbei, als du geboren bist.“
„Nein, das stimmt nicht“, erwidere ich.
„Aber der Krieg war doch schon 1918 vorbei. Wann bist du denn geboren?“
„Am 18. August 1931.“
Er zählt an seinen Fingern ab und sagt:
„Der Krieg war schon dreizehn Jahre vorbei, als du geboren bist.“
„So?“ Ich verstehe das Problem nicht.
Aber ganz langsam bekomme ich den Verdacht, mein Vater könne auf andere Weise gestorben sein. Vielleicht war er im Krieg nur verwundet worden. Vielleicht starb er an seinen Wunden, nachdem ich geboren wurde. Aber warum ist es so ein großes Geheimnis?
Ich nehme mir ein Herz und stelle Mutter eine direkte Frage:
„Wie ist mein Vater denn gestorben?“
Statt mir zu antworten, nimmt sie ein Taschentuch vor den Mund und beginnt zu weinen. Sie spricht kein Wort. Stattdessen schluchzt sie und wird so aufgeregt, dass ich schon wieder fürchte, sie könne vor Kummer sterben. Ich will aber nicht, dass sie stirbt. Ich frage sie nicht wieder, zumindest nicht für eine Weile. Ich kann aber nicht umhin, darüber nachzudenken.
Ich bin jetzt alt genug, um allein die Wohnung zu verlassen, allein hinunterzugehen und das Grundstück zu erkunden, auf dem das große graue Haus steht. Auf unserer Straßenseite wohnen keine anderen Kinder. Gegenüber sehe ich Kinder spielen, aber ich darf nicht hinüber und mit ihnen spielen. Erstens habe ich den strengen Befehl, auf unserer Straßenseite zu bleiben. Auf der Straße ist ständig starker Verkehr: Autos, Lastwagen, Straßenbahnen und Pferdefuhrwerke rollen in beide Richtungen. Von morgens bis abends. Zweitens darf ich mit den Kindern dort drüben nicht spielen, weil sie schlechtes Deutsch sprechen.
Es gibt zweierlei Leute in Chemnitz. Die einen sprechen Hochdeutsch, wenn auch mit sächsischem Tonfall, und die anderen sprechen Sächsisch, die gewöhnliche Sprache des Volkes. In meiner Familie wird kein Sächsisch gesprochen. Sächsisch bedeutet ordinäres, nachlässiges Deutsch. Ich wachse mit Hochdeutsch auf, das die Leute außerhalb Sachsens genau verstehen, über das sie aber trotzdem lachen, wenn sie den Tonfall hören. Das Sächsisch, das gegenüber gesprochen wird, ist aber wie ein anderer Dialekt des Deutschen. Man nennt es auch Gassendeutsch. Niemand außerhalb Sachsens würde es leicht verstehen. Hinter unserem Haus in Kappel liegt eine mit Gras und Unkraut bewachsene Fläche, die für nichts genutzt wird. Sie ist zwischen einem verwucherten Fliederbusch und einem hohen Bretterzaun versteckt. Dort entdecke ich einen verlassenen, abgestellten Lieferwagen. Seine Karosserie und die offene Plattform sind völlig verrostet. Die Räder haben keine Reifen. Die Fenster im Führerhaus sind zerschlagen. Aber der Sitz im Führerhaus ist noch in gutem Zustand. Steuerrad und Steuerknüppel sind noch am richtigen Platz. Ich weiß nicht, ob unter der Haube noch ein Motor steckt. Ich sitze stundenlang auf dem Fahrersitz, drehe das Steuerrad, betätige den Steuerknüppel und mache Fahrgeräusche mit den Lippen. Ich trete mit dem rechten Bein hinunter zum Gaspedal: Brrrrm! Ich schüttle den Steuerknüppel und stelle mir vor, durch das Tor in den Straßenverkehr einzubiegen. Brrrrm! Brrrrm! Hinaus aus der Stadt ins offene Land. Steile Berge hinauf und hinunter. Über Brücken und hoch hinauf ins Gebirge. Brrrrm! Brrrrm! Schneller und schneller. Ich lehne mich bei einer scharfen Linkskurve aus dem Fenster wie ein Rennfahrer. Jetzt eine Rechtskurve, und ich lehne mich rechts über den Sitz. Tag um Tag spiele ich in dem Wrack, Sommer und Winter. Niemand kommt jemals mit mir in das Fahrerhaus. Wenn ich höre, dass mich eine der Frauen zum Essen ruft, steige ich sofort aus und laufe die Treppen hoch. Man hat mir Gehorsam beigebracht. Meistens bin ich auch gehorsam. Keiner fragt mich jemals, wo ich gewesen bin oder was ich getan habe.
In einem der Nebengebäude im großen Hof hinter unserem Haus geht ein Mann namens Max Grummt seinem Gewerbe nach. Er unterhält eine Brettschneide, und oft mischt sich das laute Schreien seiner Kreissäge in die von der Straße herkommenden Verkehrsgeräusche. Im selben Gebäude arbeitet Georg Sachse. Er kauft und verkauft alte Kleidungsstücke und andere Textilien. Wir nennen ihn den Lumpenmann, obwohl sein Schild an der Tür ihn als „Rohmaterialhändler“ ausweist. In einem angrenzenden Schuppen liegen Eisenteile und Wellblech herum, aber ich sehe dort niemals Menschen arbeiten. Meine Familie ist überhaupt nicht stolz auf diese Geschäftstätigkeit im Hinterhof. Mir ist streng verboten, mich dort aufzuhalten. Natürlich gehorche ich. Für Kinder ist Gehorsam die wichtigste Tugend. Nur manchmal wage ich einen kurzen Gang und einen scheuen Blick.
Neben unserem Haus führt ein schmaler Weg, der Schillergasse heißt, zur Bachgasse und zum Kappelbach hinunter. Gegenüber von uns, an der Ecke Schillergasse und Zwickauer Straße, steht das Volkshaus. Es enthält einen großen Saal, der hauptsächlich für Konzerte, Varieté-und Zirkusvorführungen benutzt wird. Großmutter lebt von ihren geringen Ersparnissen, einer kleinen Witwenrente und den immer dürftiger werdenden Einnahmen der Kohlengroßhandlung. Sie entschließt sich, ein Schlafzimmer in der Wohnung an Unterhaltungskünstler zu vermieten, die regelmäßig im Volkshaus auftreten. Sie essen dann auch bei uns Mittag. Diese Leute kommen aus weiter Ferne und haben etwas Exotisches an sich. Manchmal geben sie uns ein paar Freikarten. Dann nimmt Oma mich mit ins Volkshaus. Ganz besonders gefällt mir aber, wenn einer unserer Gäste im Wohnzimmer eine private Vorstellung gibt. Ich freue mich, wenn ich einem Bauchredner und seiner Handpuppe zuschauen und zuhören kann, oder einem Zauberer, der vor meinen Augen einen Rosenstrauß verschwinden lässt und mir erlaubt, ihn an unerwarteter Stelle wiederzufinden. Manchmal fügen die Artisten mich in ihre Privatvorstellung ein. Ein Musikclown spielt eine Pauke, eine Geige, ein Horn, eine Mundharmonika oder andere Instrumente gleichzeitig. Wenn er mir erlaubt, seine wunderschön dekorierte Kesselpauke zu schlagen, verliebe ich mich sofort in den tief vibrierenden Klang. Ich habe mich entschieden, später ein Trommler zu werden und im Volkshaus aufzutreten. Ich liebe sie alle, die Löwenbändiger und die Seiltänzer, die Schwertschlucker und die Komiker.
Ich halte mich für einen gehorsamen, braven Jungen, und ich habe auch gehört, dass die Erwachsenen das gesagt haben. Es gibt aber Ausnahmen. Ein- oder zweimal im Jahr kommt ein kleiner Zirkus ins Volkshaus. Eines Morgens gehe ich unerlaubterweise hinüber zur anderen Seite der Schillergasse und auf den Volkshaushof. Dort schaue ich einem fremd aussehenden Mann zu, der ein langes weißes Gewand und einen Turban trägt. Er führt fünf oder sechs riesige Elefanten in die Ställe hinter dem Hauptgebäude. Gerade vor dem Stalltor hebt ein Elefant seinen Schwanz hoch. Er lässt einen enormen Haufen von dampfendem Kot auf das Steinpflaster fallen. Das Tier hinter ihm stapft auf den Haufen und zerdrückt ihn mit einem seiner gigantischen Füße. Der nächste Elefant bleibt stehen. Plötzlich wächst ein langer, hellrot-fleischiger Schlauch unter seinem Bauch hervor. Ein Strahl von Urin platscht laut auf das Pflaster und bildet eine streng riechende Pfütze. Ich springe zurück, aber zu spät! Der warme Elefantenurin hat schon meine nackten Beine besprüht. Voller Abscheu trete ich weinend zurück. Ich will nach Hause, aber dann erinnere ich mich: Ich darf ja gar nicht sein, wo ich bin. Ich darf doch den Platz unmittelbar um unser Haus überhaupt nicht verlassen. Ich ekle mich, aber ich lasse meine Beine – und meine Tränen – an der Sonne trocknen.
Unser Badezimmer hat ein WC, eine riesige, mit weißer Emaille beschichtete Badewanne, einen Ausguss und eine Kommode mit mehreren Nachttöpfen. Ein kleines Fenster lässt sich mit einem Haken feststellen. Es befindet sich genau über unserer Haustür. Ich habe gelernt, das Fenster nach jedem „Aa“ zu öffnen, um frische Luft hereinzulassen. Einmal schaue ich zu diesem Fenster hinaus und beobachte, wie braune Herbstblätter im Winde wehen. Sie schaukeln langsam von Seite zu Seite, bis sie unten am Boden liegen bleiben. Ich habe eine Idee. Ich nehme ein Stück Toilettenpapier und halte es zum Fenster hinaus. Zu meiner Freude flattert es. Dann lasse ich es los. Es schaukelt und schwebt durch die Luft – ein weißes Blatt. Wenn es verschwindet, reiße ich ein anderes Stück von der Rolle ab. Und noch eines. Und noch eines. Eine Seite meines Gehirns sagt mir, dass ich es sein lassen sollte, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Die andere Seite sagt: „Das macht Spaß! Und niemand wird es merken.“ Bald flattern draußen mehr weiße als braune oder gelbe Blätter. Gerade als die Rolle leer wird, klingelt es an der Wohnungstür. Eine Minute später klopft es laut an der Badezimmertür. Ich habe ein komisches Gefühl im Bauch. Ich schließe die Tür auf. Draußen steht Großmutter und sieht mich sehr ernst an. Eine zornige Nachbarsfrau ist gekommen. Sie hat sich beschwert, dass jemand von unserem Fenster aus die ganze Nachbarschaft mit Toilettenpapier bedeckt. Es dauert lange, bis ich jedes einzelne Blatt wieder von der Einfahrt, von der Hecke und sogar vom Fußweg vor unserem Haus aufgesammelt habe. Ich weiß nicht, wer die Blätter auf der anderen Seite der Schillergasse aufliest. Aber einige hängen noch hoch in den Bäumen. Sonst hat meine Tat aber keine Konsequenzen. Ich überhöre, wie Oma sagt: „Er ist normalerweise ein gehorsames Kind. Er macht uns wenig Sorgen.“ Ich glaube, Oma weiß gar nicht, wie sie einen Jungen wie mich bestrafen sollte. Es tut mir wirklich leid, dass ich ihr so viel Kummer bereitet habe. Ich mag überhaupt nicht, wenn sie mich so ernst anschaut.
Onkel Otto heiratet seine Braut Irmgard, geborene Richter, in Chemnitz. Am Abend vorher ist eine große Feier bei uns. Polterabend bedeutet, dass man viele Scherben braucht, um Glück zu haben. Dazu werfen wir alte Teller und Schüsseln auf der Steintreppe hinunter. Auch mir wird erlaubt, dabei Geschirr zu zerbrechen. Am nächsten Tag, am 9. September 1935, ist die Hochzeit in einer Kirche. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in einer Kirche gewesen zu sein, obwohl man mir sagt, ich sei in einer Kirche getauft worden. Ich bin der vierjährige Blumenjunge. Meine Aufgabe ist sehr wichtig, denn ich muss vor dem Brautpaar hergehen und Blumen aus einem Korb auf den Boden streuen. Gleichmäßig und vorsichtig. „Streuen heißt nicht werfen, sondern behutsam aus der Hand gleiten lassen“, sagt Oma. Ich bin den ganzen Morgen aufgeregt. Werde ich es richtig machen? Oder wird man mich auslachen? Man stellt mich zwischen zwei Mädchen, die ich nicht kenne. Sie sind älter als ich. Sie sagen, ich solle nur aufpassen und es genauso machen wie sie. Langsam, nach den Klängen einer Orgel, schreiten wir dem Brautpaar voran, und alles geht seinen Gang. Hinterher frage ich Mutter, wer auf ihrer Hochzeit Blumen gestreut hat.
„Das sage ich dir später einmal. Jetzt möchte ich mich amüsieren.“ Ich weiß, was das bedeutet. Erwachsene amüsieren sich, indem sie Wein trinken und tanzen, laut lachen und Witze erzählen, die ich nicht hören darf.
Onkel Gottfried hat einen Rundfunkempfänger, den er aus Teilen selbst zusammengebastelt hat. Er hat kein Gehäuse, sondern seine Röhren verschiedener Größe, seine Drähte und Stecker sind alle sichtbar. Onkel Gottfried erlaubt mir, seinem Radio zuzuhören und sogar an den Knöpfen zu drehen, mit denen man verschiedene Sender einstellen und die Lautstärke ändern kann. Ich höre nicht nur deutsche Sender, sondern auch Sendungen in anderen Sprachen. Ich verstehe davon kein Wort, aber diese fremden Stimmen aus der Ferne faszinieren mich.
Manchmal sitzt die Familie abends am Radio und lauscht mit Spannung den Stimmen der Ansager. Dann folgt schwere, düstere Musik, die manchmal von Fanfarenstößen und Trommelwirbeln unterbrochen wird. Schließlich lauschen wir alle einer Ansprache Adolf Hitlers. Wenn ich den Führer sprechen höre, regt sich etwas in mir. Durch seine tiefe Stimme, seinen österreichischen Tonfall mit den scharf ausgesprochenen Konsonanten trifft jedes Wort ins Schwarze. Der Führer spricht! Ich beobachte die Erwachsenen und begreife die Bedeutung des Gesagten. Ich fühle die Dringlichkeit. Das Radio vibriert vom Zorn seiner lauten Stimme. Ich verstehe nicht, was der Führer genau sagt, aber ich merke mir manche Wörter, die wie Hammerschläge erklingen. Wörter wie Judentum und Deutschland, Lebensraum und Sieg. Diese wichtigen Wörter sind mir bereits erklärt worden. Sie gehören ebenso zu meinem Kindheitserleben wie die Vertrautheit mit dem Führer.
Die Juden sind unsere schlimmsten Feinde. Sie sind abscheuliche Ungeheuer, die überall unter uns leben, obwohl ich noch nie welche gesehen habe. Vor ihnen müssen wir auf der Hut sein. Ich weiß noch nicht viel über sie, aber ich werde bald mehr erfahren. Ja, die Juden sind das größte Problem.
Deutschland ist unser geliebtes Vaterland, unsere Heimat. Deutschland ist in ständiger Gefahr und muss verteidigt werden. Deutschland ist eines der heiligsten Worte, die ich kenne. Nach der Ansprache, wenn unsere Nationalhymne, das Deutschlandlied, gespielt wird, stehen wir alle auf. Nach der Nationalhymne folgt immer das Horst-Wessel-Lied, die Hymne der SA. Horst Wessel ist einer meiner Helden, einer der jungen Gefolgen des Führers. Er wurde von feigen Feinden hinterrücks ermordet. Horst Wessel hat dieses Lied über die braunen Bataillone geschrieben, die für Deutschland marschieren und die Fahne des neuen Deutschlands hochhalten, die stolze Hakenkreuzflagge. Ich kenne das ganze Lied auswendig:
Horst-Wessel-Lied
Die Fahne hoch,
die Reihen fest geschlossen,
SA marschiert
mit ruhig festem Schritt.
Kameraden, die Rotfront
und Reaktion erschossen,
marschier’n im Geist
in uns’ren Reihen mit.
Lebensraum ist, was dem deutschen Volk fehlt. Wir sind zu viele Menschen in einem kleinen Land. Nach dem Weltkrieg haben Deutschlands Feinde uns viel Lebensraum gestohlen. Wir brauchen die weiten, fast unbewohnten Flächen im Osten, die uns einst gehörten. Die fremden Menschen, die jetzt dort wohnen, wissen nichts von deutscher Ordnung. Dort sollen unsere Bauern einst Neuland schaffen. Wir brauchen auch die Kolonien, die uns geraubt wurden. Dafür werden wir eines Tages kämpfen müssen.
Sieg heißt, die Feinde zu überwinden. Heil bedeutet jubelndes Begrüßen. Beide Worte sind heilig. „Sieg Heil“ ist der Schlachtruf des neuen Deutschlands, den Millionen im ganzen Land ausrufen. Er ist eine Herausforderung gegen die neidischen Feinde Deutschlands. Ein Ruf, der unsere Feinde erschreckt und mit dem sich alle guten Deutschen um die Hakenkreuzflagge scharen. Ich kann die Stimme des Führers im Radio hören. Er ist daher viel greifbarer für mich als jede andere Heldenfigur. Hitler bedeutet mir weit mehr als Gott, dieser allmächtige, aber unsichtbare alte Mann, der mit seinen Engeln im Himmel hinter den weißen Wolken wohnen soll. Manchmal sitze ich auf der Fensterbank, starre in die ziehenden Wolken und hoffe, einen Blick von Gott zu erhaschen. Oder von Opa in Form eines Engels mit riesigen Schwingen. Aber niemand ist zu sehen. Unser Führer ist auch viel realistischer als Jesus, Gottes Sohn, der Mann, der einen grausamen Tod am Kreuz erlitt, nachdem man ihm dicke Nägel durch Hände und Füße getrieben hatte. Unser Führer ist wirklicher als Sankt Nikolaus, der Süßigkeiten in einen Stiefel stopft, den ich am 5. Dezember vor der Schlafzimmertür stehen lasse, und als der Weihnachtsmann, der am Heiligen Abend auf unergründliche Weise durch ein Schlüsselloch in unser Wohnzimmer schlüpft und nicht nur einen voll geschmückten Tannenbaum hinterlässt, sondern auf dem Tisch unter einem weißen Bettlaken auch Geschenke, Äpfel, Apfelsinen, Haselnüsse und Lebkuchenherzen aufbaut. Dann verschwindet er wieder, ohne sich jemals zu offenbaren. Ich habe zwar Bilder von all diesen Männern gesehen, vom Führer, von Gott und Jesus, von Nikolaus und dem Weihnachtsmann. Aber nur unser Führer ist zu hören. Nur an ihn kann ich wirklich glauben. Die anderen sind mir zu vage, zu nebelhaft, zu fern, um wahr zu sein. Ebenso ist es mit meinem Vater und sogar mit der Vorstellung von meinem Vater.