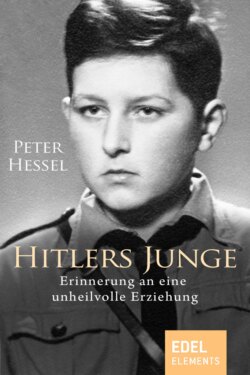Читать книгу Hitlers Junge - Peter Hessel - Страница 9
ОглавлениеKapitel 4
Wo ist Herr Goldstein?
1938
Ich weiß schon lange, wie man Wörter und Sätze liest und in Druckschrift schreibt. Jetzt sende ich viele Briefe an meine Onkels und Tanten. Darin erzähle ich ihnen vom Vierjahresplan, von unseren Kolonien in Afrika und anderen Geschichten, die ich in der Kinderschar gelernt habe.
Ich begleite meine Briefe auch mit Bildern. Aus allen Fenstern in den Häusern lasse ich die Fahne des neuen Deutschlands wehen. Ich muss viel üben, ehe ich das schwierige Hakenkreuz in den Kreis hineinzeichnen kann. Erst versuche ich es mit zwei Wolfsangeln, die sich kreuzen, die eine waagerecht, die andere senkrecht. Aber bald finde ich heraus, dass es leichter ist, ein Kreuz zu zeichnen und einfach an jedem Ende einen Strich anzubringen. Nun lasse ich überall Hakenkreuze entstehen, auf dem Fußweg mit Kreide, mit Malstiften an der Wand hinter meinem Bett. Oma beschwert sich, dass ich zu viel Paper verbrauche für meine Hakenkreuzfahnen auf Türmen, meine Hakenkreuze auf den Leitwerken von Flugzeugen und Luftschiffen. Sie kauft mir einen großen Zeichenblock, und auch der ist bald voll.
Im Frühjahr 1938 schicke ich eine Postkarte an den Führer und adressiere sie an die „Reichskanzlei Berlin“. Der 20. April ist Führers Geburtstag, stets Anlass zu großen Feierlichkeiten. Ich schreibe meine Glückwünsche in großen Druckbuchstaben und frage ihn, ob er sich an seinen Besuch in Chemnitz erinnert, als ich ihn gesehen hatte. Ich erzähle ihm, dass ich in der Kinderschar bin und dort viel über die nationalsozialistische Bewegung gelernt habe.
Nun warte ich sehnlich auf Antwort. Jeden Tag zweimal schiebt der Briefträger unsere Post durch den Schlitz in der Haustür. Zweimal am Tag bin ich enttäuscht. Es kommt keine Antwort vom Führer. Trotzdem verringert sich meine Bewunderung des größten Mannes aller Zeiten nicht. Ich verehre ihn weiterhin. Ich sage mir, er wird wohl geantwortet haben, und die Post ist verloren gegangen. Ich erzähle Oma von meiner Enttäuschung.
„Welche Fragen hast du denn dem Führer gestellt?“
„Ich habe ihn gefragt, ob er sich daran erinnern kann, dass ich ihn gesehen habe.“
„So etwas Dummes habe ich noch nie gehört. Es ist doch unmöglich, dass er dich in dieser riesigen Menschenmenge erkannt hat und sich daran erinnert.“
„Aber ich erinnere mich doch an ihn.“
„Du armer Junge! Manchmal denke ich, du hast überhaupt keine Vernunft.“
Bald darauf schenkt mir Onkel Otto ein kleines eingerahmtes Foto von Adolf Hitler und hängt es über meinem Bett an die Wand. Dieses Foto gehört mir. Es zeigt den Führer in anderer Stellung als das große Bild im Wohnzimmer. Der Führer schaut mir genau in die Augen. Jetzt bete ich nicht mehr zum unsichtbaren lieben Gott, sondern zu unserem Führer. Den lieben Gott kann ich mir als alten Mann mit einem im Winde wehenden langen weißen Bart gut vorstellen, aber er versteckt sich immer im Himmel, auch wenn dort keine Wolken ziehen. Den Führer dagegen habe ich selbst gesehen. Er sieht genauso aus wie auf dem Foto in meinem Zimmer. Adolf Hitler ist noch mehr zu meinem größten Helden geworden, und ich schaue buchstäblich auf zu ihm. Er ist mir näher und wichtiger als irgendein anderer Mann auf der Welt. Wenn ich groß bin, werde ich ihm folgen, wohin er will. Mit Freude würde ich für ihn sterben.
In den Osterferien 1938 unternehmen wir zu dritt eine lange Reise im reparierten DKW nach Niederbayern. Ein paar Tage vorher nimmt Mutter mich mit zum Ufa-Palast auf dem Hauptmarkt. Wir sehen den Film Triumph des Willens. Er handelt vom Reichsparteitag in Nürnberg. Massen von Männern in prächtigen Uniformen marschieren im Paradeschritt an der Tribüne vorbei, wo der Führer mit erhobenem Arm steht. Hunderte von Fahnen, Marschmusik, die mir durch den ganzen Körper pulsiert, grandiose Gebäude von Riesenausmaßen sind der Hintergrund, eine hinreißende Rede des Führers ist der Höhepunkt dieses unvergesslichen Schauspiels.
„Das werden wir auf unserer Reise sehen“, flüstert Mutter mir ins Ohr. Ich kann es kaum erwarten.
In Nürnberg besuchen wir einen alten Bekannten von Onkel Paul, Herrn Pickert. Wir übernachten in der Wohnung, die er mit seiner Frau teilt. Sie haben keine Kinder, aber einen Dackel. Herr Pickert ist Parteigenosse und nennt sich Alter Kämpfer. Er trat der NSDAP schon bei, bevor der Führer an die Macht kam. Er kennt ein paar wichtige Leute im Hotel Deutscher Hof und lädt uns ein zu einer Führung durch das Hotel. Herr Pickert erzählt uns: Als Adolf Hitler einige Jahre vor der Machtübernahme einmal Nürnberg besuchte, um eine Rede zu halten, wollte kein großes Hotel ihm ein Zimmer vermieten. Nur der Besitzer eines kleinen Hotels in der Stadt hieß ihn als Gast willkommen. Nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler wurde, ließ er in Nürnberg ein neues grandioses Hotel nach seinen eigenen Plänen erbauen – den Deutschen Hof. Als es fertig war, schenkte er es dem Besitzer des kleinen Hotels aus Dankbarkeit für seine Treue.
Wir gehen durch die Straßen und Gassen der Nürnberger Altstadt und bewundern die alten Fachwerkhäuser. Wir steigen einen steilen Weg hinauf zur riesigen Kaiserburg. Sie hat mächtige Türme und dicke Mauern mit Zinnen. Ich sehe im Geiste Ritter in glänzenden Harnischen und Helmen mit buntem Federschmuck. Sie wehren überlegene feindliche, wild und zottig aussehende Angreifer ab. Auf den gepflegten Rasenflächen sitzen Raben. Wir lauschen gespannt, als ein Stein in einen Brunnen geworfen wird, der so tief ist, dass es lange dauert, bis man unten das Aufklatschen hört.
Außerhalb der Stadt besuchen wir endlich das Reichsparteitagfeld. Ich freue mich schon auf den Anblick, den ich im Film gesehen habe, auf die Aufmärsche, die Musikkapellen und besonders auf den Führer auf seiner Tribüne. Zu meiner großen Enttäuschung ist der riesige Komplex vollständig menschenleer. Es gibt kein Fahnenmeer, nur eine Unmenge leerer Fahnenmasten. Keine uniformierten Kolonnen, keine Musik und keinen Führer. Nur kalte, kahle Gebäude, endlose Reihen von Sitzplätzen und einen riesigen Paradeplatz in der Mitte. Überall fliegen Hunderte von lärmenden Krähen herum. Ich frage Mutter:
„Wann fängt denn der Reichsparteitag an?“ Immer noch erwarte ich, dass jeden Augenblick hunderttausend Menschen hereinströmen. Auf diese Leere bin ich nicht vorbereitet.
Sie enttäuscht mich vollends:
„Sei doch nicht so dumm! Der Reichsparteitag ist erst im September.“
Das hatte mir niemand gesagt. Der Aufmarsch, die Klänge, die Fahnen und die Begeisterung der Menge beim Anblick des Führers sollten den Höhepunkt der Reise für mich darstellen. Wir gehen hinüber zu einem heiligen Schrein, der Ehrenhalle. Hier gedenkt man der gefallenen Helden der nationalsozialistischen Bewegung, die am 9. November 1923 dem Führer und dem Vaterland ihr Leben opferten: „Die toten Helden der jungen Nation“, wie es im Horst-Wessel-Lied heißt. Ich nehme mir fest vor, eines Tages selbst den Heldentod – den Tod als Märtyrer – zu sterben. Deutschland und den Führer zu verteidigen und dabei zu fallen wäre die größte Ehre, die einem widerfahren könnte. Ich stelle mir vor, wie mich eine Kugel ins Herz trifft. Es würde vielleicht einen Augenblick lang brennen und wehtun. Aber dann würde ich die Augen schließen, einschlafen und zu Boden stürzen. Meine Kameraden würden mich in eine Hakenkreuzfahne wickeln und mich ins Grab hinablassen, während sie Deutschland, Deutschland über alles singen.
Von Nürnberg aus fahren wir nach Rothenburg ob der Tauber. Onkel Paul parkt das Auto auf einem Platz mit dem Namen Judenfriedhof. Mutter wundert sich über den ungewöhnlichen Namen und fragt einen Mann, der auf dem Fußweg herumsteht. Er wohnt in Rothenburg und gibt ihr eine lange Erklärung, aber sein fränkischer Dialekt ist so stark, dass ich fast nichts verstehe. Mutter erklärt es mir später: In Rothenburg wohnen schon seit dem Mittelalter Juden.
„Die meisten sind gute deutsche Juden, die niemandem etwas zuleide tun.“ Ich höre zum allerersten Mal, dass es auch gute Juden gibt. Sie passen nicht in meine Vorstellung. Sie verzerren mein Bild.
„Woran erkennt man denn den Unterschied?“
„Sie sehen gar nicht aus wie Juden. Sie sehen genau wie Deutsche aus. Nur ihre Namen sind noch jüdisch.“ Ich bin verwirrt.
„Ich dachte, alle Juden sind unsere Feinde.“
„Das sind sie ja auch, aber diese alten deutschen Juden von früher sind harmlos. Außerdem werden wir wahrscheinlich gar keine Juden hier sehen, denn die meisten haben Deutschland schon lange verlassen.“
Ich fühle mich gar nicht wohl, wenn ich denke, ich könnte hier in den Straßen von Rothenburg auf Juden treffen. Auf der uralten, aber gut erhaltenen Stadtmauer führt ein Wehrgang rings um die alte Stadt. Wir steigen eine steile Treppe hinauf und sehen die Stadt von oben. Wir gehen von einem Stadtturm zum anderen. Zum Glück stoßen wir auf keinen einzigen Juden.
Auf dem Nachhauseweg halten wir in Coburg an. Wir wohnen im Hotel Festungshof, gleich unterhalb der Veste Coburg, einer enormen mittelalterlichen Festung, die auf einem Berg die Stadt überragt. Im Burghof zeigt man uns die Rosstrappe, den Abdruck eines Hufeisens auf einer niedrigen Mauer. Vor langer Zeit sprang hier ein Ritter auf der Flucht vor seinen Verfolgern in die Tiefe. Das treue Pferd kam bei dem Sturz um, aber der tapfere Reiter überlebte und konnte sich vor den Feinden in Sicherheit bringen. Ich hätte gern gewusst, ob seine Feinde Juden waren, aber ich frage nicht danach. Ich mag es nicht, wenn die Erwachsenen sagen, dass ich dumme Fragen stelle. Ich staune über eine riesige Kanone aus Bronze mit ihrem ins Tal gerichteten Lauf. Im Hotel dürfen wir einen Blick ins Führerzimmer werfen, wo Adolf Hitler einmal übernachtet hat. Auch das ist für mich ein heiliger Ort.
Nach den Osterferien 1938 werde ich eingeschult. Ich bin nun ein Schüler der Kappler Schule auf der Neefestraße. Am ersten Schultag bekomme ich einen Schulranzen aus braunem Leder, den ich an zwei Schulterriemen auf dem Rücken trage. Ich bin stolz auf den Ranzen, aber noch wichtiger ist zunächst die Zuckertüte, dieses große bunte Horn aus Pappe, gefüllt mit kleinen Schulutensilien: Buntstifte, Bleistiftetui, Radiergummi und Anspitzer. Aber ganz am Boden finde ich auch Orangen, Bananen, Schokolade und andere Süßigkeiten. Zu meiner großen Überraschung bekomme ich nicht eine, sondern zwei Zuckertüten. Meine Patentante bringt mir auch eine. Mutter, Großmutter, Onkel und Tanten sowie Onkel Paul bringen mir kleine Geschenke: Blumen und Schokolade, ein Paar Hausschuhe, einen Malkasten und das Beste: einen Colt, einen Cowboy-Revolver.
Im Schulsaal ist eine große Veranstaltung zur Begrüßung der neuen Schüler und ihrer Eltern. Vom Tor bis über den Schulhof und die Treppe hoch bis zum Saal stehen Hitlerjungen Spalier. Nur ich und ein weiterer Junge tragen die Kinderscharuniform, aber ich sehe drei oder vier Mädchen in Kinderscharkleidern. Ich gehe durch das Spalier und erhebe meinen rechten Arm zum deutschen Gruß. Im Saal sitzen die neuen Schüler, ihre Eltern und Verwandten auf Stühlen und bilden ein großes Viereck. Die Hitlerjugend marschiert in die Mitte des Vierecks mit Fahnen und Wimpeln. Ein Lehrer spielt Klavier. Wir alle singen das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied. Der Rektor, im dunklen Anzug, Parteiabzeichen am Aufschlag, steigt auf die Bühne, schlägt die Hacken zusammen und grüßt mit „Heil Hitler!“. Er erklärt das neue Schuljahr als eröffnet und heißt uns in dieser neuen Lebensphase willkommen. Eine Gruppe älterer Schüler gibt eine Vorstellung, die wohl spaßig sein soll, aber niemand lacht. Alle haben zu leise gesprochen. Es ertönt höflicher Applaus. Die Hitlerjugend singt zwei zackige Lieder, die ich auch schon kenne. Eines der Kinderscharmädchen knickst und trägt ein Gedicht vor. Sie kann sich aber eine Zeile nicht merken und fängt an zu weinen. Alle lachen. Sie tut mir leid. Sie ist völlig verlegen und wird knallrot im Gesicht. Sie fängt noch einmal an, kommt aber nicht weiter als zuvor. Sie knickst und rennt von der Bühne zu ihrer Mutter.
Der Rektor stellt die beiden Klassenlehrer für die Erstklässler vor. Einer ist alt. Er sieht streng und finster aus. Die Jacke seines gestreiften grauen Anzugs ist ihm zu klein. Ich glaube, die Knöpfe über seinem Bauch können jederzeit abreißen. Seine Hosenbeine sind zu kurz. Ich sehe seine grün karierten Socken. Seine schwarze Fliege sitzt schief. Er ist fast völlig glatzköpfig. Er trägt ein Monokel, das ihn gefährlich aussehen lässt. Er lässt es manchmal vom Auge herabfallen, aber es fällt nicht auf den Boden, weil es an einer Schnur hängt. Dann klemmt er es wieder ein. Als der Rektor ihn vorstellt, verbeugt er sich tief. Dieser Lehrer heißt Herr Fricke.
Der andere Lehrer ist noch sehr jung. Er ist groß und dünn und hat kurze blonde Haare. Er trägt Knickerbocker, graue wollene Kniesocken und breite braune Schuhe. Er steht stramm wie ein Soldat, Hände an der Hosennaht. Er schlägt die Hacken zusammen und sagt „Heil Hitler!“. Dann macht er rechtsum und marschiert von der Bühne. Der Rektor hat ihn zwar vorgestellt, aber ich verstehe den Namen nicht. Er ist lang und klingt komisch. Ich hoffte, in seine Klasse zu kommen, aber ich werde dem strengen Herrn Fricke zugeteilt.
Am ersten Schultag ist noch kein Unterricht. Der zweite Tag ist ganz schrecklich. Die jüngste Klasse heißt nicht die erste, sondern die achte, weil die Nummern rückwärts gezählt werden. Die meisten Jungen in den größeren Klassen sprechen Straßensächsisch. Sie ärgern uns und schimpfen uns Achterpopel. Sie behandeln uns wie den Abschaum der Menschheit. Auf dem Schulhof und auf den Gängen stoßen sie uns und stellen uns Füße. Sie boxen und jagen uns. Wir sind in ihren Augen Dreck. Bald merkt eine Gruppe dieser Jungen, dass ich Hochdeutsch spreche – mehr oder weniger ohne starken sächsischen Tonfall. Sie haben besondere Freude daran, mich zu hänseln und meine Aussprache nachzuahmen. Ich kann abends nicht einschlafen, weil ich mich vor dem nächsten Tag fürchte. Oft wache ich mitten in der Nacht mit einem Asthmaanfall auf. Dann keuche ich und kämpfe um Luft. Beim Frühstück graust es mir so sehr vor dem Schulweg, dass ich zittere. Großmutter meint, ich sei krank. Sie behält mich zu Hause. Auf diese Weise versäume ich viele Schultage.
Die Kappler Schule, ein hohes Gebäude aus roten unverputzten Ziegeln, ist in zwei Hälften eingeteilt. Eine für Jungen (auf dem Schild steht „Knabenschule“) und eine für Mädchen. Es kommt nie zu Kontakt zwischen Jungen und Mädchen, weder im Klassenzimmer noch auf den Gängen oder auf dem Schulhof. Die Turnhalle ist in einem einstöckigen separaten Gebäude. Ein Kiesweg verbindet sie mit dem Hauptgebäude. Sowohl Jungen als auch Mädchen haben fast jeden Tag Turnen, aber nie zur selben Zeit. Wir können die Mädchen sehen und hören, aber nicht mit ihnen sprechen. Einmal denke ich, Dornröschen mit den blonden Zöpfen gesehen zu haben. Aber ich könnte mich auch irren. Fast alle Mädchen haben blonde Zöpfe.
Die Schule bringt viele Veränderungen mit sich. Es geht in der Schule überhaupt nicht wie in der Kinderschar zu. Dort haben wir nur jeden Mittwochnachmittag Dienst, und ich habe ihn immer sehr gern. Jetzt gelange ich aus einer sicheren, vertrauten Welt zu Hause, die allein von Erwachsenen, von Frauen, dominiert ist, in eine raue, unfreundliche Welt in der Schule, wo Männer und ältere Jungen alles bestimmen. Ich hasse die Schule. Im neuen Deutschland ist Leibeserziehung an der Volksschule das allerwichtigste Fach. Wir haben jeden Tag eine volle Stunde lang Sport. Ich habe nichts gegen Fußball oder Handball auf dem Schulhof und auch nicht allzu viel gegen Gruppengymnastik. Dabei bläst der Lehrer die Trillerpfeife und kommandiert, wie wir unsere Kniebeugen und Armbewegungen ausführen müssen: Windmühle, Schattenboxen und so weiter. Aber ich hasse die Turnhalle. Zu meinem Leidwesen sind wir fast jeden Tag in der Turnhalle zum Geräteturnen. Dort sieht alles gefährlich aus: die Recks und Barren und andere Apparate zum Verrenken, Auf- und Abspringen und Klettern. Ich fürchte mich vor der Turnhalle, vor ihrem Geruch nach Leder und Schweiß. Auch die widerhallenden Geräusche schüchtern mich ein, die Trillerpfeife, die lauten Rufe und Schreie.
Ein Problem ist, dass ich unter Höhenangst leide. Natürlich sind mir daher die Kletterstangen und Kletterleitern zuwider, die hoch unter die Decke der Turnhalle führen. Ebenso viel Angst habe ich vor dem Geräteturnen. Der Sportlehrer hat keine Geduld mit mir. Er unterrichtet nach militärischem Vorbild mit schrillen Pfiffen und gebrüllten Kommandos. Er behandelt uns wie Rekruten. Die meisten Jungen stören sich nicht daran. Ich strenge mich zwar an, mein Bestes zu tun, aber es ist nie gut genug. Bald wissen es alle: Ich bin ein Verlierer im Turnen. Nur durch meine immerhin durchschnittlichen Leistungen bei Ballspielen und in der Leichtathletik – im Weitsprung, Hochsprung und Kurzstreckenlauf – verhindere ich, zum kompletten Jammerlappen abgestempelt zu werden.
Mein Status ändert sich aber, wenn wir im Klassenzimmer sind. Ich bin sehr gut im Lesen und Schreiben. Anfangs verwenden wir weder Papier noch Bleistifte. Stattdessen haben wir kleine holzumrandete Schiefertafeln, auf denen wir mit quietschenden Griffeln aus Tonschiefer schreiben. An jeder Tafel hängt ein Schwamm, um die Tafel sauber wischen zu können. Da ich schon lange Druckschrift schreiben kann, habe ich auch keine Schwierigkeiten, die Schreibschrift zu lernen.
Es gilt, die eckige Sütterlin-Schrift zu meistern. Das Alphabet unterscheidet sich grundlegend von der Druckschrift. Die Buchstaben und Wörter sehen wie Stäbchen mit Kringeln aus.
Wir lernen den Vers „Rauf, runter, rauf – i-Pünktchen drauf!“. Genauso schreibt man die deutschen Buchstaben: ein schräger Aufwärtsstrich, ein senkrechter Abwärtsstrich, ein weiterer Schrägstrich und noch ein senkrechter Strich und darüber den u-Bogen. Daraus besteht der Kleinbuchstabe „u“. Unser Lehrer legt viel Wert darauf, dass wir die Winkel haargenau bemessen und dass die Buchstaben die richtige Höhe haben. Sobald ich eine gewisse Fertigkeit im Schreiben auf der Schiefertafel und auch auf der großen Tafel vorn im Klassenzimmer bewiesen habe, sagt Herr Fricke, ich solle jetzt anfangen, mit Bleistift zu schreiben. Dazu gehört ein Schreibheft mit Zeilen, die jeweils in vier Linien unterteilt sind. Jeder Sütterlin-Buchstabe muss genau in seinen Platz zwischen den verschiedenen Linien auf dem Papier passen. Wer unordentlich schreibt, wird vor der ganzen Klasse ausgeschimpft. Herr Fricke schreit ihn dann an und sagt, er sei ein Schmutzfink und solle sich schämen. Manchmal schlägt er auch einfach zu: mit einem Lineal auf den Handrücken oder mit der flachen Hand ins Gesicht.
Herr Fricke trägt immer denselben schwarzen Anzug, der viele glänzend schimmernde Teile aufweist. Wenn er ärgerlich ist, wackelt die schwarze Fliege über seinem Adamsapfel hin und her. Sein graues Gesicht zeigt immer, dass er etwas missbilligt, auch wenn er keinen unmittelbaren Ärger oder Zorn an den Tag legt. Wir sitzen auf hölzernen Schulbänken, die in schnurgeraden Reihen angeordnet sind. Herr Fricke stapft hin und her durch die Reihen mit langen, langsam gleichmäßigen Schritten. Dabei hält er immer ein hölzernes Lineal hinter dem Rücken und schaut uns über die Schultern, um unsere Arbeit zu kontrollieren. Auch wenn er das Lineal nicht auf einen Handrücken schlägt, kracht er es immer wieder auf einen Tisch neben dem Schreibheft eines Schülers und schreit: „Hab’ ich dir nicht gesagt, du sollst nicht über die Zeilen schreiben, du dummer Junge? Wirst du das denn nie lernen?“
Ich mache mir wenig Sorgen um diese Wutausbrüche. Ich habe Geschick zum Lesen und Schreiben. Herr Fricke betrachtet mich daher als einen Musterschüler und sagt anderen in der Klasse, sie sollen es mir nachmachen. Ich sollte stolz darauf sein, bin es aber nicht. Die Jungen, die gewandter mit ihren Fäusten als mit den Fingern sind, die in der Turnhalle mehr leisten als im Klassenzimmer, fangen an, mich als Streber zu betrachten. Beim Unterricht fürchten sie sich vor Herrn Fricke, der sie oft ohrfeigt, an den Ohren und Haaren zieht oder ihre Handrücken mit dem Lineal traktiert. Aber auf dem Schulhof lassen sie ihren Frust an mir aus. Manchmal holt Herr Fricke sogar einen Rohrstock aus dem Schrank, zieht einem Jungen die Hosen herunter und verteilt ihm harte Schläge auf den nackten Hintern. Ich werde in der 1. Klasse nie von ihm gestraft. Dafür leide ich in den Pausen.
Im neuen Deutschland ist Sport – wie alle anderen Aktivitäten – strengstens organisiert und staatlich geregelt. Nur so kann die Disziplin der Sportler und des gesamten Volkes aufrechterhalten werden. Im Mai 1938 wird Mutter vom Reichssportbund zum Reichssportfeld abgeordnet, dem riesigen Komplex auf dem Olympiagelände in Berlin. Sie wurde für den Posten einer Trainerin für junge Sportlerinnen in Chemnitz vorgeschlagen, und jetzt nimmt sie in Berlin an einem Lehrgang für Leichtathletiktrainerinnen teil. Stolz erzählt sie mir, dass die berühmte Sportlerin und Olympiasiegerin Käthe Krauss, die für das Leichtathletiktraining in ganz Sachsen verantwortlich ist, sie für den Posten vorgeschlagen hat. Die lange Abwesenheit meiner Mutter ist nichts Neues für mich. Sie ist fast immer irgendwo unterwegs. Ich betrachte Mutter als eine meiner Verwandten und als häufige Besucherin. Natürlich weiß ich, dass sie meine Mutter ist, und ich nenne sie auch Mutti, aber eigentlich steht sie mir nur ebenso nahe wie meine Tanten. Ich bin mir klar über unsere Beziehung, und die ist nicht sehr eng. Sie bringt mir immer Geschenke mit, wenn sie von einer ihrer Reisen zurückkehrt: Spielsachen, Schokolade und Bonbons, manchmal ein Buch.
Sie kommt aus Berlin zurück und zeigt mit Bilder: Mutter im Sportzentrum. Mutter als Speer-und Diskuswerferin. Mutter beim Hochsprungwettkampf.
„Bist du jetzt eine berühmte Sportlerin, Mutti?“, frage ich.
„Ich bin eine gute Sportlerin, und ich hoffe, eine gute Trainerin zu werden. Aber nein, ich bin nicht berühmt und werde es nie werden. Um berühmt zu werden, muss man großartig sein, nicht nur gut. Außerdem werde ich langsam schon zu alt, um eine große Sportlerin zu sein.“ Ja, Mutter wird im August 32, eine Woche nach meinem 7. Geburtstag. Ich glaube ihr, wenn sie sagt, dass sie alt ist. Alle Erwachsenen sind alt, obwohl ich allerdings weiß, dass Mutter nicht so alt ist wie Oma, die im Juli 54 wird. Meine Oma ist wirklich alt. Sie ist eine alte, alte Frau mit grauem Haar. Ich liebe sie und hoffe, sie wird nicht sterben. Ich liebe auch Mutter und hoffe, dass sie nicht stirbt.
An einem sonnigen Sonntag nehmen Mutter und Herr Matthes mich mit auf eine Fahrt nach Leipzig. Wir besichtigen das Völkerschlachtdenkmal, das auf dem Schlachtfeld erbaut wurde, auf dem Napoleon 1813 von preußischen, bayrischen, österreichischen schwedischen und russischen Truppen besiegt wurde. Herr Matthes erklärt, dass Napoleon hier bei der Völkerschlacht gefangen genommen wurde. Zuerst schleppte man ihn in ein Gebäude, das heute Napoleonstein heißt und in ein Restaurant umgewandelt wurde. Das Denkmal selbst ist ein wuchtiges, hoch aufgetürmtes Bauwerk, das man schon aus weiter Entfernung sehen kann. Ich bin mehr an dem Restaurant interessiert als am Denkmal, denn man hat mir eine Schale frische Erdbeeren mit Schlagsahne und Eis versprochen. Wir nehmen auf der Terrasse an einem der runden Tische unter einem bunten Sonnenschirm Platz. Gierig verschlinge ich die Schlagsahne – eine große Seltenheit. Sofort fühle ich es in meinem Magen rumoren. Bald kommen Erdbeeren, Schlagsahne und noch viel mehr wieder zum Vorschein. Zum Glück sitzen wir draußen, wo ich mit dem Schuh viel im losen Kies verscharren und verstecken kann. Aber Mutter ist wütend. Zuerst schimpft sie ihren Verlobten aus: „Ich hab’ es dir doch gesagt, dass er es nicht vertragen kann!“ Dann wendet sie sich an mich: „Du Ferkel! Jetzt hat Onkel Paul wegen dir das viele schöne Geld verschwendet! Du solltest nie wieder Erdbeeren und Schlagsahne essen.“ Und dabei bleibt es auch lange.
Im Auto und auch in Leipzig habe ich das Gefühl, dass es zwischen meiner Mutter und Herrn Matthes Spannungen gibt. Oft sprechen sie gar nicht miteinander, und ihr Schweigen bedrückt mich. Bald nach dieser Fahrt brechen sie ihre Verlobung und trennen sich für immer. Mutter erklärt mir nicht, warum Onkel Paul so plötzlich aus unserem Leben verschwindet. Er gehörte ja eigentlich nie wirklich zu meinem Leben, nur zu ihrem. Ich schnappe Teile einer Unterhaltung auf, die von Erwachsenen geführt wird. Onkel Paul ist von der Bildfläche verschwunden. Das tut mir gar nicht sehr leid. Er hat sich nie viel um mich gekümmert, und ich glaube, er mochte mich gar nicht.
Tante Liesel nimmt mich ins Kino mit. Wir sehen einen bunten Zeichentrickfilm über das Leben in der Zukunft. Städte sind unter riesigen blasenförmigen Glasdächern gegen Regen und Schnee geschützt. Menschen gehen auf Fußwegen, die sich wie Laufbänder vorwärtsbewegen. Der Himmel ist voller Raketen und Raumschiffe, die Hakenkreuze an den Leitwerken zeigen. In einer Küche steckt eine hübsche blonde Hausfrau ein lebendiges Huhn, einen Sack Kartoffeln, Möhrenbündel und frische Petersilie in eine tunnelartige Maschine. Sie drückt ein paar Tasten. Nach vielem Gepolter und dem Aufleuchten roter und blauer Lampen erscheint am anderen Ende eine fertige, prächtig zubereitete, dampfende Mahlzeit auf dem elegant gedeckten Esstisch. Am Kopfende des Tisches sitzt der hungrige blonde Familienvater. Eine blondköpfige, blauäugige Kinderschar sitzt artig auf Stühlen rings um den Tisch. Alle warten, bis die Mutter die Maschine abgestellt und sich gesetzt hat, und fangen an, mit Messer und Gabel zu essen. Ich kann die Zukunft kaum erwarten. Es wird noch besser sein als jetzt, obwohl es im neuen Deutschland heute schon viel besser ist als in all den anderen Ländern, wo alle arbeitslos herumlungern und Not leiden.
Ich liebe das Kino. Filme sind ein ganz besonderes Erlebnis für mich. Manchmal fahre ich mit meiner Mutter samstags oder sonntags im Auto in die Stadt. Zuerst gehen wir in das elegante Café Freund in der Poststraße. Im ersten Stock sitzen wir an einem Marmortisch. Mutter trinkt Kaffee, und mir bestellt sie Kakao. Dazu gibt es Kuchen oder Torte. Dann gehen wir in eines der großen Kinos zur Nachmittagsvorstellung. Sie sind prachtvoll eingerichtet: der Luxor-Palast am Hauptmarkt gegenüber dem Alten Rathaus, der dahinter liegende Ufa-Palast, das Metropol an der Zwickauer Straße, der Rote Turm gegenüber dem eigentlichen Roten Turm, dem einzigen Überbleibsel der mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Ich genieße alle Filme, aber auf eine Art freue ich mich ganz besonders.
Trotz meiner schwarzen Locken bin ich ein echter deutscher Junge. Ich bin stolz, wenn ich meine Kinderscharuniform tragen kann. Ich bewundere alles, was die Erwachsenen um mich herum bewundern. Und natürlich bewundere ich den Führer. Aber ich habe mich zutiefst in ein ausländisches Mädchen verliebt. Sie ist kein deutsches, sondern ein amerikanisches Mädchen. Ja, ich liebe Shirley Temple, die mit ihrem Singen und Tanzen mein Herz erobert hat. Ich kenne sogar ein paar ihrer Lieder auswendig. Natürlich singt sie immer auf Deutsch. Zu meinem großen Leidwesen beschließt Großmutter: Genug ist genug. Sie erklärt meiner Mutter:
„Shirley Temple ist ja ein hübsches Mädchen, das gut singen und tanzen kann. Sie mag ja ganz harmlos sein, und manche amerikanische Filme dürfen ja auch in Deutschland gezeigt werden, wenn sie keine jüdische Propaganda enthalten. Aber für einen deutschen Jungen gehört es sich absolut nicht, von einer stepptanzenden, verjazzten kleinen Ausländerin zu schwärmen. Keine Shirley-Temple-Filme mehr!“
Mutter sieht das ein. Von jetzt ab darf ich von der blonden Shirley Temple nur noch träumen. Ich bin tief traurig, aber der Schmerz hält nicht allzu lange an.
Mutter besucht jetzt sehr oft Richard Soremba. Er wohnt in der Vorstadt Schönau, nicht weit von unserem Haus in Kappel entfernt. Er ist Elektroingenieur mit einem eigenen Geschäft, in dem die verschiedensten Geräte verkauft werden. Mutter erklärt mir, dass sie ihn schon lange vor meiner Geburt gekannt hat. Obwohl er jetzt mit einer anderen Frau verheiratet ist, sind sie noch immer gute Freunde.
Richard Soremba ist mir viel lieber als Paul Matthes. Er ist groß und schlank. Sein Haar ist schwarz und glänzend. Er ist immer elegant gekleidet. Er spricht Hochdeutsch ohne sächsischen Tonfall. Das ist so anders und fremd an ihm wie sein Name. Manchmal nennt Mutter ihn Ricardo. Ich glaube, er stammt aus Südamerika. Ich mag diesen Namen gern hören und aussprechen: Ricardo Soremba. Ich wollte, Mutter würde ihn heiraten und er würde mein Vater werden. Ich möchte viel lieber Soremba heißen als Matthes.
Ich sage meiner Großmutter, was ich denke. Aber sie sagt, dass so etwas überhaupt nicht infrage kommt.
„So etwas darfst du nicht sagen, mein Junge!“
„Warum denn nicht?“
„Weil Herr Soremba schon verheiratet ist.“
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Männern und Vätern, aber ich weiß schon, dass ein Mann nur eine Frau, nur eine Familie haben darf. Schade.
An einem sonnigen Nachmittag im Herbst 1938 parkt Mutter das Auto an der Pelzmühle und lässt mich aus dem Wagen. Die Pelzmühle in Schönau ist ein kleiner Vergnügungspark mit mehreren Karussells – ganz in der Nähe von Herrn Sorembas Geschäft. „Ich komme bald wieder. Du kaufst dir jetzt ein Eis, und dann wartest du auf mich im Auto. Verstanden?“ Sie drückt mir einen Groschen in die Hand.
Statt das Geld für ein Eis auszugeben, kaufe ich eine Karte für eine Fahrt im Boot-Karussell. Es zieht mich an und verspricht viel Spaß. In einem großen runden, mit Wasser gefüllten Bassin läuft eine Reihe kajakähnlicher Boote ringsum. Sie sind mit langen Stangen an einer Mittelinsel befestigt, die sich mit den Booten dreht. Jedes Boot ist vorn und hinten an das Nachbarboot angekettet. Ich sehe ein paar größere Kinder in die Boote steigen und sich an einem Geländerrohr abstoßen. Dann kreisen alle Boote im Wasser, bis ein Mann sie stoppt. Zwischen den Booten und dem Geländer ist ein schmaler Streifen Wasser, über den man steigen muss. Zwischen den Booten und der Karussellmitte ist ein breiter Zwischenraum. Ich bekomme ein ganzes Boot für mich allein, und es sind kaum andere Kinder zu sehen. Als die Fahrt vorbei ist und zum Halt kommt, warte ich nicht, bis mein Boot am Ausgang ist, sondern greife nach dem Geländer, um aussteigen zu können, wo ich sitze. Ich falle aber in den Spalt zwischen Boot und Kante. Im Nu bin ich im Wasser unter dem Boot. Ich hatte noch nie Schwimmunterricht und auch noch nie meinen Kopf unter Wasser. In meiner Panik schlage ich um mich, um aus dem Wasser zu kommen, aber mein Kopf stößt gegen den Boden des Bootes. Wahrscheinlich bin ich nur ein paar Sekunden unter Wasser, aber es scheint wie eine Ewigkeit, bis eine Frau mich herauszieht. Sie hatte mein ungeschicktes Aussteigen beobachtet. Sie stellt mich auf den Kopf. Ich huste und spucke viel Wasser, das ich verschluckt hatte. Dann kann ich wieder normal atmen. Ich bin sehr verängstigt und zittere am ganzen Körper. Natürlich ist meine Kleidung durchnässt. Die Frau trägt mich zu einer grünen Böschung, wo sie meine Schuhe und Strümpfe, meine Hosen, mein Hemd und auch meine Unterhosen auszieht. Sie breitet alles an der Sonne aus. Ich stehe da nackt und vielen Blicken ausgesetzt. Die Frau erklärt den Herumstehenden:
„Dieser kleine Junge wäre bald ertrunken!“
„Bist du denn ganz alleine hier?“, fragt mich die Frau.
Mir klappern die Zähne, und ich kann nur etwas von Eis, meiner Mutter und Herrn Soremba stottern. Ich fühle, dass meine Erklärung nicht viel Sinn hat.
„Ist Herr Soremba dein Vater?“, möchte die Frau wissen.
„Nein, mein Vater ist im Krieg gefallen.“ Warum schaut sie mich so seltsam mit offenem Mund an?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Es dauert wohl sehr lange. Schließlich trage ich wieder meine Kleidung, aber noch keine Schuhe und Strümpfe. Die halte ich in den Händen. Ich stehe vor Herrn Sorembas Tür mit der Frau, die mir das Leben gerettet hat. Sie klingelt.
Niemand kommt. Sie klopft an die Tür. Nach einer Weile höre ich Schritte. Jemand kommt die Treppe herunter. Es ist Herr Soremba. Er ruft meine Mutter:
„Komm mal runter, hier ist was passiert.“ Mutter ist wütend auf mich. Sie faucht:
„Wer hat dir erlaubt, Karussell zu fahren? Woher hattest du denn das Geld? Hab’ ich dir nicht befohlen, im Auto zu warten? Was soll ich bloß mit dir machen?“
Wieder einmal habe ich Mutter traurig gemacht. Ich war schlecht und ungehorsam. Warum muss ich sie dauernd ärgern? Warum kann ich denn kein fröhliches Kind sein?
Ich frage Oma: „Wann hat Mutter meinen Vater geheiratet?“
Sie denkt eine Weile nach. Wahrscheinlich zählt sie. Es hat mich viel Mut gekostet, ihr diese Frage zu stellen. Ich wollte schon oft fragen, hatte mich aber nie getraut. Jetzt will ich eine Antwort.
„Ungefähr ein Jahr vor deiner Geburt, 1930.“
„Wie ist das denn möglich?“ Mir steckt etwas im Hals.
„Was meinst du denn?“
Ich hole ganz tief Luft: „Ich bin kein Kleinkind mehr. Ich bin sieben Jahre alt, und ich kann zählen. Ich weiß, dass der Krieg 1918 zu Ende war. Ich habe das Hochzeitsbild gesehen. Mein Vater trug das Eiserne Kreuz. Er war also im Krieg. Aber mein Vater kann doch nicht im Krieg gefallen sein, wenn er meine Mutter 1930 geheiratet hat.“
Stille.
Ich werde laut: „Wo ist mein Vater?“
„Untersteh dich nicht, in diesem Ton mit mir zu sprechen! Ich glaube, deine Mutter wird sich mit dir zusammensetzen müssen und dir einige Dinge erklären“, sagt Oma.
Ich merke, wie wütend sie ist. Aber nicht auf mich. Sie schaut mich nicht an und ändert das Thema. Vielleicht hätte ich nicht fragen dürfen. Ich weiß jetzt, dass man mich belogen hat. Es ist, als hätte sich eine kalte Hand auf meine Schulter gelegt. Etwas ganz Fremdes, Unfreundliches ist mir angetan worden. Ich fühle mich einsam. Ich habe Angst.
Nachdem Mutter abends nach Hause kommt, höre ich, wie sie und Oma sich in der Küche anschreien. Ich darf die Küche nicht betreten, aber vom Wohnzimmer aus schnappe ich ein paar Brocken auf. Ich weiß, worüber sie sprechen. Dann stürmt Mutter heraus. Sie geht an mir vorbei, ohne ein Wort zu sagen, geht in unser Schlafzimmer und schlägt die Tür zu. Jetzt ist nicht die Zeit, ihr wichtige Fragen zu stellen. Schon wieder habe ich sie traurig gemacht. Und diesmal auch Großmutter. Ich bin daran schuld.
Am folgenden Sonntag geht Mutter mit mir spazieren. Das geschieht nur selten. Es ist ein schöner Herbsttag. Gefallenes Laub raschelt unter den Füßen. Eichhörnchen flitzen herum und sammeln Kastanien. Die Luft riecht scharf und frisch. Wir gehen hinunter zum Kappelbach, der langsam hinter unserem Haus plätschert. Wir folgen der schmalen Gasse, die am Bach entlangläuft. Mutter sagt, ich sei nun alt genug, um die Wahrheit über meinen Vater zu erfahren. Sie erklärt mir, sie hätte es nicht schon eher getan, weil kleine Kinder solche Dinge nicht verstehen. Sie hatte es mir zuliebe nicht erzählt. Sie sagt, dass sich Eltern manchmal nicht vertragen können und sich dann trennen oder scheiden lassen. Endlich ist das Wort gefallen: Scheidung.
„War mein Vater ein böser Mann?“
„Nein, natürlich nicht, er war ein guter Mann.“
„Warum ist er dann nicht bei uns geblieben?“
„Ich wollte nicht, dass er bleibt. Du bist noch zu jung, um das zu verstehen. Es war seine Schuld. Ich war unschuldig. Ich bin unschuldig geschieden. So hat das Gericht entschieden.
So steht es auch im Scheidungsurteil: Er was der Schuldige.“
„Aber was hat er denn gemacht? Du sagst, er war ein guter Mann. Wieso war er denn schuldig? Und du hast selbst gesagt, ich bin jetzt alt genug, um das zu verstehen!“
„Ich habe dir schon genug gesagt. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst.“
„Warum hast du mir gesagt, er sei im Krieg gefallen?“
„Du warst eben zu jung, um zu verstehen, was eine Scheidung ist.“
„Aber ich habe allen meinen Freunden erzählt, dass mein Vater im Krieg gefallen ist. Ich habe sie angelogen. Ich war so dumm! Ich konnte nicht einmal ausrechnen, dass der Krieg schon lange zu Ende war, als ich geboren wurde.“
„Genug!“
„Wo ist er? Wo wohnt er?“
„Genug! Keine Fragen mehr! Ich kann es nicht mehr aushalten!“ Sie weint. Ich weiß, dass sie immer vom Weinen krank wird.
Jetzt weiß ich, warum mein Vater uns verlassen hat. Ich muss wohl etwas Schlimmes getan haben, als ich klein war. Davon bin ich überzeugt. Darum will Mutter mir nicht mehr erzählen. Er konnte mich nicht ausstehen, und darum hat er Mutter und mich verlassen. Mutter sagt, er habe die Schuld, aber ich weiß genau, dass es meine Schuld war, nur meine Schuld. Ich tauge einfach nichts. Stillschweigend gehen wir zurück nach Hause. Kein Wort wird gesprochen. Wieder einmal habe ich Mutter traurig gemacht. Ich hätte ihr nie diese Fragen stellen dürfen. Erst verlässt uns mein Vater meinetwegen. Jetzt ist meine Mutter traurig meinetwegen. Und auch Großmutter. Was ist los mit mir?
Es ist Donnerstag, der 10. November 1938. Früh am Morgen bin ich auf dem Schulweg. Vor Goldsteins Schuhgeschäft sehe ich etwas Ungewöhnliches. Hier, wo ich erst vor ein paar Tagen neue Schuhe anprobiert habe, fegen zwei SA-Männer Glasscherben zusammen. Ein anderer nagelt Holzbretter über das zerbrochene Schaufenster. Die Fenster des Schokoladengeschäfts nebenan sind noch heil. Dieser Laden gehört Frau Erna Schumann, der besten Freundin meiner Mutter. Aber auch am Fotoeck gegenüber sehe ich zerbrochene Scheiben, die bereits notdürftig mit Brettern vernagelt sind. Hier stehen zwei SA-Männer Wache vor der Ladentür. Der eine winkt mit der Hand: „Weitergehen, weitergehen! Nicht stehen bleiben! Und pass auf, wohin du trittst, überall sind Glasscherben!“
Auf der anderen Straßenseite halten weitere Uniformierte Wache, während Männer in blauen Arbeitskitteln auf Trittleitern stehen und Bretter annageln. Was ist denn hier los? Hat die Nacht über ein Sturm getobt? Ist etwas explodiert, oder hat es gebrannt? Die Luft riecht stark nach Rauch. Es ist aber nicht der normale Rauch von Fabrikschornsteinen, sondern ein beißender Geruch, der ein Gefühl von Gefahr in sich birgt.
Auf dem Schulhof reden die älteren Kinder, und ich höre zu: Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr es gesehen? Alle jüdischen Geschäfte. Was ist das aber für ein Rauchgestank? Habt ihr es denn nicht gehört? Die Synagoge ist abgebrannt. Ja, die Juden haben ihre eigene Synagoge angezündet. Was ist denn eine Synagoge? Sei doch nicht so blöd: Es ist die jüdische Kirche. Es wurde endlich Zeit, dass wir mal mit diesen verfluchten jüdischen Mördern abrechnen. Habt ihr gehört, was die Schweine in Paris gemacht haben? Nein, was denn? Sie haben einen Deutschen in der deutschen Botschaft ermordet. Was ist denn eine Botschaft? Du weißt wohl überhaupt nichts, du dummer Kerl! Wartet nur ab, wir werden es diesen dreckigen Juden schon zeigen. Wir werden sie schon bald loswerden.
Ich erzähle dem älteren Jungen in Jungvolkuniform, der so viel weiß: „Jemand hat die Schaufenster vom Schuhgeschäft eingeschlagen. Und vom Fotogeschäft. Warum?“
„Weil es jüdische Läden sind“, antwortet er.
„Nein, das stimmt nicht“, protestiere ich. „Ich habe gerade meine neuen Schuhe bei Goldsteins bekommen. Die ich jetzt anhabe. Ich kriege alle meine Schuhe in dem Laden. Ich kenne den Mann, dem der Laden gehört. Er ist nett, er ist kein Jude.“
Ein großer weißblonder Junge streitet mit mir und nennt mich eine dumme kleine Rotznase. Aber ein anderer Junge stimmt mir bei: „Vielleicht hat jemand den falschen Laden erwischt.“
„Nee, das stimmt nicht“, sagt der weißblonde Junge.
„Woher weißt du das?“
„Weil ich weiß, dass Goldstein ein Jude ist. Goldstein ist ein jüdischer Name.“
„Nee, der ist kein Jude“, streitet der andere Junge. „Er geht mit seiner Frau und seinen Kindern in unsere Kirche.“
„Und?“
„Na, das heißt, er kann kein Jude sein.“
„Nicht unbedingt. Es gibt viele getaufte Juden.“
„Du weißt ja gar nicht, wovon du redest“, schreit der andere Junge.
Der weißblonde Junge stemmt seine Hände in die Hüften: „Doch, ich weiß es genau. Mein Vater hat es mir erklärt, und mein Vater sollte es schließlich wissen. Er ist nämlich in der SA. Und er hat mir verboten, mit den Goldstein-Kindern zu spielen, weil sie Juden sind!“ Kinder? Ich wusste gar nicht, dass Herr Goldstein Kinder hat. Und was ist das überhaupt: jüdische Kinder? Bis jetzt ist mir niemals eingefallen, dass es so etwas wie jüdische Kinder geben kann. Die Zeitungen und Plakate zeigen Juden immer nur als Männer. Als hässliche, abscheuliche Männer. Ich versuche, mir vorzustellen, wie jüdische Kinder aussehen könnten, aber es gelingt mir nicht. Sind sie wie die alten Juden, nur kleiner? Ich bin verwirrt. Und was ist mit jüdischen Frauen? Warum habe ich noch nie ein Bild von einer jüdischen Frau gesehen? Jetzt kommen mir die guten Juden in Rothenburg ob der Tauber in den Sinn. Das könnte die Antwort sein. Wenn Herr Goldstein Jude ist, muss er einer der harmlosen deutschen Juden sein. Aber warum haben sie dann seine Schaufenster eingeschlagen?
Als Herr Fricke ins Klassenzimmer kommt, sieht er noch strenger aus als sonst. Sein Monokel sitzt fest im Auge, und er räuspert sich, bevor er eine kurze Mitteilung verkündet. Vor ein paar Tagen, sagt er, habe ein Jude in Paris einen wichtigen Deutschen ermordet, der Ernst vom Rath hieß. Das hat gute Menschen in ganz Deutschland empört. So wütend waren die Leute, dass sie die Schaufenster einiger jüdischer Läden eingeschlagen haben. Niemand ist verletzt worden. Nur eine Menge Glas wurde zerbrochen. Dann jedoch, um die Deutschen in aller Welt schlechtzumachen, haben die Juden im ganzen Land ihre Synagogen in Brand gesetzt. Sogar hier in Chemnitz. Jetzt versuchen sie, den Deutschen die Schuld in die Schuhe zu schieben. In Wirklichkeit ist es Teil eines niederträchtigen jüdisch-bolschewistischen Versuchs, dem neuen Deutschland zu schaden und unser Volk schlechtzumachen.
Ich habe eine schlechte Meinung von den Bolschewiken. In der Kinderschar habe ich gelernt, dass sie böse Menschen in Russland sind, die sich vorgenommen haben, die ganze Welt zu erobern. Die Bolschewiken ermorden Frauen und Kinder, schlagen Babys zu Tode, schneiden Gefangenen die Zungen aus und vollbringen Taten, die so schrecklich sind, dass die Erwachsenen nur darüber flüstern können. Ich kann mir gar nicht vorstellen, um welche Taten es sich handelt, aber ich weiß, dass es mit verbotenen Dingen zwischen Männern und Frauen zusammenhängt. Ich weiß, dass die Bolschewiken so schlimm wie die Juden sind und dass die meisten Bolschewiken sogar Juden sind.
Ich höre zu, wie sich die Leute unterhalten: „Wisst ihr noch, dass wir früher Kommunisten in Deutschland hatten, auch bei uns in Chemnitz? Sie waren ebenso fürchterlich wie die Bolschewiken.“
„Ja, aber zum Glück sind sie jetzt alle eingesperrt, in Konzentrationslagern.“
„Das haben wir dem Führer zu verdanken.“
Mein Hass gegen die Juden, der in der Kinderschar begann, vertieft sich. Warum können sie uns nicht in Ruhe lassen? Warum müssen sie sich dem Führer widersetzen? Aber ich finde es immer noch schwer, zu glauben, dass Herr Goldstein Jude ist. Er sieht jedenfalls nicht wie ein Jude aus. Er sieht wie ein sehr guter Mann aus und benimmt sich auch so. Er ist groß, hat ein ganz normales Gesicht und eine stille, freundliche Stimme. Er ist immer hilfsbereit, wenn er meine Füße misst. Während Mutter und ich warten, bedient zu werden, oder während sie selbst ein Paar Schuhe anprobiert, darf ich gewöhnlich auf dem gelben Elefanten reiten, der vorn im Laden steht. Aber jetzt ist der Laden geschlossen. Hat sich jemand geirrt?
Als ich mittags aus der Schule nach Hause komme, kann ich zwischen den Holzbrettern in die Läden schauen. Im Schuhgeschäft ist der gelbe Elefant verschwunden. Der ganze Laden ist leer. Ich frage mich, wo Herr Goldstein sein könnte. Wo ist seine Frau, wo sind seine Kinder? Ich versuche, nicht mehr daran zu denken.
Ich komme zu Hause an und sehe, dass Mutter in der Einfahrt neben dem Auto auf mich wartet.
„Komm, wir fahren zur Synagoge. Sie soll gebrannt haben.“
Ich habe noch nie eine Synagoge gesehen und kann mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Schon das Wort klingt so fremd, exotisch und gefährlich. Jetzt denke ich an einen düsteren, geheimnisvollen Ort, wo Juden gespenstische, teuflische, bösartige Taten vollbringen. Wir fahren die kurze Strecke zum Kassberg, zum Stephansplatz. Ich sehe ein großes Backsteingebäude mit vielen Türmen und einer reich verzierten Fassade. Die Synagoge sieht einer Kirche ähnlich. Das Gebäude steht noch, aber nur als ausgebranntes Gemäuer. Von innen steigt Rauch auf. Die Feuerwehr ist noch am Löschen. Wir dürfen nicht näher heran, weil rund um den Platz Barrikaden aufgestellt worden sind. Viele Menschen sind wie wir gekommen, nur zum Schauen. Hinter den Barrikaden sehe ich SA-Männer und Polizisten. Wo sind die Juden?
Nun haben wir die Synagoge gesehen, und ich erwarte, dass Mutter mich nach Hause fährt. Ich habe Hunger. Es ist Zeit zum Mittagessen. Aber meine Mutter sagt: „Oma ist heute nicht zu Hause, um dir Mittagessen zu machen. Ich möchte schnell auf eine Minute zu Herrn Soremba. Danach gehen wir beide zum Essen.“
Ich bin enttäuscht. Ich esse nicht gern in Gaststätten oder Restaurants. Dort schmeckt nichts so gut wie die Kost, die Großmutter zubereitet. „Wo ist denn Oma?“
„Sie schaut sich nach einem Haus um.“
„Warum?“
„Frage mir doch kein Loch in den Bauch! Du wirst es noch zeitig genug erfahren.“
Mutter fährt zu Herrn Sorembas Wohnung, lässt mich im Auto sitzen und befiehlt: „Dass du ja nicht das Auto verlässt! Ich werde gar nicht lange weg sein.“
„Wirklich nicht?“, frage ich und denke an den Tag, an dem ich fast ertrunken wäre. Jetzt ist der Vergnügungspark geschlossen. Es bläst ein kalter Wind, und es hat angefangen, leise zu regnen.
Ich muss lange im Auto warten. Ich bin so hungrig, dass mein Magen nicht nur knurrt, sondern wehtut. Ich trage immer noch meine Schulkleidung: kurze Hosen, Kniestrümpfe, ein weißes Hemd und einen kurzärmeligen Pullover. Meine Füße und Hände werden kalt. Bald zittere ich am ganzen Körper. Der Himmel ist schwarz. Es wird zeitig dunkel um diese Jahreszeit. Bald regnet es in Strömen. Ich muss auf Toilette. Ich gehe hinter eine Hecke. Durchweicht renne ich zum Auto zurück. An der Straße, wo Mutter das Auto geparkt hat, stehen mehrere Mietshäuser mit Läden im Erdgeschoss. Ich weiß nicht genau, in welchem Herrn Sorembas Wohnung und Laden sind. Schließlich schlafe ich im Auto ein.
Als ich aufwache, ist es stockfinster. In der Ferne kann ich nur ein paar schwache Lichter sehen. Ich weiß, dass ich einige Stunden lang im Auto gewesen sein muss. Ich habe Angst im Finstern, und ich fühle mich nicht wohl. Endlich kommt Mutter zurück.
„Entschuldige, dass es so lange gedauert hat“, sagt sie, als sie den Wagen startet. „Ich konnte es nicht ändern. Wir gehen jetzt irgendwo was essen. Ich bin halb verhungert. Du auch?“
„Ich habe keinen Hunger mehr“, sage ich, „aber ich friere.“
Wir essen in einem kleinen Gasthof in der Nähe. Mutter bestellt mir eine kleine Schüssel Suppe mit einem Würstchen und einem Brötchen. Ich rühre kaum etwas an. Ich kann das Zittern nicht verhindern, und mir ist übel. Zu Hause steht Oma schon in der Tür. Sie hat den Wagen kommen hören.
„Wo seid ihr denn bloß gewesen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht! Ich habe schon die Polizei angerufen!“
Großmutter sagt, dass ich hohes Fieber habe. Sie bringt mich zu Bett. Sie wickelt meine Arme und Beine in kalte nasse Handtücher und legt einen nassen Waschlappen auf meine Stirn.
In meinem Traum tritt Herr Soremba mit einer brennenden Kerze ins Zimmer. An seiner krummen Nase, seinen schwarzen Knopfaugen und abstehenden Ohren erkenne ich, dass er Jude ist. Ich bin entsetzt. Er wird unser Haus niederbrennen. Ich schreie um Hilfe, aber es kommt kein Laut aus meinem Mund. Ich stehe auf und nehme einen Schuh, um ihn damit zu schlagen. Mein Schuh verwandelt sich in einen Stiefel mit eisernen Nägeln unter den Sohlen. Herr Soremba steht in der entgegengesetzten Ecke des Zimmers und hält die Kerze gegen den Vorhang. Der Rauch beißt mir in Nase und Hals und lässt mich husten. Dann werfe ich den Stiefel mit aller Kraft. Er trifft Herrn Soremba am Kopf, aber der lacht nur satanisch. Jetzt steht das ganze Zimmer in Flammen. Ich rette mich, indem ich aus dem Fenster springe und unten auf dem Boden lande. Ringsum ist zerbrochenes Glas. Überall weinen Menschen und schreien in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ich sehe, wie SA-Männer Herrn Goldsteins gelben Elefanten in einen Lastwagen laden. Ich rufe: „Herr Goldstein ist kein Jude!“ Einer der SA-Männer sagt: „Du bist selber ein Jude, du schwarzer Lockenkopf!“ Er hebt mich auf den gelben Elefanten und fesselt mich mit einem Strick. Er bindet meine Handgelenke zusammen, bis sie wehtun. Ich sehe, dass der Elefant blutet. Der gelbe Elefant aus dem Schuhgeschäft ist blutrot verfärbt. Ich versuche aufzustehen, kann mich aber nicht losreißen. Dann schwindet der Traum dahin.
Am Morgen darf ich ausschlafen und die Schule schwänzen. Als ich aufwache, ist Oma soeben aus der Stadt wiedergekommen. Sie erzählt Mutter aufgeregt, dass es gestern in ganz Deutschland zu antijüdischen Demonstrationen gekommen ist. Die Zeitungen nennen es Kristallnacht. Nicht nur die vielen jüdischen Einzelgeschäfte in Chemnitz, sondern auch die großen Kaufhäuser – Schocken und Tietz – sind zerschlagen und geplündert worden. Jetzt sind alle geschlossen. Ihre riesigen Schaufensterfronten sind verbarrikadiert. Oma fährt fort: „Überall in der Innenstadt sind große Menschenmengen. Vielleicht sind viele Leute nur neugierig, aber ich glaube, die meisten sind froh und zufrieden. Ich auch. Bestimmt werden die Juden nun endlich begreifen, dass im neuen Deutschland ein frischer Wind weht. Jetzt werden sie vielleicht verstehen, dass sie in Deutschland nicht mehr willkommen sind.“