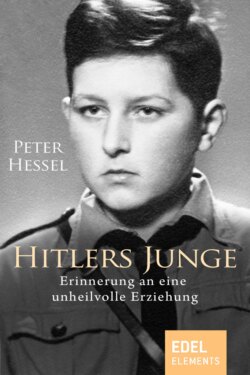Читать книгу Hitlers Junge - Peter Hessel - Страница 8
ОглавлениеKapitel 3
Gott und unser Führer
1937
Im August werde ich sechs. Großmutter hat mir beigebracht, in den Läden unserer Nachbarschaft kleine Einkäufe zu erledigen. Die meisten sind schräg gegenüber von unserem Haus in der Zwickauer Straße. Ich darf die verkehrsreiche Straße aber nicht allein überqueren, sondern ich muss vorübergehende Passanten anhalten und sie bitten, mir zu helfen. „Entschuldigen Sie bitte“, sage ich höflich und laut genug, „würden Sie mir bitte über die Straße helfen?“ Nach ein paar Wochen erkennen mich manche Leute schon, wenn ich auf dem Bürgersteig stehe und warte. „Na komm, ich bring dich rüber.“ Ich traue diesen Fremden vollkommen und danke ihnen für ihre Freundlichkeit. Meine Welt ist ein sicherer Platz. Oma legt Einkaufslisten und etwas Geld in einen kleinen Korb, der mit einem lila Tuch bedeckt ist. Das Tuch wird in der Mitte mit einem Band zusammengezogen. Mit meinem Körbchen in der Hand gehe ich von Laden zu Laden wie Rotkäppchen. Ich habe einen Zettel für die Fleischerei Kärnsch, einen für die Bäckerei Mühlberg, einen für das Gemüsegeschäft und so weiter. Die Ladeninhaber und ihre Angestellten kennen mich alle. Ich muss nur meinen Korb öffnen. Sie nehmen den entsprechenden Zettel heraus, suchen die bestellten Artikel zusammen, nehmen das Geld und legen die eingewickelte Ware mit dem Wechselgeld in den Korb. In der Fleischerei schenkt man mir meistens eine dünne Scheibe Wurst zum Kosten. Beim Bäcker ist mein Lohn ein Stück „Kuchenrindel“ von der Kante, die auf dem Blech übrig bleibt, nachdem der Kuchen in verkaufsgerechte Stücke geschnitten und ausgestellt wird.
Ich lasse mir Zeit, wenn ich vom Einkaufen wiederkomme. Ich studiere die vielen farbigen Schilder in den Schaufenstern der Läden auf beiden Seiten der Straße und versuche, die Buchstaben zu erkennen und mir zu merken. An der Ecke vor dem Volkshaus, an dem ich vorbeimuss, steht eine Plakatsäule. Fast täglich kommen Männer mit kurzen Leitern und kleben neue Plakate mit Leimbürsten über die alten. Manchmal lösen sie auch eine dicke Schicht Papier ab, ehe sie die neuen Plakate anbringen. Ich verbringe viel Zeit an dieser Plakatsäule, gehe langsam um sie herum, vergleiche Buchstaben und versuche, Wörter daraus zu bilden. Ich liebe dieses Spiel. Großmutter wundert sich oft, warum ich so spät vom Einkaufen wiederkomme. Ich gebe nie zu, dass ich mir das Lesen beibringe.
Überall hängen Plakate und Schilder mit Sprüchen und Losungen. Ich lese die langen Transparente, die an den Wänden der Gebäude angebracht sind. Manche Spruchbänder sind von Haus zu Haus quer über die Straße gespannt. Auch Anschläge im Kinderscharheim erinnern an die Errungenschaften des neuen Deutschlands. Bald kann ich die meisten Sprüche auswendig. Der eine mahnt dazu, den Anschluss zu unterstützen. Österreich – oder die Ostmark – soll zu Deutschland gehören: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Deutsche und Österreicher sind eine einzige Nation. Sie sollen ein Reich unter unserem geliebten Führer bilden. Ich trage die Sprüche zu Hause vor. Zu diesem Zweck sind sie angebracht worden. Sie sollen verstanden, aufgenommen und verbreitet werden. Ich bin ein eifriger, williger Schüler der neuen Ideologie.
Aber ich lerne nicht nur politische Parolen auswendig. Ich darf jetzt mit der gelben Straßenbahn Nr. 1 in die Stadt fahren. Genau vor unserem Haus ist eine Haltestelle. Wenn ich allein mit der Straßenbahn fahre, dann wird immer ausgemacht, dass Mutter oder Großmutter oder eine Tante mich am Hauptmarkt trifft. Dann gehen sie mit mir einkaufen oder in ein Café. In der Straßenbahn stehe ich gern ganz vorn auf dem Perron, in einer kleinen Nische neben dem Fahrer. Ich helfe ihm zu steuern und zu bremsen. Das darf ich nicht, wenn mich ein Erwachsener begleitet. Dann muss ich durch die Schiebetür ins Wageninnere gehen und mich setzen, wenn noch ein Platz frei ist. Wenn der Wagen jedoch voll besetzt ist und ein weiterer Erwachsener einsteigt, müssen Kinder aufstehen und ihren Sitz abgeben. Im Wagen gibt es auch Gelegenheit, das Lesen zu üben. Über den Fenstern, in der Rundung zwischen Wand und Decke, hängen Werbeplakate. Viele enthalten kurze Reime und farbige, lustige Zeichnungen. Nach und nach entziffere ich all diese Texte. Manche machen Reklame für Bullrich-Salz:
So wichtig wie die Braut zur Trauung
ist Bullrich-Salz für die Verdauung.
Ja, schon der Jäger aus Kurpfalz
nahm oft und gerne Bullrich-Salz.
Natürlich kenne ich das Lied vom Jäger aus Kurpfalz, der in alten Zeiten durch Wald und Heide ritt und das Wild abschoss – „grad wie es ihm gefallt“.
Es dauert nicht lange, bis ich alle Großbuchstaben in Druckschrift zeichnen und Wörter daraus bilden kann. Bald entziffere ich auch die Kleinbuchstaben, und nun kann mich nichts mehr aufhalten: Ich lese alles, was mir zu Augen kommt. Als die Frauen zu Hause entdecken, dass ich lesen kann, sind sie überhaupt nicht begeistert. Wenn ich sie frage, was ein gewisses schwierigeres Wort bedeutet, verweigern sie mir die Auskunft. Sie haben Angst, mein Gehirn könne Schaden erleiden, wenn ich es mit zu viel Lernen übermäßig anstrenge. „Lesen und Schreiben lernt man in der Schule! Dazu ist die Schule da.“ Eine Weile lang werden alle Bücher und Zeitungen vor mir versteckt. Ich bin sehr enttäuscht und fühle mich schuldig. Ohne es zu wissen, habe ich gegen eine Regel verstoßen, indem ich mir das Lesen beigebracht habe. Es ist eine Regel, deren Grund ich nicht verstehe.
Im Frühjahr 1937 kommen Onkel Otto und seine Frau, Tante Irmgard, zu Besuch. Sie wohnen jetzt im fernen Stuttgart, wo mein Onkel als Jurist bei der Reichspost tätig ist. Als mein Onkel mich sieht, hebt er mich wie immer hoch in die Luft und sagt:
„Meine Güte, wie schnell du wächst! Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis du in die Schule kommst und lesen lernst.“
„Ich kann schon lesen.“
Natürlich glaubt er mir nicht. Er hält mir eine Zeitung vor und sagt, ich solle die Schlagzeile lesen. Es dauert etwas länger, weil er die Zeitung absichtlich auf den Kopf gestellt hat. Ich buchstabiere langsam: „Zeppelin bald über Chemnitz“. Mein Onkel lächelt nur. Plötzlich ändert sich alles. Ich habe wieder Zugang zu Büchern und Zeitungen. Onkel Otto hat die Frauen überzeugt: Kinder, die zeitig lesen lernen, erleiden keinen Gehirnschaden.
Zu Ostern 1937 erfahre ich, dass ich in den Kindergarten komme. Niemand erklärt mir, was ein Kindergarten ist. Ich stelle ihn mir als einen sonnigen Garten vor, in dem Kinder frei herumlaufen dürfen und Blumen, Beeren oder Kirschen pflücken können. Bald lerne ich, dass ein Kindergarten überhaupt kein Garten ist. Vielmehr ist er eine Art von Schule im Erdgeschoss eines alten grauen Gebäudes in der Neefestraße, nur sieben oder acht Straßen von unserem Haus entfernt. Am ersten Tag geht Großmutter mit mir hin und überlässt mich an der Tür einer jungen Frau. Andere Jungen und Mädchen stehen herum. Manche weinen. Alle sind ebenso verloren wie ich. Wir sind alle besorgt. Was soll nun geschehen? Wir werden in Gruppen eingeteilt und verschiedenen Kindergärtnerinnen zugewiesen. Meine heißt Tante Irmgard.
Als Erstes lässt sie uns der Größe nach antreten. Dann lernen wir das Kindergartengebet, das jeden Morgen aufzusagen ist:
Händchen falten, Köpfchen senken
und an Adolf Hitler denken.
Er gibt uns täglich Brot,
er hilft aus aller Not.
Amen.
Tante Irmgard befiehlt uns, auf dem Fußboden zu sitzen und einen Kreis zu bilden. Ich kann gut unterscheiden, ob Frauen und Mädchen hübsch sind oder nicht. Tante Irmgard ist sehr groß und überhaupt nicht hübsch. Sie trägt immer ein breites Lächeln zur Schau, aber ihre Zähne sind schief und gelb. Immer hält sie ihren halb offenen Mund schräg angewinkelt. Sie spricht mit lauter, schriller Stimme und sagt uns, wie wir uns hinzusetzen haben: „Jeden Morgen nach dem Gebet üben wir das Zuhören. Das ist die Zeit, in der ich euch eine Geschichte aus einem Buch vorlese. Dabei habt ihr still zu sein. Verstanden?“
Sie schreit das Wort und zieht die letzte Silbe mit weit offenem Mund in die Länge. Verstandeeeen? Dabei verzieht sie ihr Gesicht zur Grimasse.
„Danach lernt ihr ein paar Buchstaben aus dem ABC. Das heißt, wenn ihr nicht schon lesen könnt. Ha, ha!“ Da sie aber nicht richtig lacht, sondern das „ha, ha“ nur spricht, merke ich nicht, dass sie nur scherzen will.
„Ich kann schon lesen“, sage ich. Zuerst trifft mich ihr Blick, als wollte ich nur die Ruhe stören oder sie verulken. Als sie aber merkt, dass ich nicht nur angebe, sondern wirklich lesen kann, stellt sie mich als ihren Helfer an. Sie teilt uns beim Vorlesen in zwei Gruppen ein. Sie liest der einen Gruppe vor. Mich setzt sie auf einen kleinen Stuhl, der auf einem niedrigen Tisch steht. So sitze ich hoch über den anderen Kindern. Zuerst bin ich stolz auf meinen Hochsitz, aber dann fangen einige Jungen an, mich zu verspotten. Ich bin verlegen und weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe nie gelernt, mit anderen Kindern umzugehen. An den Mittwochnachmittagen im Kinderschardienst ist jede Minute geplant und organisiert. Dort ist nie Zeit, um einfach mit anderen Kindern zu sprechen. Es gibt kein Necken und Ärgern.
Ich lebe mit Erwachsenen und bin nur an den Umgang mit Erwachsenen gewöhnt. Im Kindergarten bin ich plötzlich in den Pausen im Hof Gleichaltrigen ausgesetzt. Ich habe keine Schwierigkeiten mit den Mädchen, aber manche Jungen sind aggressiv. Sie beschimpfen mich und versuchen, mich herumzukommandieren. Sie werden auch handgreiflich, stoßen mich und schlagen mich mit Fäusten. Ich habe nicht gelernt, mich zu wehren. Ein Junge fragt mich, ob ich Jude bin, weil ich schwarze, lockige Haare habe. Ich bin zwar erst sechs Jahre alt, weiß aber genau, dass es die größte erdenkliche Beleidigung ist, Jude genannt zu werden. Wütend verneine ich:
„Natürlich nicht, ich bin arisch!“, protestiere ich.
„Ich glaube, du bist ein Arsch!“, sagt der Junge. „Ein Arschloch und ein Jude.“ Wie wehre ich mich gegen solche Reden? Tante Irmgard kommt zu Hilfe. Andere Kinder haben ihr gemeldet, was passiert ist. Erst lächelt sie und zeigt ihre gelben Zähne. Dann schimpft sie uns beide aus. Ich beschwere mich: „Ich will nicht Jude genannt werden. Ich bin doch kein Jude, ich bin Deutscher.“
„Selbstverständlich bist du kein Jude“, sagt Tante Irmgard und hört auf zu lächeln. „Wenn du ein Jude wärst, dürftest du doch nicht in diesem Kindergarten sein.“ Als ich den Vorfall meiner Großmutter erzähle, ist sie ärgerlich. „So ein Unsinn! Du siehst überhaupt nicht jüdisch aus. Der Junge weiß nicht, wovon er spricht.“
Ich weiß ganz genau, wie Juden aussehen. Im Kindergartenheim, in Büchern und Zeitungen habe ich Bilder von Juden gesehen. Juden haben krause schwarze Haare, nicht lockige. Sie haben riesige krumme Nasen, große fleischige Lippen und schlappe Ohren, die wie Topfhenkel vom Kopf abstehen. Sie haben eklige Haare, die ihnen aus Nase und Ohren wachsen. Sie haben dicke Bäuche, krumme Beine und Plattfüße. Sie sind die hässlichsten, abscheulichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. In Wirklichkeit sind sie ja gar keine richtigen Menschen, sondern groteske, scheußlich geratene Imitationen von Menschen. Sie sind unsere Feinde. Sie hetzen gegen uns und versuchen dauernd, Deutschland zu unterminieren und zu ruinieren. Ich hasse Juden.
Mutter erzählt, dass man in Deutschland die Juden schon hasste, als sie noch ein Kind war. Zum Beweis singt sie mir ein Lied vor, das sie gelernt hat, als sie vor dem Weltkrieg mit ihrer Familie auf der Nordseeinsel Borkum die Sommerferien verbrachte. Sie sagt, dass Borkum damals als die judenfreie Ferieninsel galt, auf der es nur Arische gab. Juden durften keinen Fuß auf die Insel setzen, ob sie in Deutschland wohnten oder nicht. Sie erinnert sich, im Hotel ein Schild gesehen zu haben: „Buchen Sie eine Reise von Borkum nach Jerusalem: Nur hin und nicht zurück!“ Sie singt mir das Borkumlied vor, das die Kapelle damals täglich im Musikpavillon spielte. Die Melodie war der Kaisermarsch aus Wagners Oper Tannhäuser. Mutter, ihre Familie und alle anderen Gäste sangen begeistert mit:
Doch wer dir naht mit platten Füßen,
mit Nasen krumm und Haaren kraus,
der darf nicht deinen Strand genießen,
der muss hinaus, der muss hinaus!
Es kann schwierig sein, mich mit den anderen Kindern im Kindergarten zu unterhalten. Sie sprechen ein Sächsisch, das ich manchmal kaum verstehen kann. Einige Kinder sagen, mein Hochdeutsch (auch mit deutlichem sächsischem Tonfall) klingt fremd und angeberisch. Ich versuche, das richtige Sächsisch zu lernen, aber wenn ich es zu Hause anwende, sind die Frauen entsetzt: „Wo hast du denn diese fürchterliche Sprache her? In dieser Familie wird kein gemeines Gossendeutsch gesprochen! Hier sprechen wir reines Hochdeutsch.“ Natürlich müssen sich auch die anderen Kinder bemühen, „gutes Deutsch“ zu sprechen, wenn sie mit den Kindergärtnerinnen reden.
Unsere Gruppe übt ein Stück ein, das auf dem Märchen Dornröschen beruht. Tante Irmgard beschließt, dass ich der Prinz sein soll. Der Prinz soll Dornröschen aus ihrem hundertjährigen Schlaf wecken. Wie? Er gibt ihr einen Kuss. Mit hölzernem Schwert in einer Hand und einem Schild aus Pappe in der anderen soll ich Dornröschen auf die Stirn küssen. Entweder habe ich die Anweisung nicht richtig verstanden, oder ich lasse mich von den roten Lippen des kleinen Mädchens verleiten. Bei der Probe küsse ich Dornröschen auf den Mund. Ich erschrecke, als sie nicht nur aufwacht, sondern mich auch auf den Mund küsst. Dornröschen, ein hübsches Kind mit langen blonden Zöpfen, richtet sich plangemäß auf, aber Tante Irmgard schimpft und nennt mich einen frechen Kerl. Sie wählt einen anderen Jungen, der nun zur Vorstellung vor den Eltern den Prinzen spielen soll. Meine Verlegenheit und Enttäuschung haben keine Grenzen. Ich bin so ein Dummkopf! Ich dachte, man küsst sich immer auf den Mund. Die Möglichkeit, Dornröschen auch auf die Stirn küssen zu können, war mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich glaube, der richtige Prinz hat Dornröschen bestimmt auf den Mund geküsst. Durch einen Kuss auf die Stirn wäre sie gar nicht aus ihrem langen Schlaf erwacht.
Anfang Juni nimmt mich Mutter mit, um Bekannte in der Erzgebirgsstadt Zschopau zu besuchen. Diese Leute haben ein Lebensmittelgeschäft. Ich freue mich, wenn sie mir sagen, ich kann im Garten tun, was ich will, während sich die Erwachsenen im Hause unterhalten. Der Garten ist wie eine kleine Obstplantage, die zur Straße hin von einer hohen Steinmauer umgeben ist. Viele Bäume strotzen von saftigen roten Kirschen. Der Mann nimmt mich beiseite und erklärt mir:
„Du darfst dir auch selbst Kirschen pflücken, aber nur nicht von diesem kleinen besonderen Baum. Der ist nämlich letztes Jahr neu gepflanzt worden und trägt zum ersten Mal Früchte. Verstehst du das? Wir wollen nämlich die Kirschen kosten, wenn sie vollständig reif sind.“
Er hätte meine Aufmerksamkeit nicht auf diesen kleinen Kirschbaum lenken sollen, der noch so klein ist, dass ich fast die Spitze erreichen kann. Die wenigen Kirschen, die er hervorgebracht hat, sind noch gelb, während die meisten Kirschen an den anderen Bäumen schon knallrot oder dunkelrot und reif sind. Da der Mann jedoch so begeistert über diesen kleinen, ganz besonderen Baum gesprochen hat, muss ich wenigstens eine seiner Kirschen kosten. Nur eine, um festzustellen, ob sie wirklich so besonders sind. Der kleine Baum trägt etwa zwanzig Kirschen. Eine weniger würde ja wohl nicht auffallen. Ich stecke eine in den Mund, und sie schmeckt ziemlich sauer. Ich spucke den Kern aus. Etwas treibt mich dazu, eine zweite zu probieren. Ich weiß nicht, warum ich dann die jungen Äste herunterbeuge und alle diese unreifen Kirschen pflücke. Ein paar esse ich gleich, die anderen stecke ich mir in die Hosentaschen. Ich klettere hoch auf die Steinmauer, wo ich meine, dass mich niemand sehen kann. Dort esse ich die übrigen Kirschen und spucke die Kerne hinunter auf den Fußweg. Nachdem ich alle Kirschen von dem kleinen Baum gegessen habe, gehe ich und pflücke einige rote, reife Kirschen von den anderen Bäumen. Sie schmecken viel süßer. Dann steige ich zurück und hocke mich in mein Versteck auf der Mauer.
Plötzlich werde ich von hinten an den Füßen gezogen. Der Mann schaut sehr zornig aus, und so klingt auch seine Stimme. Jemand hat ihm mitgeteilt, dass ein kleiner Junge oben auf der Mauer sitzt und Kirschkerne auf vorbeigehende Passanten spuckt. Als der Mann feststellt, dass alle Kirschen von seinem besonderen kleinen Baum verschwunden sind, wird er wütend. Er schreit mich an, wie noch niemand mich angeschrien hat. Er zieht mich am Kragen durch den Obstgarten, durch den Laden und ins Wohnzimmer. Meine entsetzte Mutter muss sich die Schauergeschichte meiner Untat anhören. Sie sagt, sie könne es kaum glauben. Ich sehe diese Familie nie wieder. Meine Strafe ist zu hart. Ich muss mit Oma zu Hause bleiben, während Mutter und Paul Matthes ohne mich nach Dresden zu einem Fußball-Länderspiel fahren. Das ist nicht fair. Ich hatte mich so sehr auf die Fahrt und das große Spiel gefreut.
Am Sonntag, dem 13. Juni 1937 ist Paul Matthes auf dem Nachhauseweg vom Länderspiel in Dresden. Mutter sitzt vorn auf dem Beifahrersitz. Onkel Pauls Eltern sitzen hinten. Am Stadtrand von Dresden missachtet der Fahrer eines kleinen LKWs die Vorfahrt an einer Kreuzung und rammt unseren Wagen volle Breitseite. Der DKW überschlägt sich. Das Hinterteil des Wagens ist völlig zerquetscht. Onkel Pauls Vater kommt ins Krankenhaus mit einer gebrochenen Hüfte und inneren Verletzungen. Onkel Pauls Mutter ist ebenfalls verletzt. Ich höre „tödlich verletzt“ und weiß zunächst nicht, dass es das Ende bedeutet. Sie stirbt bald nach dem Unfall. Meine Mutter hat instinktiv beide Arme angehoben und ihren Kopf zwischen die Knie gesteckt, als der Wagen begann, sich zu überschlagen. Das hat ihr das Leben gerettet, aber sie hat tiefe Schnittwunden in den Armen. Auch sie liegt in einem Dresdner Krankenhaus. Onkel Paul kommt allein zurück nach Chemnitz, mit der Bahn. Er erlitt eine leichte Rückenverletzung sowie Schnitt- und Quetschwunden. Unser Auto, unser schöner neuer Wagen ist ein Wrack. Großmutter umarmt mich, sagt aber nichts. Ich weiß, warum. Wäre ich wie vorgesehen nach Dresden mitgefahren, hätte ich hinten zwischen Onkel Pauls Eltern gesessen.
Unser Auto ist so schwer beschädigt, dass wir glauben, es nie wiederzusehen. Aber es wird repariert, frisch lackiert und eines Tages bei meiner Mutter abgeliefert. Es sieht wie neu aus, und so riecht es auch.
Später im Juni 1937 geschieht ein Wunder. Der Führer kommt nach Chemnitz, und ich werde ihn sehen! Oma und ich nehmen die Straßenbahn, steigen in einen Bus um und fahren bis zum nördlichen Stadtrand. Adolf Hitler wird auf dem Weg von Dresden durch Chemnitz kommen. Dort hat er die erste Autobahn in Sachsen eingeweiht. Wie ich bereits in der Kinderschar gelernt habe, ist die deutsche Autobahn das beste, modernste Straßennetz der Welt. Sie durchquert Deutschland von der See bis zu den Alpen. Der Führer hat sie persönlich entworfen. Tante Anita hat erzählt, dass Adolf Hitler nicht nur den größten politischen Führer und Staatsmann darstellt, den die Welt je gesehen hat, sondern dass er auch ein unglaublich begabter Künstler, ein schöpferisches Genie ist. Er hätte ein weltberühmter Maler oder Architekt werden können, wenn seine jüdischen Feinde ihn nicht als jungen Mann daran gehindert hätten, an einer Kunstakademie zu studieren.
Es ist ein Regentag. Wir laufen schnell von der Bushaltestelle zur Autobahn. Großmutter hält den Schirm über uns beide. Als wir ankommen, finden wir schon Tausende von Menschen kilometerlang Spalier stehen, obwohl es gießt. Natürlich trage ich Kinderscharuniform. Bald sind wir klatschnass. Es macht nichts. Ein deutscher Junge hat doch keine Angst vor Regen oder Kälte. Den Führer mit eigenen Augen zu sehen wird das größte Erlebnis meines Lebens sein. Es ist geplant, dass unsere kleine Kinderschareinheit dem Führer einen Feldblumenstrauß überreicht. Ich stelle mich zu Tante Anita und den anderen Kindern meiner Gruppe. Oma wartet unter ihrem Schirm bei den anderen Zivilisten. Der Autobahnabschnitt, auf dem Adolf Hitlers Autokolonne erwartet wird, liegt in einer Senke, die auf beiden Seiten von hohen Böschungen begrenzt wird. Überall ist neuer Rasen gelegt worden. Die versammelte Menschenmenge wartet in Spannung und hofft, wenigsten von Weitem einen Blick auf unseren geliebten Führer werfen zu dürfen. Auf den Autobahnspuren sind Barrikaden aufgestellt worden. Sie werden von SA-Braunhemden bewacht. Dahinter stehen schwarz uniformierte SS-Männer, HJ-Jungen und BDM-Mädchen und eine Reihe von Männern und Frauen in Zivilkleidung, die Hakenkreuzarmbinden tragen. Nur manche Gruppen dürfen auf dem mit Gras bewachsenen Mittelstreifen stehen. Ich bin stolz dazuzugehören und kann kaum glauben, dass alles hier wirklich passiert. Uns wird ein Platz auf dem Mittelstreifen in der Nähe einer Überführung zugewiesen. Hinter uns ist ein riesiges weißes Band über die Straße gespannt worden.
Wir stehen und warten eine lange Zeit. Wir dürfen uns nicht hinsetzen. Ich bin nass, und mir ist kalt, aber dadurch wird meine Stimmung nicht gedämpft. Tante Anita hält den großen Strauß aus weißen Margeriten, roten Mohnblumen und leuchtend blauen Kornblumen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie mich dazu aussucht, diese Feldblumen dem Führer zu überreichen. Welche Ehre! Nervöse Pressefotografen stehen neben uns auf Trittleitern. Kameraleute machen sich an ihren Geräten zu schaffen und versuchen, sie trocken zu halten. Nach einer Weile hört es auf zu regnen, und man sieht sogar einen kleinen Streifen blauen Himmel. Plötzlich kommt Leben in die Menge: „Der Führer! Der Führer!“ Alle Augen blicken in dieselbe Richtung. Ich strenge meine Augen an. Endlich kann ich die aus Osten herannahende Kolonne erkennen. Etwa zwanzig schwarz uniformierte SS-Männer auf Motorrädern fahren an der Spitze. Ihre schwarz glänzenden Stahlhelme spiegeln die Sonne wider, die nun erschienen ist. Hinter der SS-Kavalkade folgen drei oder vier große schwarze Autos. Alle sind Mercedes-Kabrioletts. Da es nicht mehr regnet, haben sie die Dächer geöffnet, und wir können die Männer in den Wagen sehen. Steif stehen auf den rechten vorderen Kotflügeln der glänzenden schwarzen Autos viereckige Hakenkreuzstandarten. Dann sehe ich Adolf Hitler, unseren Führer, selbst. Er steht rechts vom Fahrer in seinem langsam fahrenden Wagen. Er hält den rechten Arm zum deutschen Gruß erhoben und grüßt die Mengen, die gekommen sind, ihn zu sehen. Er dreht sich etwas nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links. Er trägt eine braune Uniform und eine Schirmmütze. Ein Dröhnen entsteht, als die Menschenmengen im Chor „Heil! Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!“ rufen. Auch ich schreie, so laut ich kann: „Heil! Heil!“ Dann stoppt die Motorkolonne genau vor unserer Kinderschargruppe, kaum zehn Meter von mir entfernt. Ein SS-Offizier öffnet die Wagentür für den Führer, schlägt die Hacken zusammen und grüßt mit erhobenem rechtem Arm. Adolf Hitler steigt aus! Nein, diesmal träume ich es nicht: Der Führer – unser Führer – steht genau vor uns, fast nahe genug, um von uns berührt zu werden. Der größte Mann der Weltgeschichte steht vor mir. Ich bin überwältigt von Ehrfurcht, und ich fange an zu beten:
„Bitte, lieber Gott, mach, dass Tante Anita mich wählt! Ich verspreche, mein ganzes Leben lang gut und brav zu sein.“ Ich bete so innig und ernsthaft, wie ich kann. Ich runzle die Stirn, um mich besser auf mein Gebet konzentrieren zu können.
Letzte Woche haben wir alle geübt, was wir zu tun haben, wenn die Wahl auf uns fällt, Adolf Hitler die Blumen zu überreichen. Lasst sie um Gottes willen nicht fallen! Ihr sagt kein Wort, ehe eine direkte Frage an euch gestellt wird. Dann antwortet ihr mit lauter, kräftiger Stimme! Die Mädchen haben gelernt zu knicksen. Wir Jungen wissen auch, was zu tun ist: strammstehen wie Soldaten und – wenn wir gewählt werden – die Blumen in der linken Hand halten und dabei den rechten Arm zum deutschen Gruß erheben. „Habt keine Angst“, hat Tante Anita gesagt, „ich werde gleich neben euch stehen.“ Aber jetzt sieht sie selbst besorgt aus. Mein Herz hämmert laut. Ich schließe die Augen und grabe die Fingernägel in meine Handballen. „Bitte, lieber Gott, mach, dass ich es bin!“ Aber stattdessen sagt Tante Anita, ich soll den Wolfsangel-Wimpel hochhalten, während sie den Blumenstrauß an Jutta reicht. An Jutta, das hübscheste Mädchen in unserer Gruppe. Das Mädchen mit den tiefen Grübchen in den Backen. Jutta mit den langen hellblonden Zöpfen und den blauen Augen, die so schön zu den Kornblumen im Strauß passen. Jutta strahlt und geht einen Schritt vorwärts, gemeinsam mit Tante Anita. Beide knicksen, und Jutta überreicht den Feldblumenstrauß dem Führer. Jutta, nicht ich. Adolf Hitler nimmt die Blumen an. Er beugt sich nach vorn und sagt etwas, was ich nicht hören kann. Er tätschelt Juttas blonden Kopf und kneift ihre Backe, wo eines ihrer Grübchen ist. Mein Herz tut weh vor Neid. Ich weiß, dass ich nur Freude verspüren sollte, dass ich dieses große Ereignis erleben kann, aber mein überwältigendes Bedauern und meine Eifersucht verderben alles. Ich bin wütend auf Tante Anita und wütend auf Gott. Er hat mich im Stich gelassen. Hat er mein Gebet nicht vernommen oder absichtlich nicht erhört? Ich bin nun überzeugt, dass nicht nur der Führer, sondern auch Gott ein Mädchen mit hellblonden Zöpfen und Grübchen in den Backen einem Jungen mit schwarzen Locken vorzieht. Das ist nicht fair. Aber ich gebe nicht dem Führer die Schuld. Er kann nichts dafür. Tante Anita hat die Schuld. Als ich mit meiner Großmutter zurück zum Bus gehe, kaum vorwärtskomme zwischen den Tausenden, die zurückströmen, gebe ich auch Gott die Schuld. Aber vor allem mir selber, weil ich nicht inbrünstig genug gebetet habe.
Tante Liesel arbeitet als junge Journalistin für das Chemnitzer Tageblatt. Sie schreibt für das Feuilleton und erhält oft zwei Freikarten für Konzerte, das Schauspielhaus und sogar für das Opernhaus. Da ihr Verlobter, Onkel Heinz, in einer anderen Stadt studiert, lädt sie oft ihre Mutter oder Geschwister ein, sie zu begleiten. Oder mich. Ich bin zwar erst sechs, habe aber schon öfters im Metropoltheater Operetten gesehen. Kurz vor Weihnachten nimmt Tante Liesel mich mit in die Chemnitzer Oper zu einer Aufführung von Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel. Ich bin enttäuscht, weil ich nur ausnahmsweise verstehen kann, was da gesungen wird. Auch die Musik finde ich verwirrend. Ich ziehe Theater vor. Auf der Schauspielbühne gibt es viel mehr Aufregendes zu sehen.
Im Sommer 1937 wirbt die Lufthansa für den Chemnitzer Flughafen und für das Fliegen schlechthin. Die Presse und die Öffentlichkeit werden eingeladen, an einem kurzen Rundflug über Chemnitz und Umgebung teilzunehmen. Ich bin begeistert, als Tante Liesel mir anbietet, mitzukommen. Fliegen ist ein unglaubliches Abenteuer. An einem sonnigen Nachmittag gehen wir auf dem Flughafen hinaus auf die Rollbahn und gehen an Bord eines großen silbernen Flugzeugs, das auf uns wartet. Seine Propeller surren und bilden durchsichtige Kreisscheiben. Es ist eine dreimotorige Junkers 52, eine gute „Tante Ju“. Das Flugzeug hebt ab und überfliegt Chemnitz, bevor es einen weiten Bogen rings um die Stadt beschreibt. „Ich kann sehen, wo Opa begraben ist“, sage ich zu Tante Liesel.
„Nein, das ist doch kein Friedhof“, lacht sie. „Was du siehst, sind nicht Gräberreihen, sondern Siedlungshäuser in der Vorstadt Altendorf. Sie sehen nur so klein aus, weil wir so hoch über ihnen fliegen.“
Ich bin so dumm! Wie konnte ich nur Häuser mit Gräbern verwechseln? Ich halte den Mund, bis wir landen. Zu Hause erzählt Tante Liesel über meinen Irrtum. Alle lachen, und ich fühle mich noch alberner. Mir steigt vor Verlegenheit das Blut ins Gesicht. Was hätte wohl mein Großvater gedacht, wenn er gewusst hätte, was für einen dummen Enkelsohn er hat?
Von unserem Küchenfenster aus sieht man den Nikolaifriedhof auf einem Hügel auf der anderen Seite des Kappelbaches. Großmutter und ich gehen mindestens jede Woche einmal dort hinüber. Wenn wir wegen schlechtem Wetter nicht gehen, winken wir aus dem Fenster in Richtung des Grabes.
Wenn wir aber auf dem Friedhof ankommen, begrüße ich meinen Opa, der hier begraben liegt. Während Oma sich bückt, um frische Blumen in die Vase zu stellen, gehe ich hinüber zum Zaun, hole die Gießkanne, fülle sie am Wasserhahn und bringe sie zum Grab. Etwas Wasser für die Vase. Der Rest für die Vergissmeinnicht, die zwischen Efeu rings um die erhöhte Grabstelle gepflanzt worden sind. Für die Stiefmütterchen und Primeln mitten auf dem Grab. Im Herbst sind es Astern. „Auf Wiedersehen, Opa, bis nächste Woche!“ Als ich jünger war – vier oder fünf –, habe ich über dem Grab meines Großvaters immer ein Gebet aufgesagt: „Bitte, lieber Gott, lass Opas Seele in Frieden ruhen!“ Seit ich die Uniform der Kinderschar trage, bete ich jedoch immer weniger. Tante Anita sagt, Beten sei sinnlos. Beten hält die Leute nur vom Handeln ab, und das neue Deutschland braucht Taten. Ich habe meine erste Lektion an der Autobahn gelernt: Beten hat keinen Zweck.