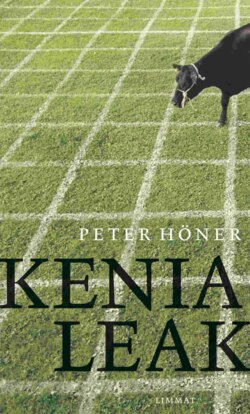Читать книгу Kenia Leak - Peter Höner - Страница 8
Restzeit: 4 T — 8 StD — 10 Min
ОглавлениеSie hatten die Räder ins Dickicht des Waldes geschoben, verhakten sie in den Zweigen, so dass sie um einiges besser standen als auf ihren Radständern, die im nassen Boden versanken.
Moody nahm Naomis Hand und zog sie über die Lichtung zum See. Sie zauderte, er spürte ihren Widerstand. Die junge Kenianerin vermied Berührungen, wurde nicht gerne angefasst, nicht von einem Mann, den sie erst seit ein paar Tagen kannte. Schüchtern war sie nicht. Ihrem Grossvater gegenüber konnte sie sehr energisch werden. Sie lachte gern und wusste, dass sie eine schöne Frau war.
Aber wenn sie allein waren, zerbröselte ihre Keckheit, und sie verwandelte sich in ein bebendes Etwas. Sie zitterte, und ihr Lächeln erlosch. Dabei glaubte er mehr als einen Blick erhalten zu haben, der ihm bestätigte, dass sie gern in seiner Nähe war. Auch sie musste doch zumindest ahnen, dass er nicht nur, weil ihn sein Grossvater gebeten hatte, sich um sie zu kümmern, seit bald zwei Wochen jede freie Minute mit ihr verbrachte.
Sie setzten sich auf die Bank am Ufer. Naomi löste ihre Finger aus seiner Hand und suchte in ihren Jeans nach einem Taschentuch.
Eine Finte, um von ihm abzurücken. Ein paar wenige Zentimeter, aber deutlich genug. Warum entzog sie ihm die Hand? Hielt eine Kenianerin ein Sich-bei-den-Händen-Halten bereits für einen Antrag?
Der Moorsee was so vollgelaufen, wie Moody dies noch nie gesehen hatte. Die Regengüsse der letzten Wochen überschwemmten die Ufer, der kleine Kiesstrand, der für den Badeplatz aufgeschüttet worden war, lag unter Wasser, selbst zwischen den Schilfpflanzen, die normalerweise aus dem Moorgrund ragten, schaukelte der See und gefährdete die Brutplätze der Wasservögel.
Die Natur litt unter dem unerwartet schönen Tag, dem grellen Licht, dem Temperaturwechsel. Von einem Tag auf den andern war es zwanzig Grad wärmer. Die Ufer glänzten und über dem Wasser waberte ein feiner Nebel. Die ganze Landschaft dampfte.
Sie sassen und schwiegen, als in unmittelbarer Nähe das Schilf raschelte und etwas ins Wasser platschte. Naomi erschrak und griff nach Moodys Arm, unterdrückte einen Schrei. Aus den schlanken Rohren schoss eine Schlange. Den Kopf über dem Wasser, einen Fisch im Maul, schnellte sie, ihren Körper wellenförmig aufgerichtet, fast direkt auf sie zu, änderte erst kurz vor ihren Füssen die Richtung und schlängelte sich durchs Gras. Der Fisch, fest im Griff ihrer Kiefer, sollte sich an der Luft zu Tode zappeln.
Auch Moody verkrampfte sich. Von Wasserschlangen hatte er gehört, gesehen hatte er noch keine. Das Tempo und die Wildheit des Tieres überraschten ihn.
Er legte seinen Arm um Naomi, zog sie an sich und hielt sie fest. Sie atmete schnell und stossweise, hob die Beine an, die Füsse, als ob sie jeden Bodenkontakt vermeiden müsse und ganz bestimmt nie wieder durch die Schlangenwiese zurück zu den Rädern gehen könne.
Auch er brauchte einen Moment, bis er sich beruhigte.
«Schlangen sind scheue Tiere und alle ungiftig. Hier. In der Schweiz. Um den See …», versicherte er Naomi. «Von einem Unfall habe ich noch nie etwas gehört. Im Gegenteil. Wer eine Schlange sieht, darf sich etwas wünschen.»
Und weil ihn seine Erfindung überzeugte und er merkte, dass sie sich etwas beruhigte, sich seine Umarmung gefallen liess, fragte er, was er schon lange gern gewusst hätte.
«Was erwartest du von deinem Aufenthalt in Europa? Du für dich? Die Begleitung des Grossvaters ist doch nicht der einzige Grund?»
Naomi schwieg, und weil er ihr Verstummen nicht zu deuten wusste, bohrte er nach:
«Ich weiss so wenig über dich. Dass du deinen Grossvater begleitest, dass du zwölf Jahre zur Schule gegangen bist, sogar die Matura gemacht hast, in einer Klosterschule. Dass du Schneiderin lernst und für die Kinder deiner älteren Geschwister Kleider nähst. Aber nichts über dich. Was du willst?»
Moody erschrak über die Art und Weise, wie er mit Naomi sprach. Immer ungeschickt und patzig. Als rede er mit einem Kind. Oder sei ihr Lehrer.
Schon bei ihrer ersten Begegnung war da diese Unruhe. Ihre Art, ihn anzuschauen, zu lächeln und den Blick zu senken. Wie sie sich bewegte. Ihre feinen Züge, trotz der kräftigen Nase ihres Grossvaters und dem breiten Mund. Alles an ihr verführte ihn dazu, sich vor ihr aufzuspielen. Djamila Ushindi Naomi sollte ihn, Marc René Moody, für etwas Besonderes halten. Er träumte von einer Beziehung, doch obwohl er durchaus glaubte, dass sie ihn mochte, spürte er keinen Augenblick, dass es sie in seine Nähe trieb, wie umgekehrt ihn, dem sie fehlte, sobald sie nicht um ihn war.
Hatte sie sich derart gut im Griff? Oder waren in ihrer Gesellschaft solche Gefühle nicht erlaubt? Liebe, Sehnsucht?
Sein Grossvater, dessen grosse Liebe eine Kenianerin war – seine Alice! –, behauptete, Liebe sei Unfug, überflüssiges Geschwätz. Selbst in Europa ein junges Phänomen, das sich früher niemand leisten konnte. Die Verbitterung eines alten Mannes. Eine Ausrede, um sein selbstgewähltes Eunuchentum zu verteidigen. Die Behauptung, es gebe keine glücklichen Paare und jede Liebe ende tödlich, fand Moody abartig. Da konnte der Alte solange auf Romeo und Julia verweisen, wie er wollte.
Naomi sass in Gedanken versunken. Ihr Griff, mit dem sie seinen Arm umklammert hatte, lockerte sich, und ihre Hand rutschte langsam seinen Arm entlang, vorsichtig und immer wieder nur ein kleines Stückchen, bis sie schliesslich in seiner Hand landete und sich ihre Hände umschlossen. Obwohl ihre Berührung nicht gerade natürlich und alles andere als bequem war, ihre Hände hatten sich gefunden, und lieber wäre Moody von der Bank gefallen, als seine ungeschickte Umarmung zu lockern oder Naomis Hand noch einmal loszulassen.
So, wie es war, sollte es bleiben, und bei allen Fragen, die seinen Kopf durchkreuzten, wagte er schliesslich nur die fast bescheidene Bitte, sie möge doch ein bisschen von Kenia erzählen, weil ihn nicht zum ersten Mal die Frage quälte, ob Naomi nicht längst einem andern Mann versprochen war.
Sie musste einen Freund haben, jemanden, der nach ihrer Mission mit dem Grossvater auf einer Heirat bestand. Warum sollte eine junge, gesunde und schöne Frau alleine bleiben, fragte er sich und kam sich dabei sehr erfahren vor.
Zwei Blesshühner schwammen vorbei, vom Schilfgürtel links zum Schilfgürtel rechts, über dem Wasser tanzten mehrere Libellen, unförmige Körper unter schillernden Flügeln, und etwas weiter oben startete ein Schwan; sie hörten, wie sein kräftiger Flügelschlag die Luft durchpeitschte.
Die Wasserschlange sahen sie kein zweites Mal.
Endlich sagte Naomi leise, den Blick gesenkt und wie zu sich selbst, aber ohne Moodys Hand loszulassen.
«Das Schlimmste ist eine Schwangerschaft.»
Naomi war schwanger? Schon die ganzen zwei Wochen. Von einem Mann, den er nicht kannte. Sie war hier, um abzutreiben. Sie war mitnichten so unschuldig, wie er geglaubt hatte.
«Am Anfang waren wir 26 Mädchen. Die Schule war ein Mädchenpensionat, das Haus unserer Lieben Frau. Es waren katholische Nonnen. Sie hatten uns ausgesucht, sie brachten uns alles bei, damit nachher möglichst viele von uns nach Nairobi an eine höhere Schule konnten. Wir durften das Schulgelände nicht verlassen, ausser in den Ferien oder wenn uns jemand von der Familie übers Wochenende nach Hause holte. Trotzdem wurden wir immer weniger. Wer schwanger wurde, musste die Schule verlassen. Von meiner Klasse blieben ganze acht übrig, die einen Abschluss machten.»
Naomi versuchte, ihre Hand wegzuziehen, aber er hielt sie fest.
«Erzähl weiter», bat er sie. «Was geschah nach dem Schulabschluss? Bist du nach Nairobi gegangen?»
«Mein Vater und meine Brüder haben sich für mich erkundigt, ich bin nur einmal mitgegangen. Ich weiss, was ich will. Aber dafür gibt es keine Ausbildungsplätze. Auf jeden Fall nicht dort, wo sie sich erkundigten. So richtig gesucht haben sie aber nicht. Viel wichtiger war es für sie, mir zu zeigen, was mich in Nairobi erwarten würde. Was mit Frauen geschieht, die ohne Mann in die Hauptstadt gehen. – Ohne meine Mutter und ohne meinen Grossvater wäre ich schon lange verheiratet. Zu einem guten Preis. Von allen Männern war nur der Grossvater der Meinung, dass eine Frau keine Kuh ist. – Vielleicht hat er das von deinem gelernt. Unsere Männer denken nicht so. – Die katholischen Schwestern hatten recht. Männer sind gegen uns.»
«Nicht alle. Auch in Kenia nicht. Und manchmal haben sie ja auch recht. Was ich so über Nairobi gehört habe … Ein leichtes Pflaster ist das für alleinstehende Frauen bestimmt nicht.»
«Und warum? Weil uns wild gewordene Männer nachstellen, weil sie uns schwängern und dann sitzenlassen. Weil sie keinen Respekt vor uns haben. Weil ihnen ihr Schwanz das Blut aus dem Kopf abzapft.»
Moody erschrak. War das noch das schüchterne Mädchen, das nach jedem Lächeln den Blick senkte? Unangenehm berührt, versuchte er, das Thema zu wechseln.
«Was willst du denn werden, was in Nairobi nicht zu lernen ist? Ich denke, du bist Schneiderin?»
«Das stimmt. Ich bin Schneiderin», sagte sie trotzig. «Aber ich will Modedesignerin werden. In Sultan Hamud haben sie es gemacht. Das ist in der Nähe von Nairobi. Auf dem Land. Auf dem Weg nach Mombasa, Herr Moody, der von Kenia nichts weiss. – Junge Designer der Abschlussklasse haben es allen gezeigt und aus afrikanischen Mustern und Stoffen eine eigene Kollektion entworfen. Collection of hope! Da will ich hin. An die internationale Modeschule ESMOD. In Berlin oder München. Und dass ich Schneiderin bin, wird mir dabei helfen. Und mein Schulabschluss bei den Nonnen …»
«Und ich!»
«Du?»
«Ja, ich. Ich kann dich hinfahren, dich begleiten. Nach Berlin! Nach München. Das sind nicht weniger gefährliche Städte als Nairobi. – Ich werde dich begleiten», und er drückte ihre Hand, als träfen sie damit eine Abmachung.
Die Blesshühner tauchten wieder aus dem Schilf auf und paddelten zurück zur anderen Seite.
«Wenn ich dir dabei helfe? Wenn ich dich begleite …», stammelte er und versuchte, sich aufzurichten und sich ihr zuzuwenden …
«Stopp!», wehrte sie seine Bemühungen ab. «Mit einem Kuss fängt es an. Auch wenn ein Kuss noch nichts bedeutet, aber eingeheizt wird.» Sie tauchte unter ihm weg und rutschte von der Bank. «Meine Hand musst du auch loslassen. Wir sind schon viel zu lange unterwegs, und ich will wissen, wie es dem Grossvater geht. Wie das ist, wenn einer nach zwölf Jahren wieder sehen kann.»
Moody stand auf, schüttelte Arme und Beine. Er streckte sich und schaute auf den See hinaus. Mit einem leicht gequälten Lächeln drehte er sich nach Naomi um.
«Getraust du dich durch die Wiese zu den Velos, oder soll ich dich tragen?»
Sie lachte und stapfte durch die Gräser zu den Rädern.