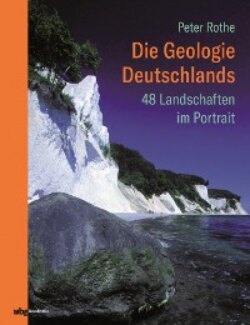Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Siebengebirge
ОглавлениеDas kleinräumige Vulkangebiet des Siebengebirges am Mittelrhein ließe sich auch im Zusammenhang mit dem Tertiärvulkanismus der Eifel oder des Westerwaldes behandeln, gleichzeitig aber auch der Niederrheinischen Bucht zuordnen. Unter seinen Vulkanen ist der Drachenfels der berühmteste, dessen vom Rhein angeschnittene Flanke etwa 260 m über dem Fluss aufragt. Der Trachyt ist durch zentimeterlange Sanidinkristalle (oft Karlsbader Zwillinge) gekennzeichnet, deren räumliche Anordnung im Vulkankörper seinerzeit durch H. und E. Cloos eingemessen wurde (Abb. 30); dabei wurde deutlich, dass die Kristalle ein Fließgefüge abbilden, das das Eindringen der zähen Schmelze in das Nebengestein nachzeichnet. Gleichzeitig ergab sich dabei, dass die als Quellkuppe bezeichnete Struktur nicht mehr vollständig erhalten ist: Es fehlen etwa 80 m des oberen Teils, die inzwischen abgetragen sind.
Der Trachyt vom Drachenfels ist ein wesentlicher Baustein für den Kölner Dom gewesen. Später, im Jahre 1900, hat man dann aber das gesamte Siebengebirge unter Naturschutz gestellt.
Der zweite, bekanntere Berg dort ist die Wolkenburg, deren strukturelle Form, als „Stoßkuppe“ bezeichnet, ebenfalls in die allgemein geologische Literatur eingegangen ist; ihr Gestein (Quarzlatit) unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem des Drachenfels. Petersberg, Nonnenstromberg, der Große Ölberg und einige andere im Norden dagegen sind aus Basalten aufgebaut (Abb. 31).
Abb. 30: Grundriss und Profil durch die Trachyt-Intrusion des Drachenfels im Siebengebirge. Anhand der eingeregelten Feldspatkristalle ist die Fließtextur der zähen Schmelze zu erkennen. Im Profil ergibt sich daraus auch, dass der höhere Teil der Kuppe bereits abgetragen ist (aus Cloos 1936).
In der Fläche überwiegen aber Trachyttuffe, die den aus unterdevonischen Gesteinsfolgen gebildeten Sockel überdeckt haben. Zwischen diesem Sockel und den Vulkaniten sind allerdings noch limnische Tertiärsedimente eingebettet, die die Landschaft vor den Vulkanausbrüchen geprägt hatten.
Der Beginn des Vulkanismus im Siebengebirge war explosiv und man muss annehmen, dass in hoch liegenden Magmakammern schon lange vorher Differenziationsprozesse stattgefunden hatten, aus denen die trachytische Schmelze hervorgegangen war. Die Abfolge der Förderung verlief von Trachyt über Latit schließlich zu Alkalibasalten.
Eine zweite, weniger alkalische Differenziationsreihe führte von Alkalitrachyten über Foidtrachyte, Foidlatite, Foidlatitbasalte schließlich zu Phonolithen und Basaniten. Dieses „Kauderwelsch“ von petrographischen Bezeichnungen soll nur beleuchten, dass man in vielen Gesteinen des Siebengebirges Foide (Feldspatvertreter) finden kann, zu denen blauer Hauyn, Nephelin und Sodalith gehören.
Die erwähnten Trachyttuffe der Anfangsphase dürften ursprünglich mehrere Hundert Meter mächtige Decken gebildet haben, die aber durch Erosion zwischenzeitlich schon weit abgetragen sind. In diese Decken sind dann nachfolgend die Trachyte, Latite und Basalte in Form von Quellkuppen, Stoßkuppen, Gängen, Lagergängen und Schlotfüllungen eingedrungen, die heute durch die spätere Erosion wieder freigelegt sind. Das gesamte Vulkanfeld, vor allem aber manche der Gänge zeigen eine ausgeprägte Nordwest-Orientierung; diese Richtung ist in der nördlich angrenzenden Niederrheinischen Bucht auch die vorherrschende Störungsrichtung, sodass sich hier ursächliche Zusammenhänge vermuten lassen.
Besonders ausgeprägt ist in dieser Hinsicht der vom Stenzelberg nach Südosten verlaufende Rosenau-Gang aus Latit, aber es schlagen auch viele der kleineren Gänge diese Richtung ein.
Das Alter des Vulkanismus ist überwiegend Oberoligozän (28 bis 22 Mill. Jahre), die Tätigkeit, bei der dann überwiegend Basalte gefördert wurden, hielt aber bis in das Miozän hinein an, die jüngsten Zeugnisse sind jünger als 15 Mill. Jahre.
Neben den Vulkanen ist das Siebengebirge in Geologenkreisen auch durch eine an seinem Rande gelegene Fossil-Lagerstätte bekannt. Es handelt sich dabei um Ablagerungen eines oberoligozänen Süßwassersees, die in der Gegend von Rott (heute ein Golfplatz im Ortsteil von Hennef) im 19. Jahrhundert unter Tage abgebaut wurden, um Öl und Teer aus „Blätterkohle“ zu gewinnen; Rott ähnelt darin dem Vorkommen von Sieblos (siehe Rhön).
Außer Blätterkohle sind auch diatomeenreiche Gesteine und Braunkohlen kennzeichnend für Rott. Die fossile Pflanzenwelt umfasst neben den Bildungen im See selbst (u.a. Seerosen) eine reiche Vegetation aus der Umgebung, die ein warmfeuchtes subtropisches Klima belegt (u.a. Sabalpalmen). Im See lebten nur wenige Fischarten (Weißfische, Palaeorutilus). Bekannt sind vor allem Insekten (mehrere Hundert Arten, darunter auch Honigbienen) und vor allem gibt es hier Massenvorkommen von Libellenlarven. Zu den Wirbeltierfunden gehören Frösche (auch Kaulquappen), Eidechsen, Schlangen, Schildkröten, ein Riesensalamander (Andrias, vgl. Molasse von Öhningen), Krokodile, schweineähnliche Paarhufer, Hirsche, eine kleine Nashornart, ein Pfeifhase und diverse andere Nagetiere.
Infolge der Einbettung in die feinschichtigen Ölschiefer sind die Wirbeltierskelette sehr gut erhalten, was sie mit vielen anderen, in entsprechenden Faulschlammablagerungen gefundenen Fossilien gemeinsam haben (z.B. Messel). Das gilt in verstärktem Maße für die Insekten, bei denen sogar die zarte Flügeladerung von Libellen erhalten geblieben ist (Lutz 1996).
Abb. 31: Profile durch das Vulkangebiet des Siebengebirges (aus Geologische Karte des Siebengebirges 1: 25.000, 1900).
Hesemann 1975, Lutz 1996, v. Koenigswald 1989, v. Koenigswald & Meyer 1994