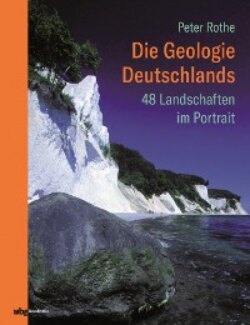Читать книгу Die Geologie Deutschlands - Peter Rothe - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Moselgebiet
ОглавлениеGeologen bezeichnen das aus paläozoischen Gesteinen aufgebaute, von der Mosel durchflossene Gebiet als Moselmulde; es ist damit vor allem der zwischen Hunsrück und Eifel gelegene Raum gemeint (vgl. Abb. 5).
Das enge Tal der über weite Strecken im Schiefergebirge eingeschnittenen Mosel hat der geologischen Großstruktur der Moselmulde ihren Namen gegeben. Die Mäanderbögen sind schon vor der jungen Hebung des Gebirges angelegt worden, als der Fluss noch über einer tiefer gelegenen Ebene pendelte; mit der Hebung haben sie sich dann bis heute ständig weiter eingetieft. Viele der Moselzuflüsse haben eine bevorzugte Nordwest-Südost-Orientierung, die sich mit der Anlage der variskischen Querstörungen erklären lässt.
Die Moselmulde hat geologisch ihre Fortsetzung nach Nordosten über den Rhein hinweg an der unteren Lahn, und die Struktur lässt sich bis in die Dillmulde hinein weiterverfolgen. Nordwest- und Südostrand sind durch bedeutende Überschiebungen tektonisch markiert: Die nördliche bildet die Fortsetzung der Siegener Hauptaufschiebung des rechtsrheinischen Bereichs und im Süden lässt sich die als Bopparder bzw. Boppard-Dausenauer Überschiebung bezeichnete Struktur ebenfalls über den Rhein an die untere Lahn verfolgen, bis sie unter den Basaltdecken des Westerwaldes verschwindet (vgl. Abb. 5).
Tektonisch ist weiterhin bemerkenswert, dass die Falten des auch als Mosel-Synklinorium bezeichneten Gebiets im Nordwesten nach Südosten überkippt sind, also eine ähnliche Rückrotation der Schichten zeigen wie am Südrand von Taunus und Hunsrück, ohne dass man das bisher eindeutig erklären kann. Im Südosten herrscht dagegen die im Schiefergebirge normale Nordwest-Vergenz der Falten vor. Im Gebiet zwischen beiden Vergenzen stehen die Schichten senkrecht, sodass in einem Profil quer zum Streichen eine Art Fächerstruktur resultiert. Die Tektonik wird auch durch das Abtauchen der Faltenachsen nach Südwesten bestimmt, während vom Mittelrheingebiet an im rechtsrheinischen Bereich diese Achsen nach Nordosten abtauchen; hier liegt eine sogenannte Achsenkulmination vor, die sich im Schiefergebirge auch noch weiterverfolgen lässt. Das wird hier nur erwähnt, um zu erklären, warum erst bei Wittlich, d.h. im Kern der Mulde, wieder mitteldevonische Wissenbach-Schiefer vorkommen.
Alle anderen Gesteine der Moselmulde gehören ins Unterdevon (Siegenium in Hunsrückschieferfazies und sandiges Emsium); im Hunsrückschiefer sind gelegentlich als Dachschiefer geeignete Partien ausgebildet, die noch bis vor kurzem bei Mayen im Untertageabbau gewonnen wurden (Wagner 2004).
Dieser Bereich ist einmal als tiefster Teiltrog der Rheinischen Geosynklinale bezeichnet worden, wobei Devon-Mächtigkeiten von annähernd 10.000 m erwähnt wurden, die aber möglicherweise auf tektonische Stapelung zurückzuführen sind; jedenfalls erreicht allein der Hunsrückschiefer am Mittelrhein bei Neuwied schon 5000 m.
Die Moselmulde ist damit auch strukturell ein tief eingesenkter Bereich der Erdkruste. Die starke Absenkung während des Devons hat sich in nachvariskischer Zeit noch fortgesetzt, wie man an der Wittlicher Rotliegendsenke feststellen kann, in der viele Hundert Meter Oberrotliegend abgelagert wurden (s. unten). Auch der Buntsandstein ist in dieser Gegend besonders mächtig und durch Tektonik in nachtriassischer Zeit abgesenkt worden. Selbst die oligozänen Vallendarer Schotter sind noch gestört, sodass hier eine lang anhaltende Senkungstendenz dokumentiert ist.
Im Untergrund der Wittlicher Senke liegt die eigentliche Grenze zwischen Hunsrück und Eifel, die hier durch die Trennfläche der Hunsrückschiefer-Überschiebung markiert wird, die die südwestliche Fortsetzung der Bopparder Überschiebung bildet.
In der Eifel-Scholle herrscht deutlicher Faltenbau, kaum Schieferung, in der Hunsrück-Scholle dagegen sind sogar zwei Richtungen der Schiefrigkeit ausgeprägt. Tiefes Unterdevon ist hier auf höheres Unterdevon und Mitteldevon aufgeschoben.
Eine besondere geologische Struktur, die an Störungen zwischen Hunsrück und Eifel in die rhenohercynischen Gesteinskomplexe eingesenkt ist, bildet die schon oben erwähnte Wittlicher Rotliegendsenke, die sich von Trier aus etwa 20 km nach Nordosten erstreckt (vgl. Abb. 5). Sie wird von roten klastischen Sedimenten und rhyolithischen Ignimbriten und deren Begleitgesteinen aufgebaut, die an Störungen gegen das Unterdevon im Nordwesten und Südosten grenzen. Ihre bis zu 1000 m mächtige Füllung mit kontinentalen Sedimenten, zusammen mit den Vulkaniten, ähnelt in vielem der der Saar-Nahe-Senke und sie wird auch stratigraphisch weitgehend damit verglichen. Neuere Forschungen gehen davon aus, dass ihre Entstehung nichts mehr mit dem variskischen Geschehen zu tun hatte, sondern eigenständig verlief, wobei jetzt von horizontalen Bewegungen entlang der Störungen ausgegangen wird, die die überwiegend aus der Eifel eingeschütteten Sedimente bereits in einer Frühphase der Entstehung um mindestens 3 km versetzt hatten (Stets 1990, 2004). Die Störungen grenzen einen im Kartenbild spindelförmigen Körper ein, was zu solchen scherenden Bewegungen passt; die Versatzbeträge der Hauptverwerfung im Nordwesten erreichen 900 m, im Südwesten bis 400 m. Die südöstliche Randverwerfung ist im Moseltal bei Trier erkennbar aufgeschlossen, wo am linken Ufer Buntsandstein der Trierer Bucht und am rechten Ufer Hunsrückschiefer anstehen. Das zeigt auch, dass die zur Zeit der Ablagerung des Rotliegends bereits aktive Tektonik noch bis in die Zeit nach der Trias weiter anhielt.
Landschaftlich spricht man von der Wittlicher Talweite, an deren Ausräumung die Mosel mit ihren Zuflüssen beteiligt war; ihr Verlauf wurde mit durch die trogartige Struktur der Wittlicher Senke gesteuert.
Stets 1990, 2004, Wagner et al. 2012