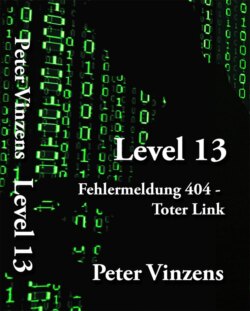Читать книгу Level 13 - Peter Vinzens - Страница 9
7. Kontakte in Tokio
ОглавлениеSchon die Fahrt vom Flughafen in die Stadt war chaotisch. Übrigens, was heißt hier Stadt? Tokio ist keine Stadt. Tokio ist ein Land für sich. Aber im Gegensatz zu anderen Ländern herrscht für Nichtjapaner dort ein fürchterliches Durcheinander. Kleinere Straßen haben keinen Namen, wenn sie einen haben sollten, findet man keine Schilder. Häuser haben keine Nummern, nur Namen, aber die findet man auch nicht. Parkplätze gibt es überhaupt nicht, also, ein Fremder kann sie nicht finden. Hotels sind unbezahlbar, nur wer auf Spesen reist, kann geringe Hoffnungen haben. Die Bewohner des Landes sind sehr freundlich, aber entweder versteht man sie nicht, oder die notwendigen Verbindungsleute sind gerade nicht erreichbar. Tokio, zumindest glaubt das der Fremde auf den ersten Blick, ist eine große Familie. Eng zusammenlebend, großzügig im gegenseitigen Umgang, fest verankert in konfuzianischer Tradition und westlicher Geldgier. Nur ein vermeintlicher Gegensatz. Natürlich stimmt das alles nicht, aber dem Fremden bleibt der Einblick in die Gesellschaft verschlossen. Fremd sind alle, die anders aussehen als Japaner, und das ist der Rest der Welt. Lila Haare, oder Streifen a’ la’ Indianer im Gesicht sind überflüssig, denn Japaner haben eine eigene Physiognomie, eine eigene Gestalt, eigenes Verhalten. Sie sind halt anders. Da sie aber in der Mehrzahl sind, logischerweise, fallen alle anderen eben auf. Trotz des Gedränges, trotz der Hektik, trotz aller Freundlichkeit. Der Ausländer, der Eindringling, der Fremde bleibt draußen.
Japanern wird nachgesagt, sie seien hartgesottene Geschäftsleute, das ist zutreffend. Ihnen wird zugeschrieben, der Tradition eng verbunden zu sein, Tradition gehört zum japanischen Überleben. Lebensfreude wird großgeschrieben, aber sie findet, abgesehen von offiziellen Anlässen, nur unter ihresgleichen statt, unter Japanern und unter Mitgliedern der gleichen sozialen Klasse. Vergleiche zwischen Engländern und Japanern führen zu erstaunlichen Parallelen, wobei die Japaner die geschäftstüchtigeren sind. Das mag auch an den Glaubensrichtungen liegen, denn der Japaner toleriert jegliche Religion für sich und andere. Selbst Mischungen aus verschiedenen, für uns unvereinzubarenden Weltreligionen kommen vor. Japaner vereinen gründlichen Mangel an Dogmatismus mit innerer Abgeschiedenheit. Japan ist für uns eine fremde Welt. Unergründlich, kaum kalkulierbar. Madame Butterfly ist eine einfältige Erfindung eines kaum vorkommenden Phänomens. Japan und die japanische Gesellschaft ist das Arbeitsfeld eines Fernsehteams aus Frankfurt, Deutschland, Europa.
Mit dem Taxi durch die Stadt zu fahren, ist die einzig gangbare Methode für ein Team überhaupt etwas zu finden. Außerdem erledigt sich dabei die vergebliche Suche nach Parkmöglichkeiten. Das Studio Tokio der Fernsehanstalt kann ein wenig mit seinen Verbindungen helfen. Aber in Industriefirmen und Regierungsstellen einzudringen, erfordert die Unterstützung eines japanischen Kollegen. Die kosten natürlich Geld. Wie gesagt: Japaner haben viel vom ‚goldenen‘ Westen gelernt.
„Es ist ungeheuer schwierig, unseren Firmen in die Karten zu sehen. Insbesondere natürlich, auf so sensiblen Bereichen wie Computertechnik, Lasertechnik und damit verbundene Simulationen. Die Empfehlungen, die Sie von den Vertretern der europäischen TEC.TO.N bekommen haben, sind zwar hilfreich, aber, und das müssen Sie auch in geschichtlichem Zusammenhang sehen, Japan ist bei allem misstrauisch, was von außen kommt. Denken Sie doch nur wenige Jahrzehnte zurück, an den Anfang dieses Jahrhunderts. Da war es Europäern und Amerikanern ja noch fast verboten, unser Land zu betreten. Mit Waffengewalt wurden wir gezwungen, das zu ändern. Vergessen haben wir das nie. Oder warum, glauben Sie, war der Eintritt in den Krieg mit den Vereinigten Staaten von Amerika möglich?
Und heute? Zuerst wurde uns nachgesagt, ‚die klauen Ideen‘. Das traf zum Teil auch zu. Aber dann, also heute? Heute klauen die Anderen bei uns. Japan ist die führende Macht in der technischen Entwicklung. Darauf sind wir stolz. Das dürfen Sie nie vergessen! Darauf sind wir stolz.
Ich werde versuchen in Ihrem Sinne etwas vorzubereiten.“
3. Drehtag Tokio, Industriepark Nord, Japan
Das Ende der Halle ist nicht zu erkennen. Zwischen den hohen Anlagen laufen nur wenige Menschen umher. Wie Astronauten sind sie verkleidet. Eingepackt in Anzüge aus Kunststoff, Filter an den Atmungsöffnungen, Schuhe aus weichem Material. Nicht die Menschen müssen vor den Maschinen geschützt werden, sondern die Maschinen vor den Menschen. Für Nichtbeschäftigte: Zutritt zur Halle verboten! Aus Gründen der Reinheit. Von der verglasten Galerie allerdings sind Dreharbeiten freigegeben. In den Kontrollständen gelangweilte, äußerst höfliche Techniker. Sie überwachen die Anlage und die Beschäftigten. Auf Monitoren Details der Fertigung. Vollautomatische Herstellung elektronischer Bauteile, vollautomatische Montage, vollautomatische Qualitätskontrollen. Nur die überwachenden Techniker sind noch nicht vollautomatisch. Dafür aber der Computer, der die Techniker überwacht. Hier könnte alles Mögliche hergestellt werden: Satelliten, Unterhaltungselektronik, Kriegsgerät, Schaltungen für Bügeleisen. Die fertigen Produkte haben kein Gesicht. Elektronik, programmierbar für fast jeden Bedarf.
Ein kurzer Imbiss wurde gereicht. In einem Raum von dem man auf die Produktion hinuntersehen konnte. Ein einfaches Mahl, sehr schmackhaft, dazu viel schwarzen Kaffee. Auf dem Tisch standen offene Flaschen mit Wasser. Die japanischen Begleiter verdünnten den Kaffee. Es sei besser für die Gesundheit, sagten sie.
In Glaskästen unter den hohen Fenstern zur Außenseite, standen die Produkte der Firmengruppe. Frühere und jetzige. „Wir können auf unsere Produkte sehr stolz sein,“ der Firmenvertreter redete in englischer Sprache, das erste Mal, dass er sich nicht des Übersetzers bediente. „Unsere Produkte beherrschen den Weltmarkt und die meisten Leute in der Welt wissen es noch nicht einmal. Je kleiner unsere elektronischen Bauteile sind, desto wichtiger werden sie und umso weniger fallen sie auf. Die Miniaturisierung begann ja mit der Entwicklung der Raumfahrttechnik. Leicht mussten die Geräte sein und sie mussten mehr können als jemals zuvor. Das war die Zeit, in der ein Großrechner noch mehrere Stockwerke benötigte, Röhrenbetrieb. Die Messtechniker waren den lieben langen Tag unterwegs, um all die kleinen Krankheiten zu finden, die die Dinger dauernd hatten. So was konnte man weder im Weltraum, noch auf der Erde gebrauchen. Also haben wir angefangen wartungsfreie, schnelle Technik zu entwickeln. Heute ist sie überall, im Bügeleisen, im Telefon, im Fernsehgerät, überall. Nicht nur in Großrechnern. Die Entwicklungsstufen stehen hier und erfreuen unsere Besucher. Ich will Ihnen ein paar Beispiele zeigen.“ Er sagte etwas auf Japanisch, die Schränke wurden aufgeschlossen.
Was er herausholte sah aus wie ein ganz normales Fernglas. Es fehlten aber die Linsen. Gitterähnliche Öffnungen an der Eintrittsseite verschlossen die Seite des Okulars.
„Mit diesem Gerät, gebaut aus unseren Bauteilen, wurde in England vor kurzem Galopprennsportgeschichte gemacht. Es ist ein Lautsprecher und ein Frequenzgenerator. Der Schallstrahl der heraustritt, ist aber so scharf gebündelt wie ein Laserstrahl. Bei höherer Energie, dazu müsste das Gerät natürlich größer sein, könnte man damit einen Menschen töten. Abhängig von Energie und Frequenz versteht sich. Für diesen Zweck ist das Fernglas allerdings viel zu klein. Aber es hat ausgereicht, das führende Pferd des Rennens völlig durcheinanderzubringen. Der Reiter stürzte, das Pferd war erst einmal nicht mehr zu gebrauchen. Es war das Werk eines Mannes, der seine Pferdewette gewinnen wollte. Wir haben es originalgetreu nachgebaut, weil wir es zuerst selbst nicht glauben konnten. Aber es funktioniert mit unseren Bauteilen. Das Original liegt natürlich noch bei der englischen Polizei. Seine Existenz bedeutet natürlich nicht, dass wir das Gerät jetzt für den militärischen Markt nachbauen wollen. Ich glaube sogar, das gibt es bereits. Aber ich bin Techniker, kein Militär.
Unter bestimmten Voraussetzung könnte damit vielleicht der, wie heißt das doch bei Ihnen gleich, der finale Rettungsschuss der Polizei ersetzt werden. Das aber ist zuerst einmal Sache der Humanmediziner.
Oder sehen Sie hier: Ein ganz normaler Wecker, wenn er aber läutet, ich stelle ihn mal ein, dann brauchen Sie nur in seiner Nähe eine Bewegung vorzunehmen und schon schweigt das Gerät für zwei Minuten. Nach dem gleichen Prinzip werden Raumsicherungen konstruiert. Früher hätten wir die Technik nie in ein so kleines Kästchen hineinbekommen. Damit kann ich natürlich auch Registrierungen von Bewegungen vornehmen und sie wissenschaftlich automatisch vom Computer auswerten lassen.
Dieses kleine Gerät kennen Sie alle. Es ist ein kleiner, transportabler Lichtlaser. In dem Ding ist alles drin. Batterie, Sender, Empfänger, Zielfindungsgerät, Signalgeber. Die Frequenz des ausgehenden Lichtes kennen wir, der Empfänger des reflektierten Lichtes kann Frequenzabweichungen errechnen und damit zum Beispiel weit entfernte Farben erkennen, Oberflächenstrukturen analysieren. Wenn Farbe und Oberflächenstruktur der reflektierenden Fläche bekannt sind, dann können wir Gegenstände, Kleidung, Menschen, was immer Sie wollen unterscheiden. Unsere neuste Entwicklung, ein schönes Teil.“
Auf die Frage, ob das Instrument auch militärisch einsetzbar sei, antwortete der Firmenmann mit einem „Militärisch ist alles einsetzbar, auch ein Küchenmesser.“ Das sei leider nun mal so. Aber, und dies sei ja bekannt, das japanische Volk unterhalte heute keine nennenswerten militärischen Streitkräfte mehr. Japan sei dafür kein Markt. Japan sei ein friedliches Land, heute.
„Sie kennen die Abenteuersimulationsanlage, die kürzlich auf dem europäischen Markt herausgekommen ist. Ein Produkt unseres Konzerns.“ Der Dolmetscher übersetzt die Worte des Firmenvertreters, übersetzt auch die Fragen an ihn. „In dieser Halle werden die elektronischen Bauteile gefertigt, montiert und programmiert. Die nötige Hardware und die Werkzeugmaschinen stammen aus der Produktion des Konzerns. Die Software kommt aus unserem Forschungsinstitut. Alles unter einem Dach, wenn Sie so wollen. Wir arbeiten auch eng mit in- und ausländischen Universitäten und Instituten zusammen. Folglich ist das, was hier entsteht, irgendwie ein internationales Produkt. Das, was Sie in Ihrer Heimat gesehen haben, ist allerdings lediglich ein Abfallprodukt. Das Konglomerat des Machbaren. Ein Spielzeug. Die Mechanik der Anlage in Deutschland kommt übrigens von einer norddeutschen Maschinenfabrik. Auch hier internationale Zusammenarbeit. National sind heute die Möglichkeiten beschränkt, Sie kennen gewiss die Problematik mit Handelsbeschränkungen.“
Es war kein Wunder, dass ein Japaner das Thema Handelsbeschränkungen anders sah als ein Nichtjapaner. Denn das kleine Land im Pazifik schützt seine Wirtschaft durch rigide staatliche Einflussnahme. Da muss sich zum Beispiel ein Automobil aus nichtjapanischer Produktion einzeln auf seine Tauglichkeit für das Land prüfen lassen. Eine allgemeine Zulassung nach europäischem und amerikanischem Muster ist unbekannt. Es könnten ja Details verändert werden. Dahinter steckt natürlich Absicht. Die Fahrzeuge werden erheblich teurer. Steuern kosten sie ohnehin.
Zwar werden internationale Prozesse geführt, aber wer erkennt schon Prozesse an, wenn die Exekutive fehlt und das Urteil ungünstig ausfällt. Auf einen ernsthaften Wirtschaftskrieg will es allerdings niemand ankommen lassen. Unwohlsein aber bleibt zurück. Die Japaner wissen das, sie sind jedoch geschickt genug der westlichen Welt Anreize zu geben, sie nicht zu boykottieren. Einfuhren in den Ostblock sind, aus Furcht von US-amerikanischen Sanktionen beschränkt, und das Burenregime in Südafrika wird auch nur im gleichen Masse beliefert wie sich dies andere, europäische und amerikanische Firmen leisten. Außerdem will niemand auf japanische Produkte verzichten. Patentrechtlich sind sie mit an der Spitze des Weltmarktes.
Firmen dieser Größenordnung scheren sich ohnehin einen Dreck um internationale Abmachungen, wenn es um das große Geld geht. Eine Firmenlobby ist wie die andere. Deshalb verstehen sie sich auch so gut. Die Unterschiede zwischen ihnen sind verschwindend gering.
Die Konstruktionsbüros des Konzerns haben ein modernes Gesicht. Verschwunden sind Zeichenbretter und Rechenschieber. Die Konstrukteure sitzen vor Monitoren. Menschliche Einfälle fließen sogleich in Elektronik. Eigengesetzmäßigkeiten, bei denen der Mensch das schwächste Glied ist. Im Moment aber sind die Arbeitsplätze unbesetzt. Freiübungen im Mittelgang, jede Stunde einmal, fünf Minuten lang. Das lockert nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Im Übrigen wächst dabei der Gemeinschaftssinn, sagt der Übersetzer. Vorgesetzte turnen mit, eine Frage des Zusammenhalts. Die Fenster sind geschlossen. In Tokio herrscht wieder einmal Smog. Aber die Fenster wären ohnehin nicht zu öffnen, die Klimaanlage steuert Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, zum Wohle des technischen Geräts. Draußen ist dicke Luft, Lärm, kein Wind. Inversionswetterlage. Sie sind zum Essen eingeladen, der Konzern lässt sich nicht lumpen. Essen, so sagen die Japaner, sei die edelste Form Feinde kennenzulernen und Freunde sich zu verpflichten. Konfuzius soll das gesagt haben. Es gilt noch heute.
Während des Treffens wurden sie in das hauseigene Kino gebeten. Sie waren verwundert, einen Unterhaltungsfilm hatten sie nicht erwartet. Sie sollten ihn auch nicht zu sehen bekommen, obwohl, unterhaltend war es schon.
Nach kurzer Einführung lief ein Actionfilm an, elektronisch aufgezeichnet in High Definition Qualität. Vorgeführt von einem Großraumprojektor. Aber das war nicht das Interessante. Nachdem die Handlung einen kurzen Fortgang genommen hatte, stoppte einer der Herren die Projektion. Im Raum wurde es wieder hell. Die Herren aus Deutschland wurden gefragt, wie sie sich die Weiterentwicklung der Handlung vorstellen könnten. Der Reporter fühlte sich angesprochen, der Rest des Teams war in erster Linie verwundert. Die Entscheidung wurde zur Kenntnis genommen, weitergeleitet, das Licht verdunkelte sich wieder. Die Handlung entwickelte sich, wie der Reporter es gewünscht hatte. Nicht nur einmal, mehrmals. Nach Auskunft einer der Herren, der Inhalt des Filmes war für die Gäste inzwischen völlig uninteressant geworden, war der Eingriff im Abstand von zwei Sekunden möglich. Schneller könne zur Zeit der Rechner nicht reagieren, meinte er entschuldigend. Das Problem sei lediglich, zu erfahren, was der Zuschauer denn wolle. Beziehungsweise nicht wolle. Auch eine Vielzahl von Zuschauern könnten eingreifen, dann allerdings gehe es nach dem Mehrheitsprinzip, sehr demokratisch. Natürlich, der Sprecher lächelte milde, der Wille sei nicht unbedingt bindend, das Gegenteil könne es auch sein. Vorausgesetzt, man wolle die Leute erschrecken. Auch das habe ja seinen Reiz.
Es war das Gästehaus des Konzerns. Ein lieblicher Park umgab das große Grundstück. Abgeschirmt gegen die Umwelt. Japanischer Sand von japanischen Gartenbaumeistern geharkt. Japanische Spezialitäten. Das Mahl wird im Hocken eingenommen. Gäste bekommen ein Kissen. Trotzdem schlafen die Beine ein. Dreharbeiten, bei denen man herumlaufen könnte, zur Lockerung, verbietet die Höflichkeit vor den Gastgebern. Als die Gespräche stocken, präsentieren junge Damen in Kimonos traditionelle japanische Musik auf alten, japanischen Instrumenten. Für europäische Ohren fremde Laute, aber eine hervorragende Regie. Höflichkeit auf Japanisch.
Trotzdem ist das Essen ein Erfolg. Zusagen des Konzerns: Besichtigung und Dreherlaubnis des Simulationsparks im Untergeschoß eines Hochhauses in Tokio. Interviewtermin mit dem führenden Spieleerfinder des Konzerns. Besuch und Dreherlaubnis für begrenzte Bereiche im Lasersimulationszentrum. Besuch und Dreherlaubnis eines im Bau befindlichen Erlebnisparks im Westen des Landes, gelegen auf einer eigenen, kleinen Insel im Japanischen Meer.
Vorher sollen sie allerdings noch den großen, alten Mann, den Konzerngründer kennenlernen. Promoviert in Philosophie an der Universität Oxford. Promoviert in Physik an der Universität Heidelberg. Mitglied eines indischen Ashrams bei Kalkutta. Meister eines Zen Ordens. Chef einer der ältesten, mächtigsten Samurai Familien des Landes. Der Konzernchef im Hintergrund. Termin: Morgen. Abflug per Helikopter vom Dach des Verwaltungshochhauses des Konzerns in Tokio. Keine Drehgenehmigung, lediglich ein Gespräch.
Abends saßen sie zusammen in der Hotelbar. Abendessen inklusive. Sie hatten keine Lust mehr gehabt hinauszugehen. Sie hätten sich ohnehin nur verlaufen. Auf dem Tisch standen noch die Reste der Abendmahlzeit. Kaltes. Fisch, Käse, Brotfladen. Dazu tranken sie japanisches Bier. Es schmeckte noch nicht einmal so schlecht. Sie waren schweigsam, weniger, weil ihnen nichts einfiel. Sie waren hauptsächlich müde. Unaufgefordert kam der Barkeeper ab und zu vorbei und brachte neue Getränke. Es war der Zustand, zu müde zu sein um weiterzumachen, aber auch zu müde um wegzugehen.
Eine fröhliche japanische Gesellschaft kam herein. Lärmend, lachend, viele Männer, keine Frauen. Das Team schätzte auf eine Büromannschaft inklusive Chef bei einer Sauftour. Das soll es in Tokio oft geben, exzessiv. Wer dabei aus der Rolle fällt, wegen des Alkohols, hat keine Chancen mehr bei Beförderungen. Ein furchtbarer Stress für alle Beteiligten. Ein Aussonderungsverfahren.
Sehr besoffen war der Verein noch nicht. Noch nahmen sie ihre Umgebung zur Kenntnis. Der Barkeeper war solches anscheinend gewöhnt, reagierte gelassen, brachte das Bestellte. Dann entdeckte die Gesellschaft die Freunde aus dem alten Germany und schon war neuer Gesprächsstoff da. In anstrengendem japanischen Englisch setzten sie dem Team auseinander, dass die meisten unter ihnen bereits, anlässlich einer Firmenfahrt für besonders leistungsfähige Mitarbeiter in Deutschland gewesen waren. Heidelberg und München, Schlossbeleuchtung und Oktoberfest, badischer Wein und bayerisches Bier. Es musste eine lustige Fahrt gewesen sein. Einige hatten sogar noch Fotos dabei. Ernste Herrengruppen vor Hintergrund.
Natürlich erzählten sie auch von sich. Von ihren Frauen, die rund einhundert Kilometer entfernt in irgendwelchen Ortschaften saßen. Mit ihnen hatten sie fast nichts mehr zu tun. Die Karriere verlangte es. Da ist der Beruf. Die Ehre bei der Firma arbeiten zu dürfen, gelegentliche Auslandsreisen, Sondervergütungen.
Zuerst wurde gesungen, auf Schallplatten, die nur die Musik enthalten, keinen Gesang. Gesang wird von den Gästen dargeboten, verstärkt über die bareigene Discoanlage. Karaoke. Eine japanische Spezialität. ‚Am Brunnen vor dem Tore‘ auf Japanisch. Nicht ohne Reiz.
Dann wurde es rührselig, aber auch informativ. In Südamerika und England seien sie jetzt gewesen, nicht alle, aber ein paar Ausgesuchte. Großes würde sich da anbahnen. Es gelte ein Land völlig umzukrempeln. Ein friedliches Land solle der industrialisierten Welt nähergebracht werden, die industrialisierte Welt solle dem Land nähergebracht werden. Die Auftraggeber säßen in England, einem sehr distinguierten Land, betonten sie. Sie seien natürlich nur für einen verschwindend kleinen Teil des Auftrages zuständig. Sie konstruierten und bauten lediglich Datenverbindungen. Telefone, Computerleitungen, Strecken für Fernsehen und Radio. Das Neue an dem Auftrag sei, dass die Fernsehstrecken in beiden Richtungen verlaufen sollten. Das Volk, jeder Einzelne, könne an seinem Empfangsgerät auf das Programm einwirken. Ein kleiner Steuerkasten gehöre zu jeder Empfangseinheit.
Die Meinung eines jeden Zuschauers könne von der Datenabteilung erfasst und in ihrer Gesamtheit ausgewertet werden. Fernsehen sei nun ein echtes Kommunikationsmedium geworden. Dialoge zwischen Betrachter und Sender inklusive. Der Zuschauer beeinflusse nun das Programm. Aber die Anlage sei noch in der Entstehungsphase. Eine gewisse Zeit würde es schon noch dauern. Die technischen Möglichkeiten seien aber jetzt schon überwältigend. Auf die Frage, wie denn ein Fernsehsender auf die verschiedenen Empfängerwünsche reagieren solle, lächelten die Herren zuerst nur. Der Chef, respektvoll überließen die anderen ihm den Vortritt, konnte, wenn auch sehr zurückhaltend, Auskunft geben. Der Sender könne, er wolle nicht zu viel sagen, da er nicht wüsste, ob die Patente auch alle angemeldet seien, die Handlung des laufenden Programms ändern. Früher sei das bereits versucht worden, wären an bestimmten Stellen des Films quasi Weichen in der Handlung eingebaut gewesen, aber das sei zu teuer. Im Rahmen der elektronischen Animation von Bildern, könne dies jetzt jedoch mit Computern bewerkstelligt werden. Im Übrigen wolle man die Freunde aus Deutschland nicht weiter mit diesem technischen Kram langweilen. Es solle doch noch ein wenig gesungen werden.
Der Kameramann, er war der älteste, bemerkte, als er einmal die Toilette aufsuchte, die zur Rückseite hin ein Fenster hatte, dass bereits der Himmel hell wurde. Wolken waren zu sehen, schnell ziehende Wolken. Anscheinend war bis auf Widerruf die Zeit des Smogs vorbei.