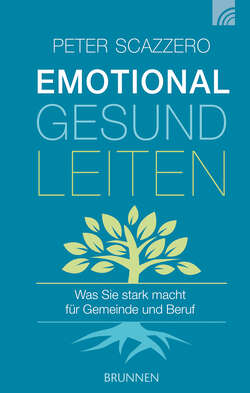Читать книгу Emotional gesund leiten - Peter Scazzero - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеVom Agnostiker zum Pastor mit Führungsqualitäten
Ich stamme aus einer amerikanischen Familie mit italienischen Wurzeln. In Sichtweite der New Yorker Skyline wuchs ich in einem kleinen Vorort auf. Wir lebten zwar nur ein paar Minuten entfernt von einer der kulturell vielseitigsten Städte der Welt, aber das Leben, das wir führten, war klar begrenzt – ethnisch, sozial und auch geistlich. Ich kann mich noch an einen Kommentar meines Vaters erinnern, als ich etwa zehn war: Als Katholiken seien wir die Minderheit in einer Stadt, in der sonst mehrheitlich weiße, protestantische Amerikaner mit angelsächsischem Hintergrund lebten. Ich war verwirrt. Alle unsere Freunde waren doch katholisch und die meisten von ihnen Italiener. Konnte man überhaupt etwas anderes sein?
Mein Vater war ein treuer Kirchgänger; meine Mutter gar nicht. Sie hielt es eher mit Wahrsagern, Tarotkarten und noch ein paar anderen abergläubischen Praktiken, die in ihrer italienischen Familie seit Generationen weitergegeben wurden. Wenn wir krank waren, rief meine Mutter zum Beispiel als Erstes die Dicke Josie. Josie war ein „Medium“. Sie sprach ein paar „Gebete“, um festzustellen, ob wir den „Blick“ hatten, jenes unsichtbare Anzeichen dafür, dass uns jemand mit einem Fluch belegt hatte. Dann gab sie Anweisungen, wie das „Unglück“ abzuwenden sei.
Auch wenn mir das damals nicht bewusst war, nahm meine frühe Prägung doch Einfluss auf meinen eigenen spirituellen Weg. Mit sechzehn hatte ich der Kirche den Rücken gekehrt und war überzeugter Agnostiker.
Vier Bekehrungen
Man kann sagen, dass ich vier Bekehrungen erlebt habe, und jedes Mal bekam mein Leben dadurch eine vollkommen neue Richtung.
Bekehrung 1: Vom Agnostiker zum engagierten Christen
Meine Teenagerzeit verbrachte ich wie die meisten meiner Freunde damit, nach so etwas wie vollkommener Liebe zu suchen. Allerdings suchte ich an den komplett falschen Orten. Das änderte sich, als ein Freund auf dem College mich zu einem Konzert in einer kleinen Pfingstgemeinde einlud. Dem Konzert folgte ein Aufruf zur Lebensübergabe an Christus. Wenn ich diese Geschichte erzähle, sage ich immer: „Gott hat meine Hand gehoben, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen.“ Angefühlt hat es sich jedenfalls so. Nach dem Aufruf schoss ich von meinem Platz hoch und stürmte nach vorn, beide Arme erhoben und mit einem Lobpreislied auf den Lippen. Ich kannte zwar nicht den Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament, aber ich wusste eins: Ich war blind gewesen und jetzt konnte ich sehen. Ich wusste auch ohne den geringsten Zweifel, dass Gott mich verändert hatte und dass seine Liebe mir galt. Neun Monate später war ich Leiter einer christlichen Studentengruppe. Eifrig gab ich Woche für Woche weiter, was ich selbst in eben der Woche gerade erst gelernt hatte.
Das war im Jahr 1976.
Ich war so dankbar für Jesus, der aus Liebe zu mir Mensch geworden und gestorben war, dass ich nicht anders konnte, als diese Botschaft an jeden weiterzugeben, der bereit war, mir zuzuhören. Auch an meine Familie. Besonders mit meinem Vater führte ich lange Gespräche über Glaubensfragen. Ich versuchte, ihn zu Christus zu führen, aber er blieb skeptisch.
„Pete, wenn das wahr ist, was du da von deinem Glauben und von Jesus erzählst“, sagte er, „wie kommt es dann, dass ich noch nie etwas von dieser ,persönlichen Beziehung‘ gehört habe, von der du redest?“
Aus seinem Gesichtsausdruck sprach Ärger, aber auch eine unbestimmte Trauer. „Wo sind denn all diese überzeugten Christen, von denen du erzählst? Wieso habe ich in sechsundfünfzig Jahren noch nie einen getroffen?“
Ich sagte nichts, doch ich kannte die Antwort. Die meisten Christen, vor allem die aus evangelikalen Familien, hatten mit unserer italo-amerikanischen Welt nichts zu tun. Tatsächlich fand mein Vater später zum lebendigen Glauben an Christus, aber dieses Gespräch habe ich nie vergessen. Es hat in mir ein Feuer entfacht: Ich wollte diese Kluft überbrücken. Ich wollte das Evangelium an jeden weitergeben, der es hören wollte.
Ich wuchs weiter in meine Rolle als christlicher Leiter hinein, als ich als eine Art Reisesekretär bei einer überregionalen Studentenmissionsarbeit angestellt wurde, der Intervarsity Christian Fellowship. In dieser Aufgabe besuchte ich Studentengruppen, predigte, lehrte und unterstützte sie in ihren missionarischen Aktivitäten. In den drei Jahren, die ich dort war, habe ich es häufig erlebt, dass die Begegnung mit Christus Menschen radikal verändert hat. Aus diesen Erfahrungen erwuchsen in mir zwei Fragen: Gab es diesen Reichtum des Glaubens und die sichtbare Lebensveränderung nur unter Studenten? Konnten Veränderung und lebendiges Engagement nicht auch eine ganze Gemeinde ergreifen und prägen? Es würde doch sicher der Ehre Gottes dienen, wenn das geschah.
So war es folgerichtig, dass ich ein Studium begann, das mich für eine leitende Funktion in einer christlichen Gemeinde qualifizieren sollte. Während des Studiums heirateten Geri und ich; Geri war ebenfalls für Intervarsity Christian Fellowship tätig gewesen und wir kannten uns seit acht Jahren. Kurz nach dem Studienabschluss gingen wir für ein Jahr nach Costa Rica, um Spanisch zu lernen. Was mich antrieb, war meine Vision: Ich wollte in New York eine Gemeinde gründen, in der es keine trennenden Grenzen geben sollte – weder durch Rasse, kulturellen Hintergrund, finanzielle Verhältnisse noch Geschlecht.
Im September 1987 war es so weit. Fünfundvierzig Leute besuchten den Gründungsgottesdienst der New Life Fellowship Church. In den ersten Jahren nach der Gründung erlebten wir das spürbare Wirken Gottes. Die Gemeinde wuchs rasch auf 160 Mitglieder an. Nach drei Jahren gründeten wir einen spanischsprachigen Gemeindezweig. Am Ende des sechsten Jahres hatten wir 400 Gottesdienstbesucher in New Life und 250 beim spanischen Gottesdienst.
Für einen jungen Pastor wie mich waren das bereichernde und begeisternde Jahre. Menschen kamen zum Glauben. Wir engagierten uns vielfältig und einfallsreich für die Armen. Wir schulten Menschen zu Gruppenleitern, zahlreiche Kleingruppen entstanden, wir betrieben eine Suppenküche für Obdachlose und halfen bei anderen Gemeindegründungen. Aber unter der Oberfläche standen die Dinge nicht zum Besten. Und das galt ganz besonders für mein eigenes Leben.
Bekehrung 2: Von emotionaler Blindheit zu emotionaler Gesundheit
Meine Seele war dabei zu verkümmern. Es gab immer zu viel zu tun und zu wenig Zeit dafür. Das Leben in unserer Gemeinde begeisterte mich noch immer, aber meine Führungsaufgabe machte mir keine Freude mehr. Es kam mir vor, als ob ich nur noch endlose, mühselige und undankbare Aufgaben abhakte. Nach der Arbeit hatte ich kaum noch Energie übrig, um mich um unsere Töchter zu kümmern oder den Abend mit Geri zu genießen. Um ehrlich zu sein: Ich träumte vom Ruhestand. Mit Mitte dreißig! In mir kam die Frage hoch: Muss ich wirklich unglücklich sein und ständig unter Druck stehen, damit andere im Glauben wachsen und Freude an Gott erleben können? So war jedenfalls meine Gefühlslage.
Ich hatte mit Neid und Eifersucht zu kämpfen, die Kollegen aus anderen Gemeinden galten. Sie hatten mehr Mitglieder, schönere Gebäude, nicht so viele Schwierigkeiten. Ich wollte nicht zum Workaholic werden, wie mein Vater es gewesen war und viele Pastoren, die ich kannte. Ich wollte wieder etwas vom Frieden des Glaubens erleben; ich wollte meinen Dienst tun, aber mit der Gelassenheit und Ruhe, die ich bei Jesus sah. Die Frage war nur: Wie?
Die Talsohle war erreicht, als sich unsere spanischsprachige Gemeinde 1994 abspaltete. Der Schock, den ich damals erlebte, steckt mir noch heute in den Knochen: Als ich den Gottesdienstraum betrat, fehlten zweihundert bekannte Gesichter. Ganze fünfzig waren geblieben. Alle anderen hatten eine neue Gemeinde gegründet. Menschen, die ich zum Glauben geführt hatte, um die ich mich als Pastor jahrelang gekümmert hatte, waren einfach gegangen, die meisten ohne ein einziges Wort.
Ich gab mir die Schuld für alles, was zu dieser Spaltung geführt hatte. Ich bemühte mich, dem Beispiel Jesu zu folgen (oder dem, was ich dafür hielt): Ich schwieg zu Vorwürfen, ich blieb stumm wie ein Lamm an der Schlachtbank (Jes 53,7). Ich dachte oft: Nimm’s, wie es ist, Pete. Das würde Jesus auch tun. Aber in mir tobten widersprüchliche und unbearbeitete Gefühle. Ich war tief verletzt und sehr wütend – vor allem auf den zweiten Pfarrer, der maßgeblich auf die Spaltung hingearbeitet hatte. Psalmworte sprachen mir aus der Seele: Ich war maßlos enttäuscht und am Boden zerstört durch den Verrat von jemandem, „der mir nahestand, [der] mein Freund und Vertrauter“ gewesen war (Ps 55,14). Zorn und Hass erfüllten mich und ich wurde diese Gefühle einfach nicht los, obwohl ich mich sehr ernsthaft bemühte, den Beteiligten zu vergeben. Wenn ich allein im Auto fuhr, ertappte ich mich dabei, dass ich unwillkürlich fluchte: „Dieser @#&%!“
Ich hatte keine Theologie für das, was ich erlebte. Ich hatte auch keinen biblischen Bezugsrahmen für Trauer und Leid. Ein guter Pastor sollte doch seine Herde lieben und gern vergeben. Das konnte ich aber nicht. Ich wusste, ich war zornig und verletzt, aber was in der Tiefe in mir vorging und was sich in meinem Innenleben abspielte, entging mir.
Ich machte alles und jeden für meine Probleme verantwortlich – die Gemeinde war einfach zu komplex, Gemeindeaufbau verlangte zu viel von einem, Geri beanspruchte mich zu sehr, die Kinder kosteten zu viel Kraft, vermutlich waren gegnerische geistliche Kräfte am Werk, die Gemeinde betete zu wenig … Es kam mir überhaupt nicht in den Sinn, dass meine Probleme ihre Ursache in mir und meiner Person haben könnten.
Irgendwie gelang es mir, die Dinge noch ein ganzes Jahr am Laufen zu halten, bis der endgültige Schlag kam: Am 2. Januar 1996 teilte Geri mir mit, dass sie aus unserer Gemeinde aussteigen würde.1 Es war das Ende jeglicher Illusionen, die ich noch hegte, dass ich an dem Chaos unbeteiligt sei, das in meinem Leben herrschte.
Die Gemeindeleitung riet uns zu einer Auszeit von einer Woche, in der wir versuchen sollten, eine Lösung für uns zu finden. Also verbrachten wir fünf volle Tage miteinander und im Gespräch mit zwei Seelsorgern in einem geistlichen Zentrum. Mein Ziel für diese Zeit war klar: Ich wollte Geris Probleme lösen, sie zur Vernunft bringen, damit unser Beziehungsschmerz aufhörte und wir uns wieder dem wirklich Wichtigen zuwenden konnten: der Gemeindearbeit. Womit ich nicht rechnete, war, dass Gott uns in dieser Zeit begegnen würde. Er tat es – und es hat unser Leben verändert.
Was ich erlebte, nenne ich meine zweite Bekehrung. Und wie bei der ersten erlebte ich auch diesmal: Ich war blind gewesen und hatte plötzlich neuen Durchblick. Gott öffnete mir die Augen und ich erkannte: Ich bin nicht nur Arbeiter in Gottes Weinberg. Ich bin sein geliebtes Kind. Entscheidend ist nicht, was ich tue, entscheidend ist, wer ich bin. Mit dieser Erkenntnis kam die Erlaubnis, schwierige Emotionen wie Zorn oder Trauer zuzulassen.
Außerdem wurde mir klar, wie viel Einfluss meine Ursprungsfamilie auf mein Leben hatte, auf meine Ehe, auf die Weise, wie ich die Gemeinde führte. Anfangs erschreckte mich diese Entdeckung; aber bald fand ich darin eine neue Freiheit. Ich konnte aufhören, jemand zu sein, der ich nicht bin, und machte erste Schritte darin zu lernen, der echte Pete Scazzero zu sein – mit meiner einmaligen Kombination aus Stärken, Leidenschaften und Schwächen.2
Aber diese zweite Bekehrung konfrontierte mich auch mit schmerzhaften Wahrheiten, die ich nicht länger leugnen konnte. Ich war auf dem emotionalen Entwicklungsstand eines Säuglings, versuchte aber, andere zu Müttern und Vätern im Glauben heranzubilden. Es gab weite Bereiche in meinem Leben, die von Jesus Christus überhaupt noch nicht berührt waren. Ich konnte die einfachsten Dinge nicht: wirklich präsent und wach sein oder einem anderen wirklich zuhören.
Fast zwanzig Jahre lang hatte ich die emotionale Komponente in meinem geistlichen Wachstum und in meiner Beziehung zu Gott ignoriert. Ich mochte noch so viele Bücher lesen oder Tage im Gebet verbringen – solange ich nicht zuließ, dass Christus selbst mein Leben in der Tiefe weit unter der Oberfläche veränderte, würde ich in meinem Schmerz und meiner Unreife gefangen bleiben.
Ich entdeckte, dass mein Leben einem Eisberg glich – nur ein kleiner Teil war mir bewusst, aber unter der Wasseroberfläche gab es einen weitaus größeren und meist unerforschten Kontinent. Und dieser unerforschte Kontinent hatte sich höchst unheilvoll auf meine Ehe und auf meinen Führungsstil ausgewirkt. Erst als ich verstand, dass die verborgenen, unterirdischen Aspekte meines Lebens noch gar nicht in Kontakt mit Jesus gekommen waren, entdeckte ich auch, dass geistliche Reife untrennbar verbunden ist mit emotionaler Gesundheit – es ist unmöglich, im Glauben zu reifen und gleichzeitig emotional stehen zu bleiben.
Das Eisberg-Modell
Was unter der Oberfläche ist
Es folgten Jahre, in denen Geri und ich unser Leben und unseren Dienst in der Gemeinde stark veränderten. Wir arbeiteten nur noch fünf Tage pro Woche, nicht sechseinhalb. In allem, was wir für Gott taten, war unser wichtigstes Anliegen, aus der Liebe und in Liebe zu handeln. Wir mussten lernen, was das heißt. Wir nahmen eine Menge Tempo aus dem Gemeindeleben in New Life heraus. Wir unternahmen unsere eigene Entdeckungsreise auf den unbekannten Kontinent unter der Oberfläche – und wir luden die Mitarbeiter der Gemeinde ein, uns dabei zu begleiten. Das Ergebnis war nichts Geringeres als eine kopernikanische Wende – im Blick auf meinen eigenen Weg mit Christus, auf meine Familie, auf meine Leitungsaufgabe. Die Gemeinde New Life Fellowship blühte wieder auf.
Bekehrung 3: Von Überaktivität zu entschleunigter Spiritualität
Als ich zum Glauben kam, verliebte ich mich in Jesus. Zeit mit ihm zu haben, Gebet und Bibellesen waren mir wichtig. Aber schon sehr bald überschattete meine Aktivität (was ich für Jesus tat) die kontemplative Seite meines Lebens (einfach da sein vor Jesus, bei Jesus). Und es dauerte nicht lange, da war ich in zahllose Aktivitäten für Gott eingebunden, die sich aber nicht mehr aus meinem Sein bei und vor Gott speisen konnten.
Meine dritte Bekehrung erlebte ich in den Jahren 2003 bis 2004, in einer viermonatigen Sabbatzeit. In dieser Zeit besuchten Geri und ich eine Reihe von Klöstern (protestantische, orthodoxe und römisch-katholische) und ließen uns ein auf den klösterlichen Lebensrhythmus von Einsamkeit, Schweigen, Schriftbetrachtung und Gebet. Am Ende unserer Sabbatzeit hatten wir einige radikale Veränderungen vorgenommen, um unser Leben zu entschleunigen. Unsere wichtigsten geistlichen Übungen wurden jetzt Zeiten des Alleinseins, Schweigen, das Beten des Stundengebets und eine bewusste Gestaltung des Sonntags. Die Freude und Freiheit, die wir darin fanden, waren so groß, dass wir uns fragten, ob Gott uns vielleicht aus dem intensiven Großstadtleben in New York City heraus und an einen ruhigeren und beschaulicheren Ort rief. Aber sehr bald wurde deutlich, dass eben diese geistlichen Übungen grundlegend dafür waren, dass wir in Queens bleiben und die Gemeinde weiterhin leiten konnten.
Ich hörte auf, darum zu beten, dass Gott segnete, was ich mir vornahm. Ich betete stattdessen, dass sein Wille geschah.
Ich lernte, Gott selbst und seine Nähe im Gebet zu suchen – nicht nur seine Segnungen.
Ich arbeitete weniger. Gott arbeitete mehr.
Mein Bild von Gott entwickelte sich: Ich sah ihn jetzt als immanent und transzendent und erkannte mehr und mehr, dass er ebenso in mir wie auch weit über uns hinaus am Werk ist.
Ich fing an, den Erfolg meiner pastoralen Arbeit nicht mehr am Spendenaufkommen und an der Zahl der Gottesdienstbesucher zu messen, sondern daran, ob es im Leben der Menschen Veränderungen zum Besseren gab. Diese neue Ausrichtung hatte enorme Auswirkungen, sodass es mich drängte, über unsere Erfahrungen zu schreiben. Das Ergebnis war mein Buch Glaubensriesen – Seelenzwerge. Die Gemeinde wuchs. Es gab spürbare Veränderung im Leben von Einzelnen. Ich fühlte mich persönlich und auch beruflich gestärkt. Aber noch immer war ein Territorium meines Eisbergs unberührt: die Frage der Leitung.
Bekehrung 4: Vom „Durchmogeln“ zu einem integren Führungsstil
Die Gemeinde gedieh in vielerlei Hinsicht, aber noch immer gab es eine deutliche Kluft zwischen dem, was ich über emotionale und geistliche Gesundheit gelernt hatte, und meinem eigenen Führungsverhalten als leitender Pastor. So bemühte ich mich im Hinblick auf mein persönliches Leben, unsere Familie, unsere Kleingruppen und unser Jüngerschaftstraining um eine emotional gesunde Spiritualität, aber auf mein Führungsverhalten hatte das kaum Einfluss. Mir war wohl bewusst, dass es an der Zeit war, emotional gesunde Spiritualität auch in den Strukturen unserer Gemeinde zu verankern, aber ich wusste nicht, wie das zu bewerkstelligen war.
Noch immer fühlte ich mich überfordert – ich musste mich um zu vieles kümmern (Predigen, Leitungsentscheidungen, Ausbildung von Mitarbeitern, Krisengespräche mit Mitarbeitern und Gemeindegliedern …). Und so mogelte ich mich um etliche schwierige Aspekte meiner Leitungsverantwortung herum.
Ich drückte mich um Begegnungen, wenn ich wusste, dass sie schwierig werden würden.
Ich beschönigte die Wahrheit, wenn es zu unbequem war, ganz ehrlich zu sein.
Ich drückte mich darum, die Arbeit von Mitarbeitern zu bewerten, wenn sie zu wünschen übrig ließ.
Ich stellte die notwendigen schwierigen Fragen nicht, wenn etwas offensichtlich schlecht lief.
Ich ging zu wichtigen Sitzungen, ohne mir vorher die Zeit genommen zu haben, mir über die Tagesordnung und meine Ziele klar zu werden oder wichtige Entscheidungen im Gebet vorzubereiten.
Ich plante nicht genügend Zeit ein, um übernommene Aufgaben auch auszuführen. Stattdessen gab ich allzu oft den Ball weiter und verhinderte so, dass meine Mitarbeiter ihr Bestes geben konnten.
An Tagen mit wichtigen Beratungen vernachlässigte ich meine Zeit für Gebet und Stille.
Und was vielleicht am schlimmsten war: Ich übersah konsequent die schmerzhaften Hinweise, dass mein Leben und mein pastoraler Dienst vielleicht doch nicht so gelungen waren, wie ich hoffte oder mir vormachte.
All das spitzte sich im Jahr 2007 zu. Verschiedene schmerzhafte Erfahrungen führten dazu, dass meine zwei Jahrzehnte lang betriebene Weigerung, wirklich zu führen, in sich zusammenbrach. Unter anderem musste ich eingestehen, dass die Gemeinde als Ganze an eine Grenze gekommen war. Wir waren zwar zahlenmäßig gewachsen und hatten eine emotional gesunde Kultur und eine kontemplative Spiritualität etabliert, aber am „Gemeindebetrieb“ und am Leitungsstil der Gemeinde hatte sich nichts verändert. Jetzt wurde deutlich: Wir mussten uns um dieses Problem kümmern. Und die Veränderung musste bei mir beginnen.
Noch einmal musste ich unter die Oberfläche meines Lebens sehen, und zwar genau – diesmal auf den unterschwelligen Schmerz und die Punkte, an denen ich als Leiter versagte. Als ich begann, darüber nachzudenken, welche Veränderungen wir brauchten, wurde mir bald deutlich: Die Prinzipien einer emotional gesunden Spiritualität im Leitungsstil und im Aufbau einer gesunden Gemeindekultur zu verankern, würde sehr viel komplizierter sein, als ich zunächst gedacht hatte.
Es gilt als Binsenweisheit bei Führungskräften, dass man Aufgabenfelder, in denen man selbst Schwächen aufweist, an Leute delegiert, die gerade dort ihre Stärken zur Geltung bringen können. Aber ich wusste: Das war keine Lösung. Stattdessen rückte ich die Schwachpunkte meines Führungsstils ins Zentrum der Aufmerksamkeit: Ich benannte in meiner Stellenbeschreibung ausdrücklich alle Aufgaben- und Verantwortungsbereiche des leitenden Pastors und übernahm so die Verantwortung dafür. Verrückt? Vielleicht. Aber ich war entschlossen, alles zu lernen, um diese Rolle auch ausfüllen zu können, zumindest eine Zeit lang. Ich nahm keine Vorträge mehr außerhalb der Gemeinde an, bildete ein Team für die Lehre, lehnte einen Vertrag für ein Buch ab und nahm selbst intensive Beratung im Blick auf die Unterwasserregionen meines Eisbergs in Anspruch – da ging es um alles, was mich daran hinderte, eine gesunde und effektive Führungsperson zu sein.
Im Lauf von zwei Jahren erwarb ich etliche neue Schlüsselfähigkeiten, die meisten mit erheblicher Mühe. Während dieser Zeit habe ich Fehler gemacht und Menschen verletzt. Aber es entwickelten sich auch mehr Mut und Bereitschaft, schwierige Gespräche zu führen, übernommene Verpflichtungen auch auszuführen und Daten und Fakten zu sammeln, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Manche Leute haben mich falsch verstanden, manche sind aus der Gemeinde ausgetreten. Aber ich habe gelernt, dass all das nicht so wichtig ist. Wichtig ist, dass ich meine Integrität nicht verliere. Und obwohl das oft schmerzhaft war, habe ich mit der Zeit gelernt, die Wahrheit nicht nur einzugestehen, sondern in jedem Fall danach zu suchen, ohne Rücksicht darauf, wohin das dann führt.
Ich war noch nie ein besonders begabter Leiter und werde es auch nie sein. Aber ich habe mich eine gewisse Zeit in diese Aufgabe investiert. Und Gott konnte ein paar Dinge an meiner Person verändern, die Veränderung dringend nötig hatten, wenn es mit der Gemeinde vorangehen sollte. Gerade durch die Feuerprobe meiner Führungsaufgabe konnte Gott ein paar Schichten meines falschen Ichs abschälen und mir zeigen, wie eine Veränderung von verborgenen Charakterseiten sich auf die Aufgaben und die Verantwortung eines Gemeindeleiters auswirkt.
Ja, es ist herausfordernd
Dieses Buch ist aus den Kämpfen und Lernschritten erwachsen, die ich im Anschluss an meine vierte Bekehrung 2007 durchlebt habe. In den Jahren seither habe ich regelmäßig Tagebuch geführt und darin meine Fragen, meine inneren Kämpfe mit Gott, meine Fehler und meine gelegentlichen Erfolge festgehalten. Trotzdem war ich sehr stark versucht, dieses Buch nicht zu schreiben. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich auf dieser Reise ein verwundeter Begleiter bin. Ich berichte ehrlich von den harten Lektionen meines eigenen Scheiterns. Und ich wünschte, ich hätte das, was ich hier beschreibe, lesen können, als ich selbst dreißig oder vierzig war.
Wenn Sie dieses Buch ernst nehmen wollen, wird es Ihnen eine Menge abverlangen – harte Arbeit, Ausdauer, Verletzlichkeit, Selbsterkenntnis und die Bereitschaft, sich zu verändern. Ja, es ist herausfordernd. Was ich Ihnen wünsche, ist, dass der Herausforderung eine überzeugende Vision zur Seite steht: eine Vision davon, wie viel sich zum Guten ändern kann, wenn wir mutig die Schritte tun, durch die Gott uns selbst und die Weise verwandeln kann, wie wir unsere Leitungsaufgabe wahrnehmen.
Was ich mit diesem Buch anbiete, ist die individuelle Perspektive eines Menschen, eines Pastors, der seit mehr als achtundzwanzig Jahren in einer Gemeinde engagiert ist. Sechsundzwanzig Jahre davon war ich der Hauptpastor; seit drei Jahren bin ich zuständig für Predigt und Lehre und allgemeine pastorale Aufgaben. Unsere Gemeinde in Queens besteht hauptsächlich aus ärmeren Mitgliedern, Leuten aus der unteren Mittelschicht, und umfasst dreiundsiebzig Nationalitäten. Es ist kein kuscheliges Umfeld, aber es hat guten, fruchtbaren Boden für Wachstum und Veränderung bereitgestellt – sowohl in meinem persönlichen Leben als auch in meiner Leitungsaufgabe.
Hinter diesem Buch steht ein leidenschaftliches Anliegen: Ich möchte, dass die Kirche langfristig ihrem Auftrag treu sein und darin fruchtbar sein kann. Aber wenn wir die Welt mit der guten Nachricht von Jesus verändern wollen, müssen wir uns zuerst auf eine persönliche Reise begeben. Und diese Reise wird uns unter die Oberfläche unseres eigenen Lebens führen. Auf den folgenden Seiten biete ich eine grobe Landkarte für diese Reise an und konkrete Vorschläge und Übungen, wie Sie den nächsten Schritt für sich selbst entdecken. Diese Landkarte richtet sich nicht nur an Pfarrer, Pastoren und Prediger. Jeder Christ, der in irgendeiner Hinsicht Leitungsaufgaben wahrnimmt – ob als Gemeindeleiter, Hauskreisleiter, Kirchenvorstandsmitglied, Ältester, Kleingruppenleiter, Kindergottesdienstmitarbeiter oder auch als Führungskraft in nichtkirchlichen Kontexten –, findet hier Anregungen, die ihm helfen, effizienter zu leiten und die eigene Person verändern zu lassen.
Wie Sie dieses Buch lesen können
Ich habe das Buch in zwei Teile gegliedert. Teil 1 beschäftigt sich mit dem inneren Leben, Teil 2 mit dem äußeren. In Teil 1 stellen wir uns vier Kernaufgaben, an denen kein Leiter vorbeikommt: den eigenen Schatten erkennen, Ehe oder Singledasein als Basis für gute Führungsqualität gestalten, das Leben verlangsamen, um Gottes Liebe zu erfahren, und die Einübung einer Sabbatkultur.
Teil 2 baut auf dem Fundament einer emotional gesunden Spiritualität auf und untersucht vier Kernaufgaben, mit denen jeder, der Führungsaufgaben wahrnimmt, konfrontiert wird: Planen und Entscheiden, Gemeindekultur und Arbeitsklima prägen, Umgang mit Macht und Grenzen, Abschiede und Neuanfänge gestalten.
Emotional gesund leiten lässt sich nicht schnell durcharbeiten. Lesen Sie langsam, machen Sie das Gelesene zum Gebet. Notieren Sie Ihre Gedanken und Fragen. Und wenn Sie den maximalen Nutzen von diesem Buch haben möchten, suchen Sie sich mindestens einen Lesepartner – oder nehmen Sie Ihr ganzes Leitungsteam – und lesen Sie es gemeinsam.
Mein Wunsch ist, dass dieses Buch die Tür öffnet zu einem ganz neuen Selbstverständnis und einer radikal anderen Weise, Leitung auszuüben. So wie Gott Abraham aus seinem vertrauten Umfeld herausrief, so, glaube ich, ruft er auch jeden von uns, vertrautes Gebiet zu verlassen und Gottes Ruf in unbekanntes, neues Territorium zu folgen – in ein Territorium voller Verheißung. Mein Wunsch ist, dass Sie auf diesen Seiten dem lebendigen Gott neu begegnen und wie Abraham entdecken, dass Gott vor Ihnen hergeht und Schätze und Erkenntnisse für Sie bereithält, die nicht nur Sie selbst verändern, sondern auch die Menschen, die Ihnen anvertraut sind.