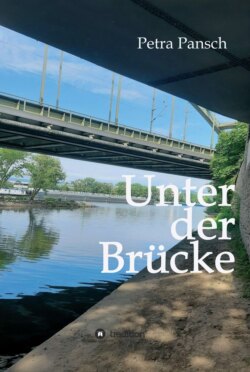Читать книгу Unter der Brücke - Petra Pansch - Страница 8
Оглавление2
Alles scheint zu gelingen, denn Helga und Egon verlieben sich. Nach seinem dreijährigen NVA-Ehrendienst packt er seine Sachen und zieht nach Ueckermünde. Ganz bald wird geheiratet und die junge Frau wird schwanger. Alles, wie in einem perfekten Märchen und außerdem so, wie es sich für eine junge sozialistische Familie gehört.
Januar 1966. Kalter Wind fegt vom Oderhaff über das flache Land. Er treibt die Schneeflocken weiter und weiter, bis ins beschauliche Ueckermünde. Durch Gassen und Straßen wirbeln sie; drehen sich im schnellen Tanz, bevor sie der gesamten Hafenstadt ein pudriges Aussehen verpassen. Natürlich zur Freude der Kinder, die jeden auch noch so winzigen Hügel nutzen, um zu rodeln. Ganz anders die Erwachsenen, die mit der stoischen Miene der Norddeutschen alles so nehmen, wie es kommt. Und es kommt in diesem Monat ziemlich dicke. Autoreifen mit wenig Profil, eine Tatsache, die in der DDR-Mangelwirtschaft zum Alltag gehört, schlittern trotz geübter Wagenlenker auf den vereisten Straßen. Den starken Kaltblütern, die noch immer hier als Zugpferde gute Dienste leisten, geht es keinen Deut besser. Sie müssen trotzdem ihre schweren Wagen, bestückt mit Braunkohlenbriketts oder Bierfässern, über die holprigen zugewehten Wege ziehen. Ihr Atem dampft und scheint wenig später in der Luft zu gefrieren. Die dickeingepackten Kutscher lassen die Peitsche nur wenig kreisen. Dieses Geräusch reicht schon, um das Gespann voranzubringen. Die Pferde spüren, dass ihr Tagwerk bald ein Ende hat.
Helga Richter, eine junge kleingewachsene Frau im grauen Mantel, der ihr über dem weitausladenden Babybauch spannt, setzt vorsichtig einen Fuß vor den anderen, um die Aschespur zu benutzen, die nur spärlich das glatte Eis auf dem Fußweg abschwächt. So fühlt sie sich geschützt. Nur gut, dass viele Hausbewohner die Asche aus den Kohleöfen sammeln und damit die Wege für die Passanten etwas sicherer machen. Mit der einen Hand balanciert die Vorsichtige ihr Gewicht aus, in der anderen Hand hält sie das Netz mit einem Kohlkopf, einigen Mohrrüben und schrumpeligen Äpfeln. Sie kommt vom Einkaufen aus dem Obst- und Gemüsekonsum und will nach Hause. Es ist nicht mehr weit, nur noch hinüber auf den anderen Fußweg und um die nächste Ecke. Gedankenverloren und im Geiste schon Weißkohleintopf kochend, tritt sie auf die Straße und übersieht das Fuhrwerk. Zum Glück beweist der Kutscher, dass er seine Pferde beherrscht, sie kommen zum Stehen. Aber die Hochschwangere kann sich nicht auf ihren Beinen halten, sie fällt, zum Glück nur auf den Popo. Ihr Schrei ist laut und durchdringend und die Vitamine kullern ungebremst über die Straße. Zupackende Hände stellen die Unglückliche wieder auf die Füße und sammeln die Ware ein. Ihren Bauch abtastend, den Kopf über ihre Unvernunft schüttelnd, zieht sie die Zipfel des Kopftuches fest. Wie angewurzelt steht sie, sicher ein Schock. Die Helfer schauen ratlos, doch es kommt Hilfe in Gestalt einer weiteren Frau. Die Ähnlichkeit der Beiden in Aussehen und Statur ist verblüffend, nur das Alter verrät, dass es Mutter und Tochter sind. Sie fallen sich weinend in die Arme. Inzwischen ist die Zuschauermenge beträchtlich gewachsen. Weder die Eiseskälte noch das Schneetreiben scheint sie zu stören. Erst als die Schwangere ihren Helfern dankt, von ihrer Mutter an die Hand genommen wird und sich langsam auf den kurzen Weg nach Hause begibt, gehen auch die Gaffer schnell ihres Weges. Nur dampfende Pferdeäpfel bleiben von dem Malheur übrig.
Aber der 15. Januar ist noch lange nicht zu Ende. Die Dunkelheit kommt an diesem klirrend kaltem Wintertag schnell und gnadenlos. Das spüren die Insassen im Haftarbeitslager in Berndshof, einem Ortsteil von Ueckermünde, doppelt hart. Ein Trupp Bausoldaten, der sich den Ordnungsübungen mit Holzgewehren verweigert, muss zur Strafe zwei Stunden stumm im eisigen Wind stehen, darunter Rainer Eppelmann, späterer Pfarrer und Bürgerrechtler. Erst durch einen unfreiwilligen Beobachter, der mit seinem Auto mehrere Male am Lagerzaun vorbeifährt, weil er solch ein Tun schlimm findet und sich das Ganze nicht erklären kann, fühlen sich die Bewacher gestört und beenden daraufhin diesen Willkürakt.
Dieser Beobachter im grauen Barkas fährt nachdenklich nach Hause, parkt später sein Auto und beschließt bei Hanne „Ums Eck“ ein, zwei Feierabendbiere zu trinken und etwas zum Abend zu essen. Auf Fritz Butzke wartet keine Frau, der 44jährige ist geschieden. Seine kleine Wohnung ist bei den frostigen Temperaturen ausgekühlt, heute Morgen hatte er eilig das Haus verlassen und keine Zeit gehabt, den Kachelofen mit in Zeitungspapier gewickelten Kohlestücken und Holzscheiten zu befeuern. Also ab, zur Wirtin und zu den Kumpels in seine Stammkneipe. Warmer Rauch und lautes Stimmengewirr schlagen ihm entgegen, als er die Tür öffnet. Am Stammtisch findet er noch einen Platz neben Egon Richter, seinem Skatfreund. Ein Gedeck, Bier und Korn, stehen kurze Zeit später vor ihm. Die Wirtin ist auf Zack und außerdem richtet sie ihr weibliches Augenmerk auf den Frauenlosen. In einem Zug kippt er den Kurzen und den halben Liter hinterher. Hanne bringt Nachschub, Fritz klopft ihr dankend auf das runde Hinterteil und bestellt eine große Portion Erbsensuppe mit Bockwurst und Brötchen. Er braucht jetzt etwas Warmes. Wenig später löffelt er die Suppe und sticht sich mit dem Löffel große Stücke von der heißen Wurst ab. Zwischendurch beißt er ins Brötchen und berichtet kauend, was er vorhin in Berndshof unfreiwillig gesehen hat. Er lässt seinem Unmut freien Lauf, wie Menschen bei solcher Kälte behandelt werden, dass würde ihn an den DEFA-Film „Nackt unter Wölfen“, ans KZ erinnern. Er beißt sich gleich darauf auf seine Zunge, Egon ist doch linientreuer Genosse. Aber der schaut unbeteiligt und zieht gedankenverloren an seiner „Caro“ und später gibt er eine Stammtischrunde aus, bevor er sich auf den Nachhauseweg macht. Früher als sonst, aber das ist verständlich, seine Frau ist hochschwanger und deren Mutter Trude ist dazu noch zu Besuch. Er reicht Hanne seinen Bierdeckel, er lässt anschreiben und wird seine Zeche erst nach dem nächsten Lohn bezahlen. Er schlägt mit der Faust zum Abschied auf den Tisch und weg ist er. Seine Schwiegereltern Paul und Trude mögen es gar nicht, dass er sich so unters Volk mischt. Er hat jetzt dank seines Schwiegervaters einen guten Posten als Parteisekretär im hiesigen volkseigenen Ziegelwerk und sollte Vorbild sein.
Egon Richter schlägt grummelnd den Mantelkragen mit beiden Händen um seinen Hals, seine gute Laune ist schlagartig weg. Es ist bitterkalt, hat wieder zu schneien begonnen und der Alkohol macht ihn ein wenig schwankend. Seine Beine wollen nicht so wie er es gern möchte und er friert. Wut kriecht langsam in ihm hoch und macht sich breit. Sein dicker Wollschal hängt zu Hause am Kleiderrechen. Helga hätte ihn doch darauf aufmerksam machen können, heute Morgen. Aber so sind Weiber und schwangere ganz besonders. Er runzelt seine Stirn zornig, denn er denkt an seine Schwiegermutter, die ihm gleich mit ihrem dummen Geschwafel den restlichen Abend vergällen wird. Aber es kommt ganz anders.
Im kleinen Wohnzimmer ist es kuschelig warm. Trude hat noch ein paar Kohlestücken nachgelegt, der Kachelofen strahlt Hitze aus. Obenauf thronen der Teekessel und Handschuhe liegen daneben zum Trocknen. In der Ofenröhre, hinter der schmiedeeisernen Ofentür, steht ein Topf mit dem Kohlgericht und schmort sanft vor sich hin. Es ist als Abendessen für Egon gedacht und beide Frauen hoffen, dass er bald nach Hause kommt. Ansonsten wird die leckere Suppe zu Brei. Helga sorgt sich, denn sie ahnt, dass ihr Ehemann schon einiges getrunken hat und dann kommt oft sein Jähzorn zum Vorschein. Besonders jetzt, wo sie ihm nicht mehr alle Wünsche erfüllen kann. Sie trinkt noch einen Schluck Tee und horcht in sich hinein. Ihr Steiß schmerzt noch immer von dem Sturz und sie hört im Geiste schon die Vorwürfe ihres Mannes über ihre Dämlichkeit, hinzufallen. Er meint, Frauen sind halt wie gackernde Hühner und seine besonders. Helga hat in den wenigen Jahren ihrer Ehe schon einiges erleben müssen. Die Krankenschwester hätte gelacht und ihren hübschen Kopf geschüttelt, wenn ihr jemand damals prophezeit hätte, dass sich Menschen so ändern können. Nichts ist mehr von der Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie er immer so schön zum internationalen Frauentag erklärt, zu spüren. Er, der später den Frauen rote Nelken überreicht, Kaffee einschenkt und Streuselkuchen auf die Teller schaufelt, ist das ganz Gegenteil. Sie fühlt sich allemal wie eine Ausgebeutete, so hat sie jedenfalls Karl Marx und Friedrich Engels und deren „Manifest“ verstanden. Ausgebeutet von ihrem Ehemann, denn nach der Schichtarbeit als Krankenschwester, bleibt alle Arbeit zu Hause an ihr hängen. Nicht vom Kapitalisten, der sich das Kapital anhäufen lässt, sondern vom eigenen Angetrauten ausgesaugt. Sogar den grauen Trabant, das Lieblingsstück ihres Mannes, den darf sie sonnabends vor dem Haus schrubben und auf Hochglanz putzen. Er macht hinterher nur noch die Qualitätskontrolle, ob alles stimmt, bevor er das beste Stück vier Straßen weiter auf den Garagenhof und in die kleine Garage fährt, bis zum Sonntagsausflug.
Ihre Mutter sitzt im Sessel, liest in der Zeitung und über die Brillenränder schaut sie von Zeit zu Zeit prüfend zu ihr. Der kleine Zeiger der Wohnzimmeruhr über der Anrichte steht auf acht und der große trifft die zwölf. Helga erschrickt, nicht nur wegen der fortgeschrittenen Zeit, nein, ein stechender Schmerz rast durch ihren Unterleib und ein Schwall Nässe quillt aus ihr. Darauf ihr Schrei, schmerzvoll und im selben Moment rutscht sie wie in Zeitlupe vom Stuhl. Ein Poltern auf dem gebohnerten Fußboden und gleich darauf ein weiterer Schrei, mehr ein forderndes, hohes Krähen. Trude Wagner greift geistesgegenwärtig zur Sofadecke und hebt das kleine, schreiende Menschlein auf, um es hineinzuwickeln und in die Sofaecke zu betten. Sie wird von jetzt auf gleich zur Großmutter und registriert, dass ihre Tochter dringend ihrer Hilfe bedarf. Dass schießt ihr durch den Kopf. Sie holt tief Luft als sie sich zur Tochter beugt, um sie etwas bequemer auf den Boden zu betten. Mit großen Augen schaut Helga sie an, sie kann das alles noch nicht begreifen, nur das schreiende Baby holt sie in die Gegenwart zurück. „Ist es gesund und alles dran?“, kommt es flüsternd über ihre spröden Lippen. „Ja, es ist gesund“, beruhigt ihre Mutter und streicht ihr eine feuchte Strähne aus dem Gesicht. Hoffentlich ist es so, bittet sie den lieben Gott, der ihr in besonderen Situationen näher liegt als der Staatsratsvorsitzende, Genosse Ulbricht. In ihrer Aufregung konnte sie sich weder davon noch vom Geschlecht des Säuglings überzeugen. Aber glücklicherweise ist es ein Junge, der zwei Wochen zu früh in diese Welt platzt, gesund, wie sie wenig später feststellt. Sie überlegt, geht in den Korridor zur winzigen Kommode, denn dort steht ein schwarzes Bakelit-Telefon. Eine Rarität, denn in der DDR gab es 1966 über den Daumen gepeilt etwas mehr als 308.000 Fernsprechhauptanschlüsse in Privatwohnungen, einer davon hier. Die Wählscheibe schnurrt, rastet dreimal ein und das Freizeichen ertönt, ungeduldig wartet sie, dass der Hörer im Krankenhaus abgenommen wird. Zum Glück hat ihr Schwiegersohn Egon aalglatt all seine Verbindungen ausgenutzt, um an dieses Prestigeobjekt zu gelangen. Da haben ihm seine Funktion als Parteisekretär und sein Schwiegervater, ein verdienter Altfunktionär, geholfen. Aber auch, dass zwei Häuser weiter ein Abschnittsbevollmächtigter sein Büro hat und sich die paar Meter Kabel ohne Schwierigkeit von Haus zu Haus verlegen ließen.
Eine Stimme meldet sich endlich und Trude Wagner erklärt aufgeregt, was passiert ist. Das Ergebnis: Ein Krankenwagen wird die Wöchnerin und das Neugeborene wenig später ins Krankenhaus bringen. Erleichtert nimmt Trude die gepackte Tasche, die griffbereit im Schlafzimmer seit einiger Zeit auf ihren „Geburts-Einsatz“ wartet. Vom „Neuen Deutschland“ reißt sie noch ein Stückchen weißen Rand ab, um für ihren Schwiegersohn mit einem Bleistiftstummel das Geschehene stichwortartig zu notieren. Dann klingelt es schon Sturm und die Sanitäter tun kurz darauf routiniert ihre Arbeit. Trude Wagner zieht den Mantel über, stülpt den Winterhut über die dauergewellte Lockenpracht und greift zur Reisetasche und zu ihrer Handtasche, um die Tür zu schließen und mit eiligen Schritten zum Sanka (Sanitätskrankenwagen) zu eilen, der mit durchdrehenden Reifen auf der vereisten Straße anfährt und zeitgleich sein Martinshorn ertönen lässt.
Egon Richter zieht an seiner Zigarette, die er sich trotz Schnee und Wind angezündet hat, da ist er auf dem halben Kilometer, die ihm von seinem Heim trennt, nicht ganz so allein. Außerdem denkt es sich so besser nach. Er ist schlecht gelaunt. Der Grund wabert behäbig durch sein Hirn. Immer diese Pflichten; zu gern wäre er noch „Ums Eck“ bei Bier und Korn geblieben und überhaupt im Moment hasst er alles, sogar sich. Er braucht ein Ventil und findet auch etwas. Er nickt, wirft den Zigarettenstummel in den Schnee, atmet auf und zieht den Schlüsselbund aus seiner tiefen Manteltasche. Sein Ziel ist erreicht und er schließt auf. Stille empfängt ihn, dass kommt ihm gelegen, da braucht keine Konservation mit seiner Schwiegermutter gepflegt zu werden. Komisch, irgendwie ist es aber viel zu still hier, als wären die Bewohner ausgeflogen. Wirklich, die weiblichen Wesen sind nicht in der Küche, nicht im Wohnzimmer und er drückt die Schlafzimmertür auf. Die Alte wird doch nicht so dreist sein, sich neben ihrer Tochter im Ehebett einzuquartieren, ihm seinen Platz wegzunehmen. Nein, alles ist unberührt. Es muss etwas passiert sein, aber was wohl. Auf dem kurzen Weg ins Wohnzimmer entdeckt er auf der Kommode neben dem schwarzen Telefon ein gerissenes Stück Zeitungspapier mit Bleistift bekritzelt. Er liest und es dämmert ihn, dass er Vater geworden ist. Stolz, Freude und auch Glück darüber, dass er dieses Kinderkriegen nicht mit eigenen Augen ansehen musste. Im Zimmer ist genügend Unordnung, nur gut, dass ihm das andere erspart blieb, wirft seinen Mantel über den Sessel und geht zum Schrank, um eine Flasche Weinbrand nebst Glas zu holen. Einen großen goldgelben Schoppen trinkt er auf den neuen Erdenbürger und ist sogar ein bisschen stolz auf seine Frau, die für einen Stammhalter sorgte. Er holt das Telefon ins Wohnzimmer. Zum Glück reicht das Kabel für die kurze Distanz und bei einer neuen Zigarette überlegt er, wen er zuerst anrufen soll. „Guten Abend“, so beginnt er,“ hier ist der Genosse Richter, ich möchte mit meiner Frau sprechen, sie hat heute ein Kind bekommen.“ Der frischgebackene Vater erfährt, dass er erst morgen, am Mittwoch, zur Besuchszeit von 15 bis 16 Uhr seine Frau umarmen darf. Er möge auch Damenbinden und Sicherheitsnadeln mitbringen. Kopfschüttelnd legt er den Hörer auf, er will gleich morgen Rat bei seiner Schwiegermutter zu diesen Frauensachen einholen. Dann erledigt er einen weiteren Anruf, diesmal einen mit höchster Geheimhaltung, er flüstert aus Gewohnheit, obwohl er doch allein zu Hause ist. Die Nummer hat er im Kopf und die Finger wählen die Zahlen automatisch. Eine Weile spricht er mit dem Unsichtbaren am anderen Ende der Leitung. Es muss ein „Er“ sein, denn es fällt die Anrede „Genosse“. Dann legt er auf, nimmt einen erneuten Zug, inhaliert den Rauch und drückt die Zigarette, die noch lange nicht aufgeraucht ist, im Aschenbecher aus. Das ist sonst gar nicht seine Art, Ware zu verschwenden, aber die Müdigkeit ist nach diesem Tag rechtschaffen und sehr groß. Der kleine Wecker wird auf 5 Uhr gestellt und wenig später zieht ein gleichmäßiges Schnarchen durch das Schlafzimmer.
Auch Fritz Butzke ist wieder zu Hause. Hanne, die Wirtin hat ihm per Blick versprochen, die letzten, unverzagten am Stuhl „festklebenden“ Gäste in Windeseile aus ihrer Kneipe hinauszukomplimentieren, damit die Heißblütige heute noch sein kaltes Bett wärmen kann. Die beiden haben ihre eigene Sprache und ohne Worte ihr Téte-á-Téte organisiert. Fritz ist gerade hektisch dabei, etwas Ordnung in seinen Junggesellenhaushalt zu bringen. Im Küchenschrank steht eine angebrochene Flasche ungarischen Dessertweins namens „Csardas“. Die stellt er nach getaner Aufräumaktion nebst zwei Gläsern auf den Rauchtisch, die bringt dann hoffentlich etwas Wärme in die kalte Einzimmerwohnung. Am Waschbecken hinter dem Wachstuchvorhang wäscht er sich mit kaltem Wasser und zieht mit einem nassen Kamm seinen Scheitel gerade. Einige graue Haare entdeckt er bei seinem Tun und fühlt sich mit einem Mal ob dieser Tatsache etwas unwohl. Aber auch nicht richtig, denn Hanne findet ihn attraktiv und dieses Weib ist jung und ein ziemlich heißer Feger. Also alles gut und er greift zu einer Zigarette, um die Wartezeit so zu überbrücken. Kurz darauf schrillt die Klingel. Hanne scheint alles in Windeseile erledigt zu haben, freut sich Fritz. Schwarze Stiefel treten resolut die Tür auf und zwei Männer stehen vor ihm, die ihn gar nicht zu Wort kommen lassen. In Windeseile bringt einer wieder Unordnung in sein Aufräumen. Er scheint etwas zu suchen, aber nichts zu finden, der andere in der schwarzen Jacke hat ihm fest im Griff. Der Überfallene steht ängstlich mit offenem Mund und kann sich keinen Reim auf all das machen. Er denkt, hoffentlich ist dieser schlechte Traum bald zu Ende. Aber nein, sie drehen seine Arme auf den Rücken und nehmen ihn wortlos mit. Draußen vor dem Haus steht ein dunkles Auto, er wird hineingestoßen und ab geht es. Keiner hat diesen kurzen Spuk mitbekommen. Als wenig später Hanne läutet, öffnet ihr niemand. Sie klingelt nochmals Sturm, aber nichts tut sich. Alles bleibt dunkel. Enttäuscht dreht sie sich um, nicht mal auf den verliebten Fritz ist Verlass. Hanne beschließt, ihm beim nächsten Kneipenbesuch weniger Alkohol auszuschenken, dann funktioniert es sicher besser mit einer Liebesnacht und sie stapft nach Hause durch den verharschen Schnee. Gut zwei Stunden Fahrt durch die Nacht braucht der schwarze Wartburg bis nach Rostock zum Staatssicherheitsgebäude in der Hermannstraße. Im Morgengrauen schließt sich eine Zellentür krachend hinter Fritz Butzke.
Ohne Haftbefehl oder Anklageschrift ist er gefangen in der kleinen Zelle, die anstelle eines Fensters Glasbausteine hat, damit kein Insasse ausmachen kann, wo er sich befindet. Doch er kommt gar nicht zu Nachdenken, wenig später wird er in das Kellergewölbe zum Verhör gebracht. Der Häftling kann keine der Fragen beantworten und das Verhör nimmt drastische Formen an. Die Stasi-Schergen prügeln auf ihn ein, treten und zerren, bis sie selbst kraftlos sind. Blutüberströmt überlassen sie ihn seinem Schicksal. Als sie nach zwei Stunden zu einer weiteren „Befragung“ zurückkommen und einen Eimer Wasser über ihm ausschütten, lebt er nicht mehr. Fritz Butzke ist an seinem Erbrochenen erstickt. Die sterblichen Überreste werden ein paar Tage später in einem Krematorium verbrannt, seine Asche anonym verscharrt. Übrigens, sein geparkter Barkas vor dem Haus in Ueckermünde „verschwand“ noch in der Nacht seiner Verhaftung. Die Stasi verwischte alle Lebensspuren des Ermordeten und ist sich sicher, dass niemand nach ihm fragt. So glauben seine Mörder…