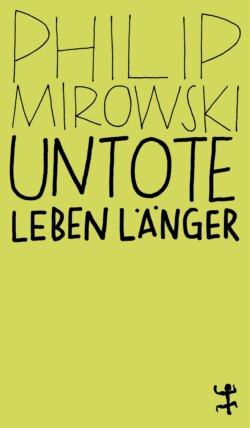Читать книгу Untote leben länger - Philip Mirowski - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kann man Zombies dazu überreden, in ihre Gräber zurückzukehren?
ОглавлениеMit John Quiggins bereits erwähntem Buch Zombie Economics verbindet die vorliegende Untersuchung eine ganze Reihe von Anliegen, und sie berührt auch mitunter dieselben Fachbegriffe. Beide vertreten die These, dass unsere Kultur von toten und verrotteten Vorstellungen über die Wirtschaftskrise beherrscht wird. Und obwohl es in einem nebligen Alptraum mitunter schwierig ist, die Zombies von bloßen Nebendarstellern zu unterscheiden, liegt Quiggin meines Erachtens auch damit richtig, dass die Ökonomen, nicht die Neoliberalen, die Zombies sind (ein weiterer zwingender Grund für die analytische Unterscheidung von Neoklassik und Neoliberalismus).
Allerdings werde ich Quiggins Buch auch als ein Beispiel für bestimmte Denkmuster behandeln, die die Linke in der gegenwärtigen Krise zu einem passiven, wirkungslosen Widerstand gegen den Neoliberalismus verurteilt haben. Um im Bild zu bleiben: Quiggin meint offenbar, ein Zombie lasse sich am besten durch Argumente zurück ins Grab drängen. Wäre es doch nur so einfach, alte Gräber wiederzuverwenden. Sein Verhältnis zur Wirtschaftswissenschaft hat er auf dem bekannten Blog Crooked Timber prägnant beschrieben:
»Auch wenn ich eindeutig links von den meisten Wirtschaftswissenschaftlern stehe (einschließlich vieler, die sich selbst als heterodox bezeichnen würden), bin ich gerne bereit, mich mit dem dominierenden Forschungsprogramm der Disziplin zu identifizieren. Der erste Grund dafür ist einer der persönlichen/politischen Strategie. Ausgehend von, grob gesagt, sozialdemokratischen Annahmen darüber, wie die Welt funktioniert, versuche ich Maßnahmen im Interesse der Gesellschaft im Allgemeinen und der Arbeiterklasse und den Benachteiligten im Besonderen zu bestimmten und fördern. Die etablierte Wirtschaftswissenschaft bietet eine Reihe von Werkzeugen für die Analyse (Theorie öffentlicher Güter, Externalität und Marktversagen, Steuerpolitik und Einkommensverteilung) und eine weithin verständliche Sprache für die Formulierung der Resultate. Keines der alternativen Gedankengebäude in der Wirtschaftswissenschaft kommt auch nur in die Nähe dessen.
Indem sie die logischen Grundlagen dieses einfachen Modells angreifen, mögen heterodoxe Ökonomen das Vertrauen in die daraus abgeleiteten politischen Maßnahmen untergraben. Aber das führt nicht besonders weit. Selbst wenn man die ökonomischen Argumente für Laissez-faire für wertlos hält, ergibt sich daraus noch keine positive Begründung einer anderen Politik.
Allgemein halte ich den gesamten Gedanken von Orthodoxie und Heterodoxie, oder die damit verbundene Vorstellung von Denkschulen, für wenig hilfreich. Er scheint mir eine Art intellektuellen Ahnenkult zu implizieren, mit dem niemandem gedient ist. Er führt weitgehend sinnlose Debatten darüber, was Keynes oder Commons oder Hayek wirklich gedacht haben. Waren ihre Gedanken wertvoll, dann werden sie in den meisten Fällen zumindest von manchen Vertretern der etablierten Lehre aufgegriffen worden sein, und die Rekonstruktion ihrer geistigen Abstammung ist bestenfalls von sekundärem Interesse.
Entsprechend meine ich, dass man die meisten üblichen Einwände gegen schlichte Varianten der Wirtschaftswissenschaft berücksichtigen kann, ohne gleich das ganze System zu verwerfen und bei null anzufangen. Wer an den vollkommen rationalen Homo oeconomicus nicht glaubt, der findet zahllose Arbeiten über Verhaltensökonomik, begrenzte Rationalität, Altruismus etc. Wem schlichte Wettbewerbsmodelle nicht zusagen, dem stehen ganze Regale voller Bücher über strategisches Verhalten und Spieltheorie zur Verfügung.«19
Wenn auch sicher unbeabsichtigt, kommt dies Margaret Thatchers »There is no alternative« gefährlich nahe. Die Behauptung, ernsthafte theoretische Arbeit jenseits der ausgetretenen, von den etablierten Disziplinen sanktionierten Pfade sei im politischen Handgemenge oft wirkungslos geblieben, ist ein beträchtliches Hindernis, wenn wir das Versagen der Linken in der gegenwärtigen Krise begreifen wollen. Quiggins Buch illustriert das beunruhigende Problem, wie schwierig ihm, ja jedem Kritiker innerhalb der Orthodoxie, der Nachweis fällt, dass er nicht bereits selbst mit dem Zombie-Virus infiziert ist (ein klassisches Problem in Zombie-Filmen). Auch wenn er immer wieder signalisiert, dass ihm bewusst ist, wie die neoklassische Lehre die Befreiung aus dem Sumpf des Zombie-Denkens vereitelt, kann er den Gedanken, dass man sich zur Überwindung logischer Inkohärenz von ihr verabschieden muss, nicht wirklich gelten lassen. Infolgedessen widerspricht er sich allenthalben und betrachtet dies notgedrungen auch noch als Vorzug. Das ist selbst ein unschönes Symptom von Zombie-Denken, das sich quer durch das Spektrum der »seriösen Linken« in der Wirtschaftswissenschaft findet, von Paul Krugman über Joseph Stiglitz, Adair Turner und Amartya Sen bis zu Simon Johnson. Krugman fühlt sich seines Status sicher genug, um diesen Defekt offen zuzugeben:
»Die Art von Wirtschaftswissenschaft, die ich in meiner täglichen Arbeit anwende – und die ich noch immer als den bei Weitem vernünftigsten Ansatz betrachte –, wurde maßgeblich von Paul Samuelson begründet, als er 1948 die erste Ausgabe seines klassischen Lehrbuchs veröffentlichte. Dieser Ansatz verbindet die große Tradition der Mikroökonomie, die betont, wie die unsichtbare Hand in der Regel wünschenswerte Ergebnisse zeitigt, mit keynesianischer Makroökonomie, die betont, dass die Wirtschaft Zündschwierigkeiten haben kann und politischer Eingriffe bedarf. Samuelsons Synthese zufolge muss man auf den Staat zählen, um weitgehende Vollbeschäftigung zu gewährleisten; erst sobald dies als gegeben betrachtet werden kann, treten die üblichen Vorzüge freier Märkte hervor.
Dieser Ansatz ist sehr vernünftig – aber auch theoretisch prekär. Denn er erfordert eine gewisse strategische Inkonsistenz im Verständnis der Wirtschaft. Auf der Mikroebene unterstellt man rationale Individuen und sich schnell ausgleichende Märkte; auf der Makroebene sind Reibungen und verhaltenstheoretische Ad-hoc-Annahmen wesentlich. Na und? Inkonsistenz auf der Suche nach praktischer Orientierung ist keine Schande.«20
Ich behaupte nicht, dass man niemals zugleich A und Nicht-A annehmen darf. Krugmans Position enthält ein Körnchen Wahrheit: Die Quantenmechanik zum Beispiel galt im Lauf ihrer Geschichte als unvereinbar mit der klassischen Mechanik und mit Makrotheorien wie der der Relativität. Eine Wissenschaft wie die Physik kann eine Weile mit begrifflicher Schizophrenie funktionieren, die mitunter sogar eine notwendige Voraussetzung dafür ist, ihre verborgenen Widersprüche vollständig zu begreifen. Die Geschichte der Neoklassik unterscheidet sich davon allerdings insofern, als andere Disziplinen gewöhnlich nicht einen Bannfluch über Wissenschaftler verhängen, die auf solche Inkonsistenzen hinweisen und nach ihrer Bedeutung fragen, oder zwecks Wahrung der Reinheit der Lehre kurzerhand die Verfechter des einen Pols ausschließen, wie mit den Theoretikern der rationalen Erwartungen und ihren Epigonen geschehen.
Während des Kalten Krieges nahm die Pluralität in der Wirtschaftswissenschaft ab, doch zur Wahrung des ideologischen Scheins wurde konkurrierenden Lehren nicht mit völliger Intoleranz begegnet. Es finden sich zum Beispiel im Nachlass Paul Samuelsons Belege dafür, dass er tatsächlich Joan Robinson für den Nobelpreis der Schwedischen Reichsbank vorschlug.21 Erst nach dem Fall der Berliner Mauer verschärfte sich, aus ebenso offenkundigen politischen Gründen, der Konformitätszwang erheblich, um in der Zeit der Immobilienblase schließlich seinen Höhepunkt zu erreichen. Nach der Jahrtausendwende kam eine höchst merkwürdige Literatur auf, der zufolge eine neoklassische Lehre insofern gar nicht mehr existierte, als die legitimen Vertreter der Orthodoxie jede nur denkbare analytische Abweichung vom strikten Walras-Gleichgewichtsmodell geprüft und irgendwer, irgendwo, irgendwann ein formales Modell zur Berücksichtigung der vormals heterodoxen Anliegen konstruiert habe.22 Rationalität? Wozu? Gleichgewicht? Brauchen wir gar nicht! Maximierung? Können wir umgehen! Persönliche Gier? Lesen Sie einfach Amartya Sen! Angebot und Nachfrage? Damit füttert man nur mathematisch ungebildete Leute, die die neueste Interpretation der Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theoreme nicht verstehen! Blasen? Haben wir, heiß, schaumig und rational. Komplexität? Wie viel darf’s sein? Nennen Sie etwas, das Ihnen nicht behagt, und wir bieten Ihnen ein nicht-ganz-so-neues Modell (und vielleicht eine theoretische Brücke) an. Allein, die ganze vorgebliche Aufgeschlossenheit, Toleranz und Berücksichtigung sämtlicher Bedenken ging weltweit damit einher, dass die letzten Überreste heterodoxer Wirtschaftswissenschaft an den Spitzenuniversitäten offen angegriffen und exkommuniziert wurden und die führenden Fachzeitschriften noch mehr Linientreue verlangten. Theoriegeschichte wurde verbannt, die verstreuten Ghettos heterodoxen Denkens wurden kurzerhand eingeebnet. Auch in Europa bezwang man die Abweichler energisch. Die Betroffenen erlebten diesen Widerspruch aus qualvoller Nähe.
Dass durchaus tolerante, geistig bewegliche Menschen die Heterodoxie genau während der Blase im Vorfeld von 2007 zu einem endlich abgeschlossenen Kapitel erklärten, scheint mir kein Zufall zu sein. Rückblickend kann man darin einen Abkömmling der neoliberalen Botschaft vom »Ende der Geschichte« erkennen, ähnlich der von Ben Bernanke vor der Krise verkündeten ›Großen Mäßigung‹ der Konjunkturschwankungen, nur im Bereich der Theorie. Ausrichtung und Lehrinhalte der Disziplin waren drastisch homogenisiert worden – nicht zuletzt, weil Graduiertenkollegs nun auch Anfänger ohne abgeschlossenes Grundstudium der Wirtschaftswissenschaft aufnahmen –, was bei Anbruch der Krise bedeutsame Folgen zeitigte, als sich die Ökonomen in stümperhaften Reaktionen ergingen. Die Lehrinhalte und die Vorbildung der jüngeren Generation hatten sich derart verengt, dass sie Positionen außerhalb der eigenen Traditionslinie schon gar nicht mehr kannte und sich ihr Gefühl geistiger Freiheit somit schlichter Ignoranz verdankte. Die Lage wurde so bedenklich, dass heterodoxe Verweigerer sich mitunter als Opfer einer arglistigen Täuschung sahen: »Nichts ist für Kritiker der neoklassischen Lehre niederschmetternder als die Behauptung, die neoklassische Lehre existiere nur in ihrer Fantasie.«23 Keine Säuberung ist heimtückischer als die, die im Schutz der glaubhaften Versicherung durchgeführt wird, sie finde gar nicht statt.
Wie es Big Brother gelang, sich den Ruf politischer Neutralität und Offenheit zu erwerben, lässt sich unterschiedlich deuten; das vorliegende Buch beleuchtet das Phänomen aus mehreren Perspektiven. Schwieriger zu verstehen ist, wie diese Einschätzung selbst im Gefolge der Krise (wenngleich unter ständiger Nötigung), als die Wirtschaftswissenschaft Prügel bezog, gewahrt werden konnte; auch darum wird es im Folgenden gehen. In jedem Fall führte die im neuen Jahrtausend als »Ende der neoklassischen Wirtschaftslehre« vorgetäuschte Toleranz dazu, dass die Reaktionen der Ökonomen auf die Krise noch konfuser ausfielen, als sie es wohl ohnehin gewesen wären.
Allerdings gibt es für diese Geschichte eine bündige Erklärung. Kein Doktorand der Wirtschaftswissenschaft würde sie ernsthaft in Betracht ziehen, doch wir wollen ihr in diesem Buch nachgehen. Sie lautet, dass Quiggin nur zur Hälfte richtig lag: Nicht nur bestimmte wirtschaftswissenschaftliche Modelle sind zombifiziert, vielmehr ähnelt die gesamte neoklassische Tradition den Untoten und torkelt dergestalt schon eine Weile umher. Das würde offensichtlich erklären, warum noch so viel scharfsinnige heterodoxe Kritik ihren unerbittlichen Vormarsch nicht aufzuhalten vermag. Bevor der Leser diese Behauptung kurzerhand als zu hart verwirft, möge er das Folgende bedenken.
Nehmen wir das Selbstbild der Wirtschaftswissenschaftler, die eine Auflösung des neoklassischen Programms behaupten, vorläufig für bare Münze. Demnach scheinen wir erstens in eine historische Ära eingetreten zu sein, in der die akademische Neoklassik nicht länger »die Wirtschaft« zu erklären versucht, denn etwas Derartiges existiert für anspruchsvolle Ökonomen gar nicht. Kritiker, die über »die Wirtschaft der realen Welt« daherreden, ernten für solche Naivität nur die stumme Verachtung der Hüter des Expertentums. Ausgewiesene neoklassische Wirtschaftswissenschaftler wähnen sich am vermeintlichen Ende der Geschichte vielmehr im Besitz einer veritablen Universaltheorie, die sie folgerichtig auf schlechthin alles anwenden, was sich unter der Sonne findet: auf Leben und Tod, Sex, Neuronen, Nationen, Sprache, Wissen, die Wissenschaft selbst, persönliche Identität, Evolution, Ästhetik, globale Umweltkrisen und selbst auf menschliche Tugenden wie die Würde.24 Durch einen Taschenspielertrick wurde eine Theorie des Handels zur »Theorie der rationalen Entscheidung« – und Entscheidungen werden überall getroffen. Genau so lautet die zentrale Botschaft von Freakonomics, dem Bestseller zur »Großen Mäßigung«: Krass-rebellische (aber durchaus orthodoxe) Ökonomen haben eine Erklärung für jedes Phänomen, egal ob es um Sumo-Ringer, männliche Teenager, Vornamen von Mädchen oder Kriminalitätsstatistiken geht.25 Eine solche Hybris bringt allerdings ihre ganz eigene Tragik mit sich: Dass eine angeblich alles erklärende Lehre in Wirklichkeit gar nichts erklärt, ist eine philosophische Binsenweisheit. Neoklassische Wirtschaftswissenschaftler können potenziell alles als ordnungsgemäßes Produkt eines körperlosen »Eigeninteresses« darstellen, solange nur »Interesse« stets nachträglich definiert, Ordnung mit dem Status quo gleichgesetzt und die Ontologie des interessierten Subjekts in jedem einzelnen Fall anders gefasst wird. Wie bei allen guten Zombies klafft ein Hohlraum, wo sich ihr Gehirn befinden sollte. Die neoklassische Lehre ähnelt einem Katechismus für die Untoten, die kaum bis zehn zählen können.
Die unerträgliche Leichtigkeit der Ökonomie in der Neoklassik ist nur die Spitze des Eisbergs. Sehen wir uns zweitens näher an, wie der »wirtschaftswissenschaftliche Imperialismus« der zeitgenössischen Orthodoxie praktisch funktioniert. Beim munteren Vormarsch in die Interessengebiete anderer Disziplinen hat sie sich ihrerseits großzügig bei deren Formeln und Methoden bedient: Man denke an das Aufkommen der »experimentellen Ökonomik« oder den Einsatz von Magnetresonanztomographie zur Prognose wirtschaftlicher Entscheidungen. Wenn es in der Begriffsbildung der neoklassischen Theorie seit den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts eine Konstante gegeben hat, dann waren es in der Tat ihre sklavischen Bemühungen, durch die Imitation halbverdauter physikalischer Modelle ihren Neid auf die Physik zu bewältigen. Eine Sozialwissenschaft, die in ihrem Eifer, die Werkzeuge und Methoden anderer Disziplinen nachzuahmen, so ungezügelt ist, verfügt für Argumentationen auf dem eigenen Gebiet über kein solides Gültigkeitskriterium mehr, und seit den Achtzigerjahren hat sich dieses Problem noch verschärft. Die scheinbar so mächtige, weil allgegenwärtige Wirtschaftswissenschaft steht schwankend an der Schwelle zum Zerfall in ein ungeordnetes Gemenge der jeweiligen Moden anderer Disziplinen, die immerhin den Vorzug einer theoretischen Agenda haben, aus der neue Praktiken und Methoden hervorgehen.
Drittens sollte sich die Integrität einer lebendigen Disziplin in einem Konsens über Grundlagentexte zeigen, um überhaupt definieren zu können, wer als ihr Vertreter gelten kann. Lehrbücher für das Grundstudium zählen dabei meines Erachtens nicht, da sie lediglich das blasse Gesicht der Disziplin für die Außenwelt sind. Betrachten wir die heutige Orthodoxie, dann fragt sich: Wo ist der John Stuart Mill, der Alfred Marshall, Paul Samuelson, Tjalling Koopmans oder David Kreps des frühen 21. Jahrhunderts? Die Antwort für die Makroökonomie lautet, dass es keinen gibt. In der Mikroökonomie heißt der vermeintliche Goldstandard Microeconomic Theory (1995) von Andreu Mas-Colell, Michael Whinston und Jerry Green, ein ausuferndes und inzwischen auch recht veraltetes Kompendium ohne klare Struktur. Die Ökonometrie wird zwar gezwungenermaßen oft zum Kernbestand der Lehre gerechnet, aber über ihre zentrale Bedeutung für den heutigen wirtschaftswissenschaftlichen Empirismus ist man sich längst nicht mehr einig. Jenseits der Universitätslehrbücher wird die Disziplin nicht von klaren intellektuellen Standards zusammengehalten, sondern von kaum mehr als ein paar Zeitschriften, die aufgrund eines zirkulären Bewertungssystems als unverzichtbar gelten, und der Dominanz einer Handvoll renommierter Fakultäten. Hochschulabsolventen werden sozialisiert und indoktriniert, indem man sie zur Lektüre dieser Zeitschriften nötigt, deren Aufsätze eine Halbwertzeit von fünf Jahren haben: Ohne Ziel und Vision verschiebt sich der Schwerpunkt der Disziplin allenthalben; während sie sich gegen äußere Herausforderer streng abschottet, weist die Orthodoxie im Inneren eine große Leere auf.
Viertens schließlich: Sollte in bestimmten Modellen doch einmal ein Paradigma der neoklassischen Lehre aufscheinen, steht man vor dem Problem, dass ihre einwandfreien formallogischen Beweise der scheinbaren Beliebigkeit der Lehrbücher zuwiderlaufen. Die neoklassische Theorie untergräbt sich selbst. Wer das kanonische Arrow-Debreu-Gleichgewichtsmodell anführt, kommt im Zusammenspiel mit den Sonnenschein-Mantel-Debreu-Theoremen zu der Aussage, dass für Funktionen wie etwa die Überschussnachfrage, die man für »elementare Wirtschaftswissenschaft« halten sollte, fast keinerlei Begrenzungen bestehen. Oder aber man stößt in der Spieltheorie auf das Nash-Gleichgewicht und nimmt das sogenannte Folk-Theorem hinzu, das besagt, dass unter gewöhnlichen Bedingungen beinahe alles als Nash-Gleichgewicht gelten kann. Um bei den wundervollen Paradoxien des »strategischen Verhaltens« zu bleiben: Laut dem »No-Trade«-Theorem von Milgrom/Stokey würde in einer neoklassischen Welt niemand irgendeine Transaktion tätigen, wenn alle Marktteilnehmer so misstrauisch wären wie in der Theorie von Nash unterstellt. Das Modigliani-Miller-Theorem besagt, dass der am Eigenkapital gemessene Verschuldungsgrad einer Bank auf dem Markt vollkommen unerheblich ist, obwohl es in der Finanztheorie ständig um Verschuldung geht. Arrows Unmöglichkeitstheorem drückt aus, dass demokratische Politik in einem nach dem neoklassischen Modell gebildeten Gemeinwesen im Grunde zu ohnmächtig wäre, um bestimmte Ziele zu erreichen. Märkte gelten heute als großartige Informationsprozessoren, doch Grossman und Stiglitz sind zu dem Ergebnis gelangt, dass niemand einen Investitionsanreiz für die Entwicklung und Verfeinerung von Informationen hat. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Es ist das Los delphischer Orakel, obskure Botschaften zu verbreiten.
Um auf den Ausgangspunkt dieses Abschnitts zurückzukommen: Wenn wir den Alptraum der gegenwärtigen Krise begreifen wollen, müssen wir Neoklassik und Neoliberalismus unbedingt analytisch unterscheiden.26 Die neoklassische Theorie ist wesentlich älter als das Neoliberale Denkkollektiv und weist erst neuerdings Anzeichen einer Infektion auf. Wie wir zeigen werden, hatten ihre Vertreter in der jüngsten Krise die Aufgabe, praktisch jeden seriösen Erklärungsversuch dafür, dass die Krise für die zuständigen Experten ein rätselhafter Schock gewesen ist, zu Fall zu bringen. Mit ihren unausgegorenen Analysen des schleichenden Grauens sind sie zu einem Alptraum geworden. Doch es waren die Neoliberalen, die den Zombie-Horden als Stoßtruppen gedient haben, als Spähtrupps, deren Schock-Strategien und -Therapien die wandelnden Toten nach sich ziehen.
Einmal wachgerufen, begannen die neoklassischen Ökonomen durchs Land zu taumeln und mit ihren schlechten Frisuren, ihrem toten, starren Blick und resolutem Geschrei die Bevölkerung zu verängstigen – und wurden ihrerseits zu den entscheidenden Wegbereitern des wiedererstarkenden Neoliberalismus. Wie Quiggin einräumte: »Ich habe unterschätzt, mit welcher Geschwindigkeit und Macht sich Zombie-Gedanken ausbreiten.«27 Wir müssen die Gründe dafür herausfinden.