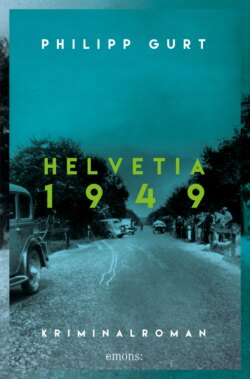Читать книгу Helvetia 1949 - Philipp Gurt - Страница 10
4
Оглавление«Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.»
Ein gemeinsames tiefes Amen der Geistlichen ertönte gegen neunzehn Uhr an diesem Samstag. Die allabendliche Andacht in der St. Luziuskirche war vorüber. Das Gotteshaus gehörte zu den Gebäuden des Priesterseminars, welches angrenzend über dem bischöflichen Hof in die Bergflanke eingebettet ob Chur thronte.
Diakon Anselmo Veranzze schritt in seiner schwarzen Soutane aus dem Gottesdienst, die Hände dabei gefaltet und im Geiste im Gebet zu seinem HERRN vertieft.
Seit er vor drei Jahren, erst mit siebenunddreissig, endlich die erste der drei Stufen des Weihesakraments erhalten hatte, war ihm von Priester Niklaus Casotti offiziell die Seelsorge und Missionierung des Tälis zuteilgeworden. Seine Herkunft hatte zwar möglicherweise eine Rolle gespielt, glaubte er zu ahnen, doch ausschlaggebend mussten sein geistliches Feuer, seine Treue gegenüber dem himmlischen Vater gewesen sein, dessen war er sich hingegen sicher.
Die italienischen Emigranten, die ausnahmslos erzkatholisch waren, stellten eine feste Glaubensgemeinschaft im Täli dar im Gegensatz zum liederlichen Treiben im Loch hinten, wie Veranzze schon vor seiner Amtsübernahme feststellen musste. Vor allem in der Roten Laterne ging die Hurerei nicht nur ein und aus, wie das graufarbene Arosabähnli durch die Schlucht es tat, sie hauste dort. Dazu kamen die Jenischen, das listige Zigeunerpack, das sich angesiedelt hatte und ihn verlachte, sobald er nur in deren Nähe kam, um das Wort Gottes zu verkünden. Die wenigen verarmten Künstler, vorwiegend Maler oder Bildhauer, dazu ein Schriftsteller, wohnten inmitten dieser Vaganten: Scherenschleifer, Kesselflicker, Korbmacher und der alte Bürstenbinder, der Buschauer, und nicht zu vergessen die Grubers – allesamt mehr oder weniger Taugenichtse, fand Veranzze. Aber genau die hätten das Wort des himmlischen Vaters am nötigsten gehabt. Nur deshalb nahm er jedes Mal den Weg gerne auf sich und versuchte dem Spott mit Liebe und mahnenden Worten zu begegnen.
Nur beim Taleingang, im Bodmer, dort, wo die meisten Häuser, und zwar beidseitig der Plessur, standen, wurde sein Kommen und nicht sein Gehen von den fleissigen Italienern begrüsst. Sie vertrauten ihm, und wenn er in der Abdankungskapelle des Totenguts einen seiner zweiwöchentlich stattfindenden Täligottesdienste für sie auf Italienisch hielt, dann wusste er ebenso, warum er vom himmlischen Vater als Achtzehnjähriger berufen worden war. Auch wenn das Abendmahl, die Feier der Eucharistie, das Busssakrament oder die letzte Ölung noch den Priestern vorbehalten blieben, umso mehr brannte sein Herz für seine heilige Aufgabe. Irgendwann würde er Priester oder sogar ein Märtyrer werden, so Gott es noch immer wollte – so wie dieser es ihm als Jugendlichem in einer Vision in der Ruine von San Gaudenzio, zuhinterst im Bergell, verheissen hatte.
Doch wie jedem von Gott berufenen Mann steckte auch ihm ein Dorn tief im Fleisch, damit der HERR ihn formen und führen konnte, damit nicht der Hochmut Überhand gewann.
Veranzze war sich sicher, das musste auch seine Exzellenz Bischof Kamber zu Chur persönlich erkannt haben, als dieser vor drei Jahren, während einer persönlichen Unterredung mit Priester Casotti, vom heiligen Missionsauftrag der Kirche im Täli gesprochen hatte, um damit dem Sündentempel zuhinterst im Talschlitz ein Ende zu bereiten. Der Bischof hatte zwar nicht diese Worte gebraucht, aber es mit Sicherheit so gemeint.
Er, Anselmo Veranzze, konnte nicht mehr zählen, wie viele Male er seither bei Wind und Wetter und jeder Tages- und Nachtzeit in seiner schwarzen Soutane steckend zu Fuss ins Täli geschritten war, ausgesandt und gestärkt mit dem Wort Gottes und voll Zuversicht, mit den Sündern das Gespräch zu finden. Inbrünstig hatte er dabei gebetet, dass das Sodom und Gomorra mitsamt den Felsen einzustürzen vermöge, dass der Finger Gottes im heiligen Zorn der Liebe herniederfahren täte wie der Pflug durch die Erde und damit die Rote Laterne, das Sinnbild des Höllenfeuers, auslöschte, um den Boden für neue Saat fruchtbar zu machen.
In diesen Jahren hatte Veranzze am meisten von jenen einstecken müssen, bei denen der göttliche Samen am wenigsten oder gar keine Früchte hervorbrachte, als wäre er auf steinharte Herzen gesät worden.
Doch gottlob, und dafür dankte er dem HERRN auf Knien in jeder Tagesfrühe in der St. Luziuskirche auf den so steinharten Holzbänken, als kniete er auf den Sünderherzen, hatte er, Veranzze, einen so kräftigen Körper geschenkt bekommen. Deshalb wurden ihm nur selten Prügel angedroht.
Diese Hermine Montalta, die Wirtin der Roten Laterne, mit ihren drei Höllenhunden, die sie schon zweimal auf ihn gehetzt hatte, als er sich beide Male gerade noch auf einen Baum flüchten konnte, war bestimmt dem Teufel ab dem Karren gefallen. Kein Wunder, verabscheute sie ihn wie das Weihwasser, wenn er mit einer ihrer immer wieder wechselnden Serviertöchter vor dem Gasthaus hatte reden wollen, um sie vor noch Schlimmerem zu bewahren. Und da waren noch die Gruberbrüder, die sich einen schlechten Spass mit ihm erlaubt hatten und ihn in ein leeres rostiges Ölfass steckten, darin mit Pech übergossen, danach federten, nur weil er mehrmals versucht hatte, das Käthy auf den rechten Weg zu bringen. Irgendwann aber würde er dafür belohnt und sie ihrer gerechten Strafe zugeführt werden, das musste Lohn genug sein. Denn was war dies im Vergleich zur Pein des Herrn Jesus Christus am Kreuz, sagte er sich stets und fühlte sich dem himmlischen Vater dadurch noch näher, denn wenn einer ihn verstand, so war es gewiss der HERR.
Diese Gedanken kreisten einmal mehr in Veranzzes Geist, als er an diesem frühen Abend von seiner Kammer unter dem heissen Dach des Priesterseminars auf Chur blickte, das zu seinen Füssen vor ihm kniete. Langsam folgten seine Augen dem aus Häusern geformten Finger, der sich von der Stadt ins Täli streckte, als wäre es ein Gotteszeichen, dorthin zeigend, wo schon lange dunkle Abendschatten lagen, obwohl die mittelalterliche bischöfliche Hofanlage noch gut eine Stunde im abendlichen Sonnenschein gebadet bliebe.
Mit dem Blick in die Schlucht kam eine unglaubliche Dankbarkeit und Nähe zum himmlischen Vater auf, denn selten durfte ein Geistlicher, so wie er einer war, Zeugnis von dessen Handeln so unmittelbar erleben, war er sich gewiss. Der HERR hatte nämlich gesprochen und als Zeichen am siebten Tag nach der Ankunft dieser Zürcher Hure den Tod über die Rote Laterne gebracht.
Veranzze schloss sanft seine Bibel, aus deren Altem Testament, dem Buch Exodus, er soeben gelesen hatte: Kapitel zweiundzwanzig, Vers siebzehn. «Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen!»
Genau vor einer Woche war es gewesen, als er hinten im Täli auf seinem Fahrrad hockte, als ein grosses, teures schneeweisses Automobil neben ihm hielt, nachdem es mehrmals heiser gehupt hatte, damit er bremse.
Aus dem Wagen, der ein Zürcher Nummernschild trug, stieg diese zu Fleisch gewordene Sünde aus: blonde Haare, rote Lippen, dazu dieses frohlockend frohe Lachen, das jedermann arglos und deshalb wehrlos werden liess.
Inbrünstig hoffte er, dass sie sich verfahren hatten, bestimmt auf dem Weg nach St. Moritz.
«Grüezi wohl, Herr Pfarrer.» Sie hatte ihm die weiss behandschuhte Rechte gereicht und deutete krampfhaft lächelnd einen Knicks an. «Äxgüsi, aber wir haben uns glaub verfahren.» Sie richtete ihren kleinen schicken Hut, doch sie konnte den Schrecken in ihrem Gesicht nicht verbergen, als sie seines sah.
Er hatte sich an diese Art von kurzem Erstarren, ja gar Entsetzen gewöhnt, denn seine rechte Gesichtshälfte war durch Brandnarben vollkommen entstellt, die Augenbraue und das Kopfhaar fehlten auf dieser Seite völlig, das betroffene Auge war weisstrüb und blind. Ebenso hälftig verbrannt waren seine Lippen und der rechte Teil des Halses, seine Gesichtsmimik liess rechtsseitig nur ein verzerrtes, monsterhaftes Grinsen zu.
Ganz im Gegenteil dazu seine andere Gesichtshälfte – diese zeugte von der Schönheit eines aussergewöhnlich attraktiven Mannes: formschön vollendete Lippen, ausdrucksstarkes Auge, eine ausgeprägte männliche Kinnpartie, die Haut makellos, die Nasenhälfte gradlinig edel geschnitten, das volle schwarze Haar glänzte.
Und genau dies löste beim Gegenüber grosse Irritation bei der ersten und auch weiteren Begegnungen aus, wusste er aus Erfahrung.
Seine linke Gesichtshälfte lächelte an diesem Tag der jungen Dame anstandshalber zurück, die rechte verzog es gleichzeitig zu einer monströsen Fratze, sodass sie ihre Verwirrung nicht zu verbergen vermochte.
Kinder, fand er, die machten es richtig. Ihre Augen waren so ehrlich, wenn sie ihn mit offenen Mündern anstarrten oder ihm Fragen stellten. Einige der grösseren wollten sein Gesicht sogar berühren – die zerstörte Seite, tasteten über die ledrige rote Haut, die dicken und dünnen Vernarbungen. Und danach war es damit für die meisten von ihnen erledigt. Es gab nur zwei, die ihm trotzdem böse Worte nachgerufen hatten und hänselnd lachend davongerannt waren. Ihnen war er eines Tages nachgerannt, bis er beide erwischt hatte. Mit aufgerissenen Augen standen die zwölfjährigen Buben dann vor ihm, als er ihnen je ein in Papier eingewickeltes Stück Kuchen schenkte. Damit waren auch sie Freunde geworden, und sie riefen ihm bald schon von Weitem freundlich zu und winkten, und hin und wieder hatte er wieder was Leckeres für sie dabei. In ihren Augen sah er den himmlischen Lohn, denn in den Kindern, so fand er, war neben der Natur die göttliche Schöpfung am fühlbarsten zu erkennen. Was hatte der HERR so unmissverständlich in seiner Heiligen Schrift gesagt? «Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.»
Nun blickte Veranzze in das makellose Gesicht dieses blonden Fräuleins. Auf der einen Seite schmeichelte es ihm, dass sie glaubte, einen Pfarrer vor sich zu haben, auf der anderen Seite sah sie genau so aus, als würde sie nur sehr selten, wenn überhaupt, ein Gotteshaus betreten, und glaubte daher bestimmt, dass jeder, der eine Soutane trägt, somit ein Priester sei.
«Der HERR segne Sie. Wenn Sie mir sagen, wohin Sie fahren möchten, dann kann ich Ihnen womöglich einen Rat geben», antwortete er ihr höflich.
«Wo ist denn dieser Meiersboden? Ich stelle fest, hier hinten wird’s immer enger, da passt ja nur noch knapp ein Automobil aufs Mal auf die Strasse.» Die blonde Frau blickte sich noch immer irritiert um, während der Fahrer sein Seitenfenster etwas herunterschob, um zuzuhören.
«Meiersboden? Ja, da sind Sie richtig. Sie müssen weiter dieser Strasse ganz ins Tobel folgen, dann rechts übers Brückli und auf der anderen Schluchtseite einige hundert Meter die Strasse den Berg hoch. Was wollen Sie überhaupt dort hinten?» Er ahnte es bereits.
«Ach, Herr Pfarrer, ich bin eine Tänzerin und werde bis nach dem Schützenfest dort auftreten – in der Roten Laterne. Und keine Sorge, nichts grusig Unanständiges.» Sie lächelte entschuldigend, während ihre Augen hin und her seine Gesichtshälften anschauten, als wollten sie beide zu einem Ganzen zusammenfügen.
Veranzze schwieg darauf, bis sie unsicher im Zürcher Dialekt fragte: «Äxgüsi, Herr Pfarrer, habe ich was Falsches gesagt?» Ihr Lächeln, das Veranzze widerwillig mochte, umspielte zaghaft ihr helles Gesicht.
«Nicht nur an dem, was wir sagen, vor allem an dem, was wir tun, misst uns der HERR, mein wertes Fräulein.»
Lächelnd sah die Schönheit erst Veranzze an, dann zum Wagen, aus dem missmutig der junge Fahrer stierte, der seinen Hut lässig schräg nach hinten geschoben hatte.
«Lola, lass den komischen Pfaff nur schwafle. Bravi Meitli chömed i Himmel, aber solche wie du überallhin. Komm, steig endlich ein, ich muss noch die drei Stunden zurück nach Zürich fahren, und das heute noch», tönte es unwirsch vom jungen Mann, der seinen Zigarettenstummel respektlos vor die Füsse Veranzzes spickte, der dies mit einem kurzen Augenkontakt quittierte.
Lola schien das Verhalten ihres Begleiters peinlich zu sein. «Also denn, Herr Pfarrer. Nüd für unguet, gälled Sie, und danke schön für d’Uskunft. Uf Wiederluege, Herr Pfarrer.» Sie stieg ein und verschwand nach einem letzten Blick auf Veranzzes Gesicht im Innern des Wagens und dieser weiter hinten in der Schlucht. Nur die Abgaswolke schwebte noch einen Moment in der warmen Luft.
Veranzze schnürte es das Herz zusammen; die viele Arbeit der letzten drei Jahre und nun das. Das war also diese Tänzerin, deren Ankunft er schon lange befürchtet hatte. Als schwarzer Schwan würde sie einem Magneten gleich noch mehr Sünde in die Rote Laterne ziehen, das Täli weiter damit vergiften.
Bilder begannen in seinem Kopf zu entstehen: Er sah sie auf der Bühne stehen, wie sie mit tanzenden Bewegungen und diesem schüchternen, angehauchten Lächeln sich auszog, sodass er so fest seine Augen zusammenkniff, dass es ihn schmerzte. Doch die Bilder liefen weiter. Er sah sich aufstehen, mitten aus der gierigen Zuschauermasse von ihr angezogen, als ihre roten, feuchten Lippen «Anselmo» flüsterten. Er hielt sich deshalb seine Ohren zu, schüttelte seinen Kopf, dann machte er kehrt, als hätte sich vor ihm eine Staumauer durchs Täli gezogen.
Er eilte hin zum grossen Felsen am Eingang der Schlucht. Unter der Adlernase, wie dieser hiess, drückte er sich mit dem Rücken an die Felswand und stiess ein inbrünstiges Gebet gen Himmel, das in ein innerliches Flehen nach Gerechtigkeit überging, sodass der Allmächtige ihn gebrauchen solle, auch wenn ihn sogar der Märtyrertod erwarten täte.
Beobachter, die ihn in diesem Moment nur von rechts anschauten, hätten schaudernd eine Art Monster in schwarzer Soutane dort stehen gesehen, diejenigen von links einen zu schönen Mann, um ein Gottesmann zu sein.
Er aber hatte der Hexe Gesicht, deren rote Lippen gesehen und gewusst, ja gefühlt, welche vermaledeite Kraft nun sich gegen seinen Missionsauftrag stemmen würde, ein satanisches Bollwerk des Bösen war im Täli angekommen – er musste sich rüsten.
Das war vor einer Woche gewesen. Und letzte Nacht hatte der HERR in seiner unglaublichen Gerechtigkeit, seiner barmherzigen Güte, aber auch in seinem heiligen Zorn ein Zeichen gesetzt. Bischof Kamber würde deshalb die Fortschritte im Täli bald mit einem würdevollen Nicken und Worten kommentieren wie: «Diakon Anselmo Veranzze, Sie sind wahrlich ein Gottesmann vor dem HERRN – ein Segen für unser Bistum. Ihr Platz im Himmelreich sei Ihnen gewiss.»
Veranzze kehrte aus seinen Gedanken zurück in das klerikale Gemäuer, in seine Kammer, in der eine tiefe Stille und Zeitlosigkeit lag. Er legte die Bibel achtsam auf den kleinen Holztisch am Fenster und verliess nach einem letzten Blick aufs Täli seine kargen vier Wände.
Die schwere Eingangspforte des Priesterseminars schloss sich hinter ihm, als er in die Hitze des Abends hinaustrat. Blüten- und Kräuterduft schwebte im bischöflichen Garten, als er die lange Treppe zum «Marsöl» hinunterlief. Er trug wie immer ausserhalb der Gottesdienste seine schwarze Soutane, ausser er arbeitete handwerklich in einem der bischöflichen Betriebe mit, dann trug er blaue Hosen und Hemd wie alle Arbeiter.
Seine Eingebung sagte ihm, dass es jetzt Zeit war, in aufrichtiger Dankbarkeit die zwei Kilometer durch die Schlucht hoch zum Meiersboden zu gehen, dabei in Stille dem HERRN für sein Eingreifen von letzter Nacht zu danken.
Wie ein dunkler Geist wirkte dabei der Vierzigjährige. Seine Halshaltung wirkte seltsam, weil die verbrannte Haut diesen auf eine Seite hin hatte steif werden lassen. Sein Hut mit der tellerartigen Krempe war ebenso schwarz wie seine Kleidung. Nur der weisse Römerkragen seines Collarhemdes hob sich hell ab.
Er schritt gleichmässig, einem Metronom ähnlich, neben der rauschenden Plessur Richtung Loch, als wäre es ein einsamer, fahnenloser Siegesmarsch einer verlustreich geschlagenen Armee. Der wilde lila Flieder blühte reich, verströmte üppig seinen honigsüssen Duft. Beäugt wurde Veranzze dabei nur von einem Grüppchen Tälibewohner, die die Köpfe zusammensteckten, wie sie es oft taten, als nähmen sie ihn nicht wahr. Sie sprachen mit Bestimmtheit über die Tote, wie er zu wissen glaubte.
Anfang Täli, bei der Brücke zum Bodmer, kam ihm Renato Spinelli entgegen. Spinelli, der es als einziger Emigrant in den Fussballclub Domat/Ems geschafft hatte, der immerhin in der zweithöchsten Liga der Schweiz mitmischte, winkte ihm von Weitem fröhlich zu.
«Buon giorno, Signore Veranzze.» Dabei hatte er den Lederball unter seinem rechten Arm eingeklemmt und lachte übers ganze Gesicht wie ein Junge, der sich auf ein Fussballspiel freut.
Spinelli schien einer der wenigen zu sein, die vom Tod Möcklis noch nichts gehört hatten, denn er sprach Veranzze nicht darauf an, oder es war ihm zu unangenehm, folgerte Veranzze daraus. Spinelli war unterwegs zur kantonalen Turnhalle, die neben dem Krankenasyl Sand stand, um auf dem kleinen Fleckchen Wiese zu tschutten und auf der Aschenbahn, trotz Hitze, einige Runden zu laufen, wie er sagte.
Als Veranzze den Tod Möcklis ansprach, gab sich Spinelli erschrocken. «Mamma mia! Ist diese wahr? So eine kleines Fräulein tot? Ise kaum zu glaube», gab er im holprigen Deutsch zur Antwort, als hätte er vergessen, dass er sonst mit Veranzze immer in der gemeinsamen Muttersprache redete.
Das Gespräch endete damit, dass Spinelli dem Diakon versprach, am nächsten Tag in den sonntäglichen Gottesdienst zu kommen.
Als Veranzze wenig später beim Totengutbrückli vorbeikam, zog es ihn über dieses auf die andere Schluchtseite, hin zur Abdankungskapelle, in der er morgen den Gottesdienst für die Italiener abhalten durfte.
Bei jedem Betreten sah er hoch auf die goldene Schrift über dem Eingangsportal: «DEM LICHT ENTGEGEN».
Irgendwann würde es auch für ihn endlich so weit sein, und er dürfte im himmlischen Licht entschweben und alles hier zurücklassen, ausser der Liebe. Doch bis dahin musste er sich seinen Platz im Himmel erarbeiten. Sein morgiges Predigtthema würde indirekt auch davon handeln, über Schuld, Sühne und Strafe – und das Himmelreich.
Die Totengutkapelle war zwar keine richtige Kirche, in der er eigentlich auch nicht predigen durfte, es wurde stillschweigend vom bischöflichen Hof toleriert. Aber auch darin sah er ein Zeichen Gottes, denn in einem Gotteshaus, das viele Jahrhunderte schon keine Kirche mehr war, wurde er zur Mission erweckt …
… es war im Jahre 1927 gewesen, an seinem achtzehnten Geburtstag. Der Sonntagnachmittag im Mai, zuhinterst im südbündischen Bergell, im kleinen Bergdorf Casaccia, war so gähnend träge gewesen, dass die Langweile Anselmo wehtat, ja seltsam bedrohlich auf ihn wirkte. Die Zeit schien einmal mehr stillzustehen. Das Leben, das zweifellos irgendwo hinter den vielen Berggipfeln blühte, wie der Frühling hier im Tal, war so weit weg wie der Mond. Sein älterer Bruder war vor zwei Jahren nach Italien gegangen, nach Chiavenna, um Priester zu werden, und kam kaum noch nach Hause.
Seine Eltern Gelsomina und Lorenzo Veranzze waren schon immer strenggläubige Katholiken gewesen, wie nur noch drei der Familien in dem sonst protestantischen kleinen Dorf, das traditionell ausnahmslos aus Steinhäusern erbaut war und dessen Dächer mit Steinplatten gedeckt wurden, die zu den steinernen Bergkämmen passten.
Die Bergflanken über der Waldgrenze und die Gipfel rund um das Tal, das bei Casaccia auf tausendfünfhundert Meter Höhe lag und sich von dort gemächlich bis hinab zum norditalienischen Villa di Chiavenna zog, steckten noch unter einer dicken Schneedecke. Hingegen die stotzigen Wiesen an den Südhängen im Tal lagen in der Wärme der Frühlingssonne, die Bäche sprudelten munter über vor lauter Schmelzwasser. Das Licht und die Wärme kehrten zurück ins abgelegene Tal.
Als Anselmo die Ziegen versorgt, die Lateinaufgaben gewissenhaft erledigt und sein Vater sich zum Bibelstudium ins kleine Arbeitszimmer zurückgezogen hatte, während die Mutter auf der Holzbank vor dem Haus sass, um in den warmen Strahlen Hosen zu flicken, zog es ihn hinaus.
Der Frühling streckte seine Fühler aus, sodass auf den Südhängen, unterhalb des Mischwaldes, in dem Robinien, Birken und Lärchen wuchsen, die weissen und blauen Krokusse das Grün verschwenderisch übersäten. Im Dorf sprossen Kamelien, Forsythien und Primeln und verbreiteten ihren Duft. Die kleinen Eidechsen kletterten munter auf den warmen Natursteinfassaden der Häuser, und die Katzen schnurrten träge in der Sonne liegend. Der harte Winter war nicht vergessen, aber vorbei.
Anselmo hatte seine Hemdsärmel nach hinten gekrempelt, als er die Passstrasse des Maloja hochging, die weiter oben sicher noch einen Monat lang für Fuhrwerke wegen des Schnees gesperrt blieb.
«Anselmo, wohin so eilig?» Die dreissigjährige Schäferin winkte ihm lachend unterhalb des Pfades zu.
Sein Vater hatte ihn schon mehrmals vor ihr gewarnt, ihr Mann war vor zwei Jahren mit dem Sohn nach Italien verschwunden, seither lebte die Frau alleine im Haus, am Rand des Dorfes, und verdiente etwas Geld, indem sie die Geissen und Schafe im Tal hütete und auf den Alpenweiden sömmerte. Dazu verkaufte sie ein Sammelsurium an Kräuter- und Pflanzenmixturen, meist nur im nahen Italien, denn im Tal vertraute ihr kaum noch jemand.
Eindringlich hatte Vater ihn vor des Fleisches Lust gewarnt, viele Male mit ihm deshalb gebetet, damit Anselmo eine von Gott gewollte Ehe erwarten konnte, ohne sich zuvor im Fegefeuer der Triebhaftigkeit zu verbrennen.
Die Schäferin war keine Schönheit, aber auch nicht hässlich. «Unscheinbar» war ebenso eine unpassende Beschreibung, denn sie strahlte eine falsche Fröhlichkeit aus, das hatte er sofort gespürt. Alles an ihr liess ihn eigentlich sich von ihr abwenden, doch sie war ihm gewissermassen überlegen, denn sie war eine erwachsene Frau und er ein Sprössling, der wie der Frühling hinaus ins Leben trieb und nicht alles verstand.
«Anselmo, nun warte doch endlich.» Sie hob den Rocksaum und eilte lachend den Berg hoch, während er weiterging, wenn auch langsamer.
Sie hielt ihn am Arm fest, als sie ihn erreicht hatte. «Anselmo, mache ich dir Angst?» Sie trug den strengen Parfümgeruch an sich, den sein Vater immer sofort an ihm roch, wenn er ihr, wenn auch nur kurz, im Dorf begegnet war. Zu Hause hatte dann Vater jeweils Fragen gestellt und Anselmo ehrlich darauf geantwortet, sodass es immer in langen Gebeten geendet hatte.
Anselmo konnte sich keinen Reim darauf machen, warum er sich nicht von der Schäferin abwenden konnte, einfach davoneilte. Er mochte ihre dunklen Locken ebenso wenig wie ihre seltsamen nervösen Augenzuckungen und ihre Unruhe, die sie dann bekam, wenn sie ihm zu nahe kam. Dabei zog sie manchmal die Oberlippe hoch, sodass die beiden Eckzähne auf der Unterlippe aufstanden. Sie wirkte dann dümmlich und konnte ihre Gefühlswelt nicht verbergen.
«Anselmo, der Frühling ist so schön wie dein Gesicht», begann sie zu reden, damals war er ja noch nicht der Gezeichnete gewesen. Schmeichelnd erzählte sie, wie wunderbar er doch wäre, doch er fühlte schnell, es ging einzig und allein um sie, um das, was sie suchte. Sie zog ihn an den Waldrand, und sie setzten sich ins warme Grün. Sie redete nervös, ihre Augenlider zuckten, während sie seine Hand unter ihren Rock schob.
Noch nie war er einem Mädchen, geschweige einer Frau so nahe gekommen. Nicht mal annährend. Sein Körper reagierte angespannt: Eine Mischung aus Sündenlust, Abwehr und Ekel, weil sie stank, überkam ihn. Das war schlimmer als falsch – es war Sünde. Doch die Schäferin dachte nicht daran, es langsamer anzugehen. Sie schob ihm seine Hose hinunter und zog ihn auf sich. Der Kampf zwischen Gut und Böse begann sich in seinem Innersten zu formen, ganze Armeen, so schien es ihm, marschierten gegenseitig auf.
In ihren Augen sah er nun die Gier, das zu bekommen, was sie wollte, ihr krampfhaftes Lächeln, während er aus einer seltsamen zerstörerischen Gefühlsmischung ihr nachgab, als wäre er zu nahe am Abgrund gestanden und deshalb in sie gefallen.
Keine Minute später packte ihn das blanke Entsetzen, sodass er sich schnell aufrichtete und sich beschämt und voller Ekel die Hose hochzog, als in diesem Moment sein Vater mit einem Stock in der Hand nur wenige Meter von ihm entfernt auftauchte.
Erzürnt hob der Vater den schweren Stecken und liess diesen auf die Teufelshure, wie er sie dabei anschrie, hinunterfahren, immer wieder, bis sie blutend und wankend Richtung Dorf flüchtete.
Anselmo selbst floh in grosser Angst den Pfad hoch und verschwand zwischen den Bäumen. Vögel zwitscherten munter aus den Zweigen, als er wenige hundert Meter oberhalb Casaccia die nur aus Stein erbaute Wallfahrtskirche San Gaudenzio völlig ausser Atem erreichte.
Seit Jahrhunderten stand sie dort, nun war sie baufällig, und der Himmel war ihr Dach geworden. Doch wer sie betrat und unter den intakten Chorbögen weiter ins Innere schritt, den überkam das Gefühl von Heiligkeit.
Seit Anselmo denken konnte, hatte Vater ihm und seinem älteren Bruder, der den Namen des heiligen Gaudentius trug, die Geschichte dieser Wallfahrtskirche erzählt, die doch so eng mit der ihrigen Familiengeschichte verknüpft war, wie er darin erfuhr.
«Wisst ihr, meine lieben Söhne, wir dürfen es niemals vergessen», so fing der Vater immer an, meist an den langen dunklen Winterabenden, wenn die Tiere versorgt waren und sie um den warmen Ofen sassen und er sich die Pfeife gestopft hatte, während draussen der Schnee sich leise türmte und eine tiefe, alles einhüllende Stille das Tal füllte. Die Holzscheite knackten im Feuer, in der beengten Stube war es behaglich warm. Auch wenn Anselmo die Geschichte bereits viele Male gehört hatte, so konnte Vater sich immer seiner ganzen Aufmerksamkeit gewiss sein. Bilder entstanden dann vor Anselmos innerem Auge, und er hatte sich stets gewünscht, dabei gewesen zu sein, als damals alles geschah.
«Also, meine braven Buben, hört gut zu, damit ihr gute Menschen vor dem HERRN werdet und er euch für sein Himmelreich reichlich rüsten kann.» Er zog an seiner Pfeife und blies den aromatischen Rauch in die kleine Stube.
Ohne Zweifel, sein Vater war ein Mann Gottes, ein rechtschaffener dazu, wusste Anselmo und hörte gebannt zu.
«Im 4. Jahrhundert kam ein gottesfürchtiger Mann, genannt Gaudentius von Novara, aus Norditalien das Tal hoch, um auch unser Casaccia, das hinterste und kleinste Dorf im Bergell, vom Heidentum zu befreien. Ungeachtet dessen, dass seine Gottesbotschaft nicht von allen Einheimischen gehört werden wollte, predigte er mitten im Dorf und verkündete die Heilige Schrift im Auftrag des päpstlichen Stuhls in Rom. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Damals glaubten diese Heiden noch an Geister, machten Feuerzauber und beteten Steine an. Einen Fremden wollte man damals nicht im Tal haben. Er hätte ja die Kinder stehlen können oder die Frauen schänden. Doch Gaudentius von Novara liess sich von nichts und niemandem aufhalten und blieb standhaft.» An dieser Stelle legte der Vater meist eine theatralische kurze Pause ein und zog an seiner Pfeife.
«Eines Tages, er war erst wenige Wochen im Tal und predigte mutig an einem Sonntag, auf dem Rand des Dorfbrunnens stehend, das Wort Gottes, ergriffen ihn aufgebrachte Einwohner und schleiften ihn einige hundert Meter ausserhalb des Dorfes Richtung Malojapass hoch. Neben dem Saumpfad wurde er in einem Kieferwäldchen auf einen Baumstumpf gelegt. Der Schmied des Dorfes erhob die geschärfte Axt und köpfte den Gottesmann mit einem einzigen Hieb, der, ohne zuvor zu jammern, damit den Märtyrertod erlitt.» Dabei blickte Lorenzo Veranzze seine Söhne eindringlich an, damit sie das Unfassbare so gut wie möglich erfühlen konnten. Und es war nicht der Ausdruck von Schrecken, der in seinen Augen lag – es war Stolz auf die Stärke Gaudentius’ in ihnen zu lesen, die alleine dem Herrgott entstammte, wie er erklärte.
«Doch dann geschah es!»
Aus der Stille des Raums erschraken sie anfangs, als er einem Paukenschlag gleich weiterfuhr: «Gaudentius erhob sich kopflos vor den erstarrenden Augen seiner Peiniger, fasste mit beiden Händen sein abgetrenntes Haupt, erhob es wie eine Laterne, schritt andächtig den Hang hoch zu einer kleinen Lichtung und legte es ab und sich daneben zur ewigen Ruhe. Der Mob bekam einen Heidenschrecken. Die feigen Mörder rannten Hals über Kopf hinunter ins Dorf, fürchteten, der Zorn seines Gottes würde sie nun treffen, sodass die Bergflanken ihr Gestein deswegen einmal mehr auf sie herunterdonnern lassen würden, als wäre es ein steinerner Fluss, der sie allesamt begraben würde. Mittlerweile waren glücklicherweise einige der Einwohner zu barmherzigen Christen geworden, das Wort des HERRN ging wie ein wunderbarer Samen in ihrer Heidenseele auf und hatte sie zu wertvollen Christen gedeihen lassen. Sie begruben den Leib des Märtyrers an Ort und Stelle und errichteten aus Dankbarkeit für sein Wirken eine kleine hölzerne Kapelle, aus der im Mittelalter eine fast dreissig Meter lange gotische Kirche erbaut wurde. In deren Innern standen einst fünf Altäre, an den Wänden hingen prächtige Heiligenbilder», schwärmte der Vater.
«San Gaudentius’ Gebeine wurden ausgegraben und in einen kleinen steinernen Wandsarkophag gelegt, der in der Kirche seinen Platz fand – er wurde vom Papst heiliggesprochen, und die Kirche erhielt seinen Namen. Das Wirken von San Gaudentius hielt nach seinem Märtyrertod weiter an: Ein Hospiz wurde angrenzend errichtet, ein beliebter Wallfahrtsort erwuchs, sodass aus allen umliegenden Ländern Gläubige den beschwerlichen Weg durch die Berge zu uns pilgerten.»
Der Vater schenkte sich Wein ein, während die Mutter den Buben eine Tasse warmer Geissenmilch reichte, sich die Schürze zurechtstrich und sich strickend neben sie setzte.
«Doch alles änderte sich, als Pietro Paolo Vergerio das Bergell erreichte», Vaters Stimme verfinsterte sich, «der ehemalige katholische Bischof von Modruš und Koper wurde zuvor durch den Papst exkommuniziert, weil er ein glühender Reformator geworden war, nachdem er in Deutschland Martin Luther kennengelernt hatte. Als nun reformierter Pfarrer verkündete Vergerio von Vicosoprano aus den neuen Glauben im gesamten Tal. Dabei hatte er auch Böses im Sinn.» Bei diesen Worten runzelte der Vater immer die Stirn.
«Dieser Vergerio stiftete am 6. Mai 1551 die Bevölkerung im Tal an, mit ihm zusammen unsere Wallfahrtskirche zu entweihen. Und jetzt stellt euch vor: Die Bilder und heiligen Reliquien San Gaudentius’ wurden von ihnen zerstört und achtlos in die Orlegna geworfen, die mit ihren Fluten alles an unserem Dorf vorbei mitgerissen hat. Der aufgebrochene Wandsarkophag zeugt noch immer davon.» Mit drei langen Schlucken leerte der Vater den Becher Roten und stellte ihn gedankenversunken auf den Tisch. Um seine Mundwinkel spielte unversehens Zuversicht in Form eines Siegerlächelns.
«Doch drei Familien, darunter unsere Vorfahren, hielten standhaft und treu am katholischen Glauben fest – bis heute! Und das, obwohl das ganze Tal reformiert wurde. Stellt euch das mal vor, was dies für Nachteile für uns katholische Minderheit mit sich gezogen hatte.»
Auch die Schlussworte blieben über die Jahre hinweg dieselben und hatten sich in Anselmos Gedächtnis eingeprägt: «Gaudentius und Anselmo, Gottes Kraft ist in uns zu allem fähig und allgegenwärtig, wenn wir sie nur zulassen!»
Manchmal redete Anselmo mit seinem Bruder noch danach, nach dem Gutenachtgebet, das stets die Mutter in der kleinen Kammer hielt, während sie alle vor der einfachen Bettstatt knieten, in der ihre Strohsäcke und die Schaffelle lagen.
An der Wand vor ihnen hing das von Vater selbst geschnitzte Kruzifix, das er vom katholischen Priester in Maloja hatte segnen lassen, daneben das Bildnis der Heiligen Jungfrau Maria Muttergottes mit seinem goldfarbenen Rahmen.
Das war nun alles lange her.
Nun war Anselmo Veranzzes Vater achtundsiebzig und überraschend schnell gebrechlich geworden, wie er letztes Jahr bei seinem Besuch im Bergell feststellen musste. Seinen Bruder Gaudentius hatte Anselmo dann auch angetroffen, denn es war die Beerdigung ihrer Mutter gewesen.
Vater hatte bei der Abdankung mit leiser Stimme erzählt, wie er 1889 als Achtzehnjähriger das Tal verlassen hatte, um nach Chur zu wandern, um an der Kantonsschule das Lehramt zu erwerben. Nur mit einem kleinen Bündel an einem Stecken hängend geschultert, war er zu Fuss über den langen Septimerpass ins Oberhalbstein, nach Bivio, gewandert. Er hatte später davon gesprochen, dass es wie eine Art Pilgerreise gewesen sei, auf den abgeschiedenen Saumpfaden zu marschieren, die die Römer ausgebaut hatten. In insgesamt vier Tagen wanderte er weiter, über Savognin, Tiefencastel und via Lenzerheide bis nach Chur.
Während diesen Jahren in der grossen Kantonshauptstadt mit deren über neuntausend Einwohnern lernte er Gelsomina kennen. Sie heirateten 1901, und er kehrte mit ihr nach Casaccia zurück und übte gewissenhaft sein schlecht bezahltes Lehramt aus. Die kleine Landwirtschaft, die ihm sein Vater überliess, half ihnen in den Jahren des Ersten Weltkriegs, nicht zu verhungern, auch wenn der Hunger ein ständiger ungebetener Gast im Hause war. Als dann noch die Spanische Grippe im kleinen Tal an manche Tür klopfte und das Totenglöcklein zu viele Male läutete, da hatten sie als Familie im festen Glauben weiter darauf vertraut, dass der Herrgott ihnen ihr Himmelreich zur rechten Zeit öffnen würde.
Das alles erzählte Vater, während sie am offenen Grab standen. Es roch nach warmer Erde und dem einzigen Blumengebinde, das die alte Signora Giacometti, die fast blind war, mit ihren knorrigen Fingern gebunden hatte, vielleicht ahnend, dass sie nur eine Woche später daneben beigesetzt würde.
Gaudentius, der drei Jahre älter war als Anselmo, war in Chiavenna, in der italienischen Provinz Sondrio, zum Priester ernannt worden, und das zum grossen Stolz ihres Vaters. Er folgte deshalb dessen Wunsch und hielt eine Abdankungspredigt vor der Handvoll Trauernder, die aus dem Dorf kamen.
Ihr Grab fand die Mutter, wie es ihr letzter Wille war, auf dem alten Friedhof neben der Wallfahrtskirche San Gaudenzio.
Es war ein kraftvolles Gefühl für Anselmo gewesen, in der von der Sonne lichtdurchfluteten zerfallenen Kirche zu stehen, auch wenn die Mutter soeben zu Grabe gelassen wurde. Ein sonderbarer Schimmer bekleidete Vaters Augen. Er hatte seine Gelsomina immer geschätzt und respektvoll behandelt und war sich sicher, das wusste Anselmo, dass sie nun beim himmlischen Vater die ewige Heimat gefunden hatte.
Nun war er, Anselmo Veranzze, weit weg vom Bergell in Chur, auch wenn die ersten Automobile tatsächlich nicht nur den Julierpass rauchend und stöhnend erklommen und die Rhätische Bahn zuhinterst in die Haupttäler fuhr, sodass kaum jemand mehr solche Wegstrecken zu Fuss zu gehen brauchte.
Was, dachte Anselmo, würde sein Vater voller Stolz von ihm denken, wenn das alles hier im Täli vorüber war? Was, wenn er erführe, wie er sich für das Himmelreich aufopferte? Der geistige Samen, der seit Jahrhunderten in ihrer Familie eingepflanzt worden war, würde nun endlich auch in ihm, Anselmo, aufgehen, damit er reiche Frucht für den HERRN erbringen konnte und seinen Vater ebenso stolz machen könnte, wie Bruder Gaudentius es bereits getan hatte.