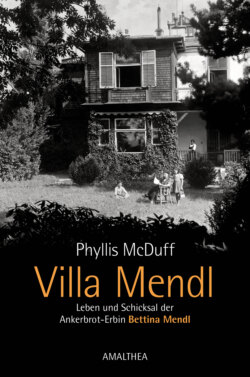Читать книгу Villa Mendl - Phyllis McDuff - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 ERSTE ERINNERUNGEN
ОглавлениеMeine Beine waren gerade ausgestreckt. Ich konnte meine Knie nicht abbiegen. Kinder haben kurze Beine, besonders wenn sie klein gewachsen und kaum drei Jahre alt sind. Jinny hielt den Kopf gesenkt und fraß Gras. Sie war viel zu dick für mich. In Wahrheit war sie trächtig und ihr Bauch schief und unförmig. Ich wusste genau, dass ich Jinny die Zügel in voller Länge überlassen musste, sonst wäre ich von ihrem Hals auf den Boden hinuntergezogen worden. Ich schaute zu meinem Vater, der vor mir ritt und immer wieder zu mir nach hinten sah.
»Ich brauche einen Stock, um sie zum Gehen zu bringen – ich kann meine Beine nicht abbiegen«, erklärte ich ihm. Ich wetzte hin und her, um mich auf die lange Rutschbahn über Jinnys Flanke vorzubereiten. Ich wollte mir einen Stock besorgen und sie dann zu einem Baumstumpf oder Felsen hin manövrieren, über den ich wieder auf sie hinaufklettern konnte – in Etappen, meinen kostbaren Stock zwischen den Zähnen. Es kam mir nicht in den Sinn, die Hilfe von irgendeinem Erwachsenen in Anspruch zu nehmen. Ich musste selber zu einer Lösung kommen. Das wusste ich.
»Ich würde an deiner Stelle keinen Stock verwenden«, sagte mein Vater. »Sie dürfte ihn nicht allzu freundlich aufnehmen. Sie kennt die Peitsche vom Trabrennen – nicht, dass ich sie jemals damit geschlagen hätte –, aber sie könnte beim Anblick eines Stockes ein bisschen unruhig werden.«
Er ritt voraus und rief: »Komm schon, altes Mädchen!« Jinny hob ihren Kopf und trabte los, ihm nach, den steinigen Pfad entlang hinunter zum Bach. Bis jetzt war ich beim Reiten immer hinter Vater auf dem Sattel oder ganz früher in seiner Satteltasche gesessen. Mein geringes Gewicht war mit Kaninchenfallen und Vorratsbeuteln ausgeglichen worden.
Nun konnte ich endlich selbstständig reiten. Jinny war kein Kinderpony, Jinny war ein Traber, Jinny hatte Rennen gewonnen. Einmal auf dem Turniergelände von Barraba hatte ich beobachtet, wie sie sich an die Spitze der Gruppe gesetzt hatte und den anderen Pferden davongelaufen war. Ich selbst war balancierend auf dem Geländer an der Strecke gestanden – kreischend, klatschend und lachend. Ich hatte meinen Eltern dabei zugesehen, wie sie die Kuverts mit dem Preisgeld öffneten, und mir war damals schon durchaus bewusst gewesen, wie wichtig das war.
Jinny war reinrassig, sie hatte einen gut dokumentierten Stammbaum. Ihr eingetragener Name war Jean Lou Lou und ihr Vater ein berühmter Traber namens Lou Lou Boy. Ich hatte das lesen können und gewusst, dass Pferde, wollten sie Champions werden, einen Stammbaum haben mussten. Ihre Herkunft war wichtig und Jinny stammte aus einer guten Zucht. Vater sagte, sie »war ihr Gewicht in Gold wert«. Vater liebte Jinny und er erlaubte mir, sie zu reiten.
Natürlich war auch meine Mutter eine exzellente Reiterin, furchtlos und kompetent. Sie erzählte uns Geschichten von Hindernisrennen, die sie geritten war, wie sie durch den Wald galoppiert und auf weichen, sandigen Wegen in einem Park dahingetrabt war. Die Pferde dort hatten in Ställen gelebt und Stallknechte gehabt, die für sie sorgten. Dieser Ort war sehr weit weg.
Meine Mutter erzählte mir, dass ihr Reitlehrer immer darauf bestanden hatte, dass sie aufrecht und gerade saß. Sie hatte heiße, kratzende, aber maßgeschneiderte Reithosen, einen Hut und Handschuhe tragen müssen. Für mich gab es keine Kleidungsvorschriften. Ich ritt in Hosen aus weichem Baumwoll-Barchent, die man mir aus den abgenützten Hosenbeinen meines Vaters gemacht hatte. Niemand verlangte von mir, Handschuhe oder Stiefel zu tragen. Ich war ein sehr glückliches Kind.
Dad und ich ritten zu Mutter und Dawn, die sich im Gemüsegarten in der Nähe vom Bach aufhielten. Am Nachmittag mussten die Pflanzen mit der Hand gegossen werden, mit einem Kübel, den meine Eltern aus einer quadratischen Kerosin-Dose gebastelt hatten. Mutter schöpfte das Wasser aus dem Bach und trug es zum Garten hinüber. Er war eingezäunt, damit er vor Kaninchen und Wallabies geschützt war. Ich half oft beim Gießen. Ich hatte einen »Billy«, einen kleinen Teekessel aus Blech mit einem ähnlichen Henkel, und meine eigene Reihe von Pflanzen, denen ich Wasser geben musste.
Am liebsten hatten wir die Wassermelonen. Vater klopfte darauf, um herauszufinden, wann sie reif waren. Als wir mit dem Gießen fertig waren, setzten wir uns ans Ufer des kleinen Bachs. Vater schnitt mit seiner Axt eine Melone auf. Es war heiß und Dawn war nackt und staubig. Sie steckte ihr Gesicht in ihre Melonenscheibe und der Saft lief ihr den Bauch hinunter und hinterließ kleine Rinnsale und Tropfspuren. Als sie ihr Gesicht von der Melonenscheibe löste, kicherte sie und ich kitzelte die Saftspuren auf ihrem Bauch. Sie war rund und glücklich und wunderschön und ich liebte sie. Ich habe sie glücklich in Erinnerung. Sie war ein zufriedenes, sanftes Kind, gelegentlich konnte sie aber auch sehr bestimmt sein und sich in Krisensituationen als äußerst stark und durchsetzungsfähig erweisen.
Wir waren sehr verschieden voneinander, beinahe konträr. Das ließ uns nie zu Konkurrentinnen werden. Wir arbeiteten in gemeinsamen Belangen gut zusammen, konnten aber auch unserer eigenen Wege gehen, jede für sich. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem Dawn gehen lernte. Sie schob ein leeres Ölfass vor sich her und wackelte hinterdrein. Ich war unglaublich stolz auf sie.
Nach dem Melone-Essen mussten wir uns waschen. Wir badeten im Bach, um Regenwasser zu sparen. Sauber kamen wir nach Hause zurück. Die Pferde ließen wir am Bach entlanggehen und Dad füllte noch einen großen Blechkübel mit Wasser, um ihn zum Haus hinaufzutragen. »Ein bisschen Extrawasser für die Hunde und Hühner«, sagte er, als er den Kübel absetzte und den Sattel, den er auf seiner Schulter getragen hatte, abwarf. Ich reinigte die Wasserbehälter im Hühnerstall und in den Hundehütten. Dazu verwendete ich das Wasser, das noch darin war. Vater füllte dann das frische Wasser aus dem Kübel in die Behälter.
»Wenn du Tiere einsperrst, dann musst du sie füttern und ihnen zu trinken geben, bevor du selber isst«, erklärte er uns. »Sie sind auf deine Fürsorge angewiesen! Man soll nie seinen eigenen Bauch zuerst füllen, denn ein voller Bauch macht vergesslich!«
Das Haar meines Vaters war schneeweiß. Ich erinnere mich an seinen federnden Schritt und an seine großen Hände mit den langen, geraden Fingern, die stark und seltsam elegant waren. Seine Unterarme waren ziegelrot und mit drahtigem, schwarzem Haar bedeckt, er prüfte regelmäßig die rasiermesserscharfe Klinge seiner Axt damit. Schweigend kauerten Dawn und ich dann neben ihm und beobachteten ihn dabei, wenn er – fast wie bei einem Ritual – die Axt mit dem Ölstein bearbeitete. Es endete damit, dass er einen kleinen Fleck mit Haaren auf seinem linken Unterarm abrasierte. Danach nahm er die Lederhülle und zog sie fest über den Axtkopf. Unser ehrfürchtiges Schweigen unterbrach er oft, indem er laut und bestimmt verkündete: »Ihr dürft nie einen Finger auf diese Axt legen, versteht ihr?« – Wir nickten feierlich. Nicht einmal im Schlaf wäre uns eingefallen, ungehorsam zu sein.
Mein Vater hatte auch eine sehr lustige und verspielte Seite an sich. Unter unserer spärlichen Einrichtung befand sich ein großer Holztisch mit Klappbeinen, den Dad einmal in einem Abverkaufsladen der Army gekauft hatte. Eines Tages, als er auf uns aufpasste, klappte er auf einer Seite zwei Beine weg und baute für uns eine, wie er sagte, Rodelbahn daraus. Um die Illusion einer verschneiten Winterlandschaft zu erzeugen, streute er sogar noch Mehl darüber. Meine Mutter wurde ziemlich wütend, als sie draufkam, und so flehentlich wir sie auch darum baten, eine so tolle Rodelbahn bekamen wir nie wieder.
Als Kind war mir nie bewusst, wie klein meine Mutter eigentlich war. Selbst wenn sie sich hoch aufrichtete – und das tat sie etwa, wenn sie sich entschlossen zeigen wollte –, maß sie nur fünf Fuß und zwei Inches, also 1,57 Meter. Sie selbst führte ihren kleinen Wuchs auf ihre Unterernährung nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Im Jahr 1919, im Alter von zehn Jahren, hatte sie zudem an Tuberkulose gelitten. Sie hatte schauerliche Erinnerungen an die Klinik, in die sie damals zur Erholung geschickt worden war.
Mutter war drahtig und laut. Ihre Energie erfüllte einen Raum, bevor sie selbst da war, und wirkte nach, auch wenn sie selbst schon lange wieder fort war. Sie war leidenschaftlich, intolerant, manchmal sogar grausam. Sie war schön und furchterregend. In ihren schwarzen Augen brannte die Emotion des Augenblicks. Unrecht hatte sie ihrer Meinung nach nie, sah man von den seltenen Fällen ab, wo ihr der schiere Wahnsinn eines ihrer Projekte mit einem Schlag zu Bewusstsein kam. Dann fiel sie fast um vor Lachen und war auch durchaus bereit, ihren Irrtum einzugestehen. Erst nach ihrem Tod begriff ich die Wucht, mit der sie ihre Erlebnisse stets getroffen haben mussten. Jedes ihrer Projekte war von totalem Einsatz und einer fast grimmigen Entschlossenheit getragen. Sie trieben sie voran. Während ihres Lebens habe ich den Mut, der hinter ihren oft rätselhaft erscheinenden Entscheidungen stand, nicht immer erkannt.
Die Buschschule in Tarpoly – sie bestand aus einem Zimmer und einem Lehrer – war auf ein Minimum von zehn Schülern ausgelegt. Tatsächlich war die Schülerzahl auf acht zusammengeschrumpft. Das war ein Grund, die Schule zu schließen und den Lehrer zu kündigen, trugen die Eltern nichts zu seinem Gehalt bei. 1946, kurz vor meinem vierten Geburtstag, war ich das einzige Kind, das man – drückte man ein Auge zu – in die Schule einschreiben konnte, um die minimale Auslastung zu erfüllen. Eine Abordnung kam zu meinen Eltern und schlug ihnen vor, mich schon im kommenden Sommer mit der Schule beginnen zu lassen. Durch das Fälschen meines Geburtsdatums und in der berechtigten Erwartung, dass mein Alter bei einer möglichen späteren Überprüfung der Schule dem eigentlichen Schulalter schon eher entsprechen würde, hoffte man, die Schule und den Lehrer zu retten. Die Frage war, ob meine Eltern kooperierten.
Der Weg zur Buschschule war kurz, er betrug etwas mehr als eine Meile. Wurde die Schule geschlossen, wäre das für Dawn und all die anderen kleinen Kinder in der Nachbarschaft, die jünger waren als ich, zu einem Problem geworden. Sie alle sollten doch eine Schule in der Nähe haben. Das stand ihnen zu. Meine Eltern waren bereit zu kooperieren, und ich selbst ging mit großer Begeisterung in die Schule. Immerhin konnte ich ja schon die Worte auf Marmeladekonserven und auf Pferde-Stammbäumen lesen und Gedichte von Banjo Paterson auswendig zitieren – und ich kannte die Weltkarte. In der Mitte von Europa fand ich das »winzig kleine Österreich« und ich wusste, dass die Alpen sehr hohe Berge waren, die Sommer und Winter mit Schnee bedeckt waren. Ja, ich war bereit für die Schule.
Meine Mutter nähte mir eine Uniform aus blauem Denim. Sie schnitt sie mir aus ihrer eigenen Schuluniform zu, die den weiten Weg aus dem kleinen Österreich erst unlängst zurückgelegt hatte. Sie hatte sich in einem der Pakete »aus dem geretteten Schatz« meiner Mutter befunden, die sie in den letzten Monaten erhalten hatte. Jemand, den sie »Baby« nannte, schickte ihr diese Pakete mit einer geradezu rührenden Beharrlichkeit. Sie freute sich jedes Mal sehr darüber. Oft spürte ich jedoch auch, dass sie traurig und enttäuscht war, wenn sie den Inhalt auspackte. Die Kalender und Andenken, die dabei zum Vorschein kamen, waren der sentimentale Rest ihres früheren Lebens, über das ich so wenig Bescheid wusste.
Der Krieg in Europa war vor einem Jahr zu Ende gegangen. Meiner Mutter war klar, dass die Menschen in ganz Europa Hunger litten, und sie war besorgt, dass »Baby« es sich im Grunde nicht leisten konnte, ihr diese Pakete zu schicken. An die Arbeit mit ihrer alten Uniform machte sie sich jedoch mit großer Freude. Dieser »Schatz« würde eine gute Verwendung finden. Obwohl sie keine Nähmaschine besaß und ihrer Begabung als Schneiderin durchaus Grenzen gesetzt waren, brachte sie es fertig, die Uniform so zu ändern, dass sie mir passte. Während sie nähte, erzählte sie mir vom Cheltenham Ladies College.
Sie erzählte mir vom Internat, von den Schlafsälen, den Regeln, den Lacrosse- und Hockey-Spielfeldern. Sie erzählte mir, wie sehr sie ihre Daunendecke vermisst hatte – das war, wie sie mir erklärte, die weiche, warme Decke, unter der sie zu Hause in Österreich geschlafen hatte. Die Engländer schliefen unter eng in die Bettrahmen eingeklemmten Leintüchern. Den jungen Ladies war es nicht erlaubt gewesen, sich im Bett zusammenzurollen oder auf dem Bauch zu schlafen. Sie hatten auf dem Rücken liegen müssen, um eine gute Haltung zu bewahren.
Eine gewisse Miss Wraith – sie hatte dort eine besonders wichtige Position innegehabt – hatte die Einhaltung all dieser Regeln überwacht, meiner Mutter war es sehr schwergefallen, sie alle zu befolgen. Sie war des Öfteren für ihr schlechtes Betragen bestraft worden. Ihr Bruder Otto hatte sie von Zeit zu Zeit besucht, jedoch waren ihr ihre gemeinsamen Ausflüge immer häufiger verboten worden, da sich ihre »schwarzen Punkte« gehäuft hatten. Jahre später fand ich eine Bemerkung darüber in ihrer Autobiografie: »Cheltenham war sehr interessant für mich. Nicht immer glücklich, weil ich die Engländer nicht immer verstand. Ich rebellierte gegen ihre Lebenseinstellung. Zum Beispiel mussten wir einmal ein Bild zum Thema Der Sturm zeichnen, alle malten das Gleiche: ein Schiff auf stürmischer See. Ich malte auf ein hochformatiges Bild, was mir in den Sinn kam: eine Weltkugel, darunter eine Hölle in Rot und Gelb und darüber den Himmel, in dem Geister schwebten. Gott setzte ich in die Mitte des Bildes und um ihn herum die Engel und Heiligen, die ihn priesen. Man schickte mich daraufhin zur Schuldirektorin und die fragte mich, weshalb sich mein Bild so sehr von den anderen unterschied. Ich war wütend! Alle anderen Mädchen brüsteten sich damit, dass schon ihre Mütter und Großmütter Cheltenham besucht hatten. Also sagte ich zu der Schulleiterin: ›Mein Bild ist anders, weil weder meine Mutter, meine Großmutter noch meine Urgroßmutter in Cheltenham waren.‹ – Die Direktorin war entsetzt, sagte aber nur: ›In Ordnung. Du kannst gehen.‹«
Nachdem Bettina das College abgeschlossen hatte, kehrte sie in die Villa Mendl zurück. Sie war sechs Monate lang nicht zu Hause gewesen. Als sie ankam, beeilte sie sich, ihre Mutter zu finden. Ihre Mutter liebte die Musik von Johann Sebastian Bach und Bettina hatte mit viel Fleiß und Eifer eine Fuge von ihm eingeübt, die sie ihr nun vorspielen wollte. Mit der Geige in der Hand lief sie durch das große Haus und suchte nach ihrer Mutter.
»Wo ist Mama?«, fragte sie die Bediensteten, aber diese wichen ihrer Frage aus. »Frag deinen Vater «, antworteten sie ihr.
Als der Abend anbrach und Fritz Mendl nach Hause kam, klopfte meine Mutter, noch immer mit der Geige in der Hand, an die Türe seines Büros. »Wo ist Mama?«, fragte sie noch einmal. Er erzählte ihr, dass ihre Mutter während ihrer Abwesenheit an Krebs gestorben war. Sie war außer sich vor Empörung, dass man ihr nichts davon gesagt hatte. Sie warf ihrem Vater Verrat vor und verlangte eine Erklärung.
»Niemand hat jemals so mit meinem Vater gesprochen«, erzählte sie mir später. »Niemand hätte das gewagt.«
Ihr Vater hätte nur gesagt: »Du wurdest nicht informiert, weil du die Schule abschließen musstest. Die Pflicht geht vor. Vor allem musst du Disziplin lernen. Vergiss das nicht.«
Meine Mutter verzieh ihm die Härte seiner Worte und von diesem Tag an waren sie einander sehr nahe. Er bewunderte ihren Mut und sie hatte durch die harte Fassade hindurch seine Trauer gesehen.
Meine Schule im Busch war natürlich etwas ganz anderes als das Cheltenham Ladies College. Ich muss dem Lehrer schon vorgestellt worden sein, denn ich war voll Zuversicht, als ich mich an meinem ersten Schultag auf den Weg machte. Meine Mutter war begeistert von dem Lehrer. Eddie Rascall war jung – wahrscheinlich war die Schule in Tarpoly sein erster Arbeitsplatz – und er war schwedischer Abstammung. Das gab meiner europäischen Mutter ein Gefühl von Sicherheit. »Es wird gut gehen, er ist Schwede«, hörte ich sie sagen und ein anderes Mal: »Er wird es verstehen, er kommt aus Schweden.«
Schuhe waren Bestandteil meiner neuen Uniform. Sie waren per Post aus Sydney gekommen. Es waren übertragene Schuhe von meinen Cousinen, sie waren schwarz, mit einem breiten Band über dem Rist und einer großen Schnalle. Hübsch anzusehen waren sie, dennoch wollte ich sie nicht tragen. Bisher hatte ich weiche Pantoffeln aus Kaninchenfell angehabt, die meine Mutter für uns nähte, und die waren um einiges bequemer als diese neuen Schuhe. Mein Vater versuchte, sie mir durch Aufpolieren schmackhaft zu machen. Er polierte sie mit schwarzer Schuhpasta – und nicht etwa mit dem Hammelfett, mit dem er seine eigenen rauen Stiefel einrieb –, bis sie glänzten. Das Schuheputzen artete in eine Art feierliches Ritual aus – das nicht viel brachte, denn bei meinem ersten Ausflug zur Schule trug ich zwar die neue Uniform, die mir meine Mutter gemacht hatte, nicht aber die Schuhe. Ich hatte sie zusammen mit den Socken und dem Pausenbrot in den abgeschnittenen Zuckerbeutel gesteckt, der mir als Schultasche diente. Meinen Eltern erklärte ich, dass die Distanz zur Schule zu groß war, um sie in Schuhen zurückzulegen. Ich versprach, Schuhe und Socken anzuziehen, sobald ich das Schultor erreichte. Ich hatte die feste Absicht, dort vollständig angezogen und zivilisiert zu erscheinen – als eine ordentliche Bürgerin des Britischen Königreichs.
Als ich jedoch am Tor angekommen war, die Schuhe und Socken herausgenommen und mich gebückt hatte, um mit dem Fuß in den Socken zu schlüpfen, erstarrte ich. Es war unmöglich, diese staubigen Füße in die schneeweißen Socken zu stecken! Das Versprechen, das ich meinen Eltern gegeben hatte, war unmöglich zu halten. Auf dem kurzen Weg über den Schulhof dachte ich angestrengt über mein Schuh-Dilemma nach und fand schließlich eine Lösung.
Ich deponierte meinen Zuckerbeutel auf der Veranda, nahm Schuhe und Socken heraus und stellte sie ordentlich und gut sichtbar auf. Gerade rechtzeitig konnte ich mich noch in die Reihe der Schüler stellen, die im Hof standen, um gemeinsam in die Schule einzumarschieren.
»Guten Morgen«, begrüßte Mr. Rascall jeden Einzelnen von uns. »Wo sind deine Schuhe, Phyllis?«, wandte er sich an mich.
»Ich habe meine Schuhe und meine Socken auf die Veranda gestellt. Ich möchte sie nicht tragen, weil es nicht fair wäre.«
Er blickte mich fragend an: »Die anderen Kinder tragen alle Schuhe.«
»Ja«, gab ich zu, »aber die sind größer als ich, die können schon mit Schuhen laufen. Ich kann das noch nicht und das würde bedeuten, dass mich keiner zum Kricket-Spielen holt!«
Die Kinder hörten aufmerksam und etwas besorgt zu.
»Hier wachsen überall Disteln!«, warnte der Lehrer.
»Ich habe harte Füße«, erklärte ich.
»Es gibt auch Catheads. Kennst du die Pflanzen mit den langen, gefährlichen Stacheln?«, fuhr Mr. Rascall fort.
»Wenn ich mir einen eintrete, kann ich ihn selbst herausziehen – und ich weine auch nicht!«, gab ich zur Antwort.
Der Lehrer brauchte mich. Ich war die zehnte Schülerin und außerdem war es Zeit für das allmorgendliche »God Save the King«. Von den Stufen der Veranda herab verkündete er daher so laut, dass es alle hören konnten: »Phyllis McDuff darf ihre Schuhe auf der Veranda stehen lassen und barfuß laufen!« – Die Kinder seufzten erleichtert und stimmten in die Hymne ein.
Im Großen und Ganzen mochte ich die Schule. Ich saß relativ weit hinten im Klassenzimmer und hatte Buntstifte zum Zeichnen bekommen. Es gab auch eine Dose der Firma Sunshine Milk, gefüllt mit seidig glatten Muscheln von Kaurischnecken. Ich liebte es, sie anzugreifen, und wollte mehrere davon. Da ich nur so viele haben durfte, wie ich auch zählen konnte, wurde Zählen zu meiner Leidenschaft: hundert Muscheln, tausend, eine Million … Ohne Schwierigkeiten konnte ich »eine Million« sagen, mit den vielen Zahlen dazwischen lief nicht alles so reibungslos ab und Eddie Rascall ließ sich nicht so leicht täuschen. Ich musste die Muscheln zählen und in Zehnergruppen anordnen, bevor er mir mehr davon gab.
Manchmal hing ich Tagträumen nach, starrte zum Fenster hinaus und blickte sehnsüchtig zu den sanften blauen Hügeln in der Ferne. An der hinteren Wand hingen zwei ausgebleichte Drucke. Ihr Maler hatte etwas verstanden von Hügeln, vom Licht und der Form der Bäume. Das erkannte ich sofort. Gleichsam magisch konnte er die Hügel ins Haus zaubern. Erst zwanzig Jahre später erfuhr ich seinen Namen: Albert Namatjira.
Ich liebte Poesie und Literatur im Allgemeinen. Egal, womit die größeren Kinder sich beschäftigten, es erreichte mich irgendwie auch. Ich lernte das australische Gedicht »My Country« von Dorothea Mackellar und ein anderes über englische Narzissen von William Wordsworth. Ich musste die Zeilen immer und immer wieder vor mir hersagen, um sie im Kopf zu behalten. Ich konnte sie ja noch nicht aufschreiben.
An eine Geschichtsstunde, die mich geradezu in Panik versetzte, erinnere ich mich noch gut. Eddie Rascall erzählte uns von der Ankunft »der Weißen« in Australien. In Schiffen waren sie gekommen, mit langen Zauberrohren, durch die hindurch sie Dinge auch in großer Entfernung erkennen konnten. Gewehre und Gift führten sie mit sich und sie überfielen das Land und kämpften gegen die schwarzen Menschen. Sie rissen kleine Kinder – wie mich – aus ihren Familien heraus und sperrten sie jahrelang oder für immer ein. Auch Familienväter nahmen sie mit und legten ihnen Ketten um den Hals. Voll Entsetzen betrachtete ich die Bilder in dem Buch, das Eddie Rascall in der Hand hielt. Ich analysierte die Hautfarben der Kinder im Raum, hier gab es alles vom dunklen Ziegelrot auf den Armen der älteren Bauernburschen bis zu cremefarben, rosa oder hellbraun. Es waren viele Farben, aber kein Kind war schwarz oder weiß. Wo waren diese fremden und grausamen Menschen? Wie konnte ich mich vor ihnen verstecken?
Etwas in mir zwang mich, die Hand zu heben und zu fragen: »Werden die Weißen hierher kommen? Werden sie uns auch holen?« Die Antwort, die ich bekam, war zu schrecklich, um sie zu akzeptieren.
»Sie sind schon hier«, ließ uns unser Lehrer wissen. Ich schleppte diese Wahrheit schweren Herzens nach Hause. Albträume raubten mir den Schlaf. Schreiend wachte ich auf, geplagt von Visionen, in denen Geister mit weißen Gesichtern durch die Dunkelheit kamen, um mich zu holen. Sie kamen einzeln und in Gruppen, auf Pferden oder mit dem Zug. Sie fauchten und spuckten und weckten mich auf. Ich kroch zu meinen Eltern ins Bett, konnte meine Angst jedoch nicht in Worte fassen. Ich bekam Ringe unter den Augen und wurde immer dünner und blässer. »Sie braucht irgendetwas, das sie stärkt: Lebertran wird ihr guttun«, sagte Dad. Gehorsam schluckte ich den Lebertran und fing sogar an, seinen Geschmack zu mögen, aber gegen die Angst half er nicht.
Eines Abends schließlich blieb ich aus Angst davor, ins Bett zu gehen, beim Feuer kauern und fragte meinen Vater: »Dad, was werden wir tun, wenn die Weißen kommen?«
»Wer kommt? Welche Weißen?«, fragte mein Vater verblüfft. Da endlich brach alles aus mir heraus und ich erzählte ihm die schrecklichen Geschichten, die ich gehört hatte. Ich hoffte inständig, er würde sagen, dass das alles nicht wahr sei. Er starrte lange ins Feuer, dann nahm er mich auf seinen Schoß, umarmte mich und flüsterte: »Das kommt vor.« – Er war sehr zärtlich, fast war ich beruhigt, als er mich absetzte und sagte: »Du brauchst keine Angst zu haben, du bist weiß. Sie nehmen keine weißen Kinder mit.«
Hatte er den Verstand verloren? »Wo?«, zischte ich. »Wo bin ich weiß?« Ich streckte meinen braunen Arm aus. »Ich bin braun«, sagte ich. »Ich werde nie weiß sein. Wir sind alle braun, jeder Einzelne von uns. Mum, Dawn, die Kinder in der Schule, alle sind wir braun. Jeder auf seine Art. Niemand ist weiß und niemand ist schwarz!«
Er versuchte, einen Spaß zu machen und sagte: »Auf dem Bauch könntest du weiß sein.« – Er hob mein Hemd hoch und mein brauner Bauch kam zum Vorschein. Er hatte unrecht und er verstand ganz offensichtlich die Gefahr nicht, in der wir uns befanden. Nichts begriff er, rein gar nichts. Nicht einmal seine eigene Hautfarbe konnte er erkennen! Ich dachte, er hätte den Verstand verloren.
Die Schule war das kulturelle Zentrum der Gemeinde. Eine kleine Gruppe von ungefähr zehn Familien, viele davon miteinander verwandt, traf sich hier zu Elternabenden, Bürgerinitiativen und Schulsportfesten, bei Weihnachtsfeiern und an Tennis-Nachmittagen. Neben der Schule, auf einer ebenen Fläche aus rötlichem Lehm, gab es nämlich einen Tennisplatz. Der Staub vom Talkum-Puder wirbelte jeden Nachmittag über den Platz und hüllte die Szene in ein sanftes Sepia. Die Damen trugen riesige Hüte und hoben die Bälle anmutig über das Netz. Gemischte Doppel wurden mit Galanterie ausgetragen. Es gab viele Teepausen mit Diskussionen über den Regen und das Gedeihen der Pflanzen. Nicht der leiseste Hauch von Wettbewerb lag in der Luft – bis zu einem Vorfall, der diesen Tennisplatz von da an in das Schlachtfeld meiner Mutter verwandelte. Auch die sanfteste Sepiaschattierung konnte die Leidenschaft, mit der sie spielte, nicht dämpfen.
Hatte ich früher den Geschichten meiner Mutter zugehört, war mir die eigenwillige Intonation ihres Englisch nie zu Bewusstsein gekommen. Ich hatte keinen Akzent heraushören können. Erst nach und nach wurde mir klar, dass sie anders sprach als die Mütter meiner Mitschüler.
Seit zwei Jahren schon ging ich nun zur Schule. Der Krieg war vorbei und die Männer waren wieder zu Hause. Eines Tages sprachen die Kinder beim Mittagessen über ihre Onkel, die gegen »die dreckigen Deutschen« gekämpft hatten. Jemand wandte sich zu mir und sagte vorwurfsvoll: »Deine Mutter ist eine dreckige Deutsche!«
»Nein, ist sie nicht, sie ist aus Österreich!«, protestierte ich schwach, um sie zu verteidigen. Jedoch von Österreich hatte hier keiner je auch nur gehört.
»Sie redet komisch! Sie redet Deutsch! Sie ist eine dreckige Deutsche!«
Ich sprang auf und schrie: »Sie ist keine Deutsche! Sie ist Österreicherin!«
Ich wurde geschubst und gestoßen. »Sie ist eine Nazi-Hure!«, schrie jemand und dann bekam ich einen dumpfen Schlag auf den Mund. Es tat furchtbar weh. Ich schmeckte Blut. Unbändige Wut stieg hoch in mir. Ich spuckte in meine Hand – und da lagen sie, in Blut und Speichel schwimmend – meine vier Milch-Schneidezähne.
In meinem Kopf drehte sich alles. Mein Mund fühlte sich riesig und taub an. Er schwoll dick an. Tränen stiegen in meine Augen – ich würde mein Versprechen Mr. Rascall gegenüber, niemals zu weinen, nicht halten können.
Eddie Rascall versammelte die Kinder um sich und ging mit ihnen in die Klasse. Dem größten Jungen gab er den abgenützten Messingschlüssel für den Wassertank und trug ihm auf, mir dabei zu helfen, das Gesicht zu waschen.
Bruce war groß und sehr vorsichtig. Er hatte ein sauber gefaltetes Taschentuch in der Tasche, ließ das Wasser in die emaillierte Schüssel laufen und wusch mir sorgfältig das Gesicht. Da mir das Blut immer noch aus dem Mund lief, war das keine leichte Aufgabe für ihn. Ich spuckte und weinte, meine vier Zähne hielt ich fest in meiner geballten Faust. Schließlich reichte mir Bruce eine Tasse mit Wasser und ich ließ die Zähne – einen nach dem anderen – hineinfallen. Jeder erzeugte ein trauriges, kleines »Ping!«, als er am Boden ankam. Dann nahm Bruce die Zähne wieder heraus und legte sie behutsam auf das nasse Taschentuch. Ich hatte inzwischen zu weinen aufgehört und beobachtete die fast feierliche Zeremonie, im Zuge derer Bruce nun eine Streichholzschachtel aus seiner Hosentasche holte, die Zündhölzchen heraustat und meine Zähne vorsichtig hineinlegte. Am Ende machte er den Deckel fest zu.
Eddie Rascall hatte uns dabei beobachtet. Ruhig, ja beinahe bittend fragte er: »Möchtet ihr mir erzählen, was passiert ist?«
»Nichts«, antworteten Bruce und ich im Chor.
An diesem Nachmittag ging ich sehr langsam nach Hause. Meine Oberlippe war stark geschwollen und wie zum Zerreißen gespannt. Ich wusste nicht, ob ich etwas falsch gemacht hatte. Ich war nicht sicher, was genau passiert war.
Dad war draußen, als ich nach Hause kam. Er hatte mich kommen sehen und war mir ein Stück entgegengegangen. »Das sieht ja schlimm aus«, sagte er. »Leg deinen Kopf nach hinten und lass mich schauen.« – Meine geschwollene Lippe hatte die Zahnlücken bisher verdeckt.
»Hattest du Streit?«, fragte mein Vater. Ich zog die Zündholzschachtel heraus und gab ihm die Zähne. »Wer hat dir die Streichholzschachtel gegeben?«
»Bruce Bowman«, erzählte ich ihm. Sicher konnte Dad durch mich hindurch Bruces unbeholfene, aber entschlossene Freundlichkeit sehen, mit der er mir die Tränen, den Rotz und das Blut aus dem Gesicht gewaschen hatte. Es war mir besser gegangen danach, auch das würde er spüren. Ich hatte, soweit ich das beurteilen konnte, nichts falsch gemacht, und so fragte ich ganz unbefangen: »Dad, was ist eine Nazi-Hure?«
Die Farbe wich aus seinem Gesicht, er presste seine Lippen hart aufeinander und zuckte unter meiner Frage zusammen. Antwort gab er mir keine. Vielmehr ging er ins Haus, wo Mutter gerade Brot buk. Mich schob er vor sich her, und zu Mum sagte er: »Brich nicht in Panik aus, es ist halb so schlimm. Phyllis ist in eine kleine Streiterei geraten und hat eine dicke Lippe abbekommen.«
Mutters Augen weiteten sich. Sie bog meinen Kopf nach hinten, um besser sehen zu können. Ich lächelte sie an, wobei das riesige Loch hinter meiner violetten Lippe zum Vorschein kam.
»Oh, Joe!«, war alles, was sie hervorbrachte. Dad zwinkerte mir zu und gab mir zu verstehen, dass ich nun besser nach draußen gehen sollte. Ich war froh, gehen zu dürfen. Jetzt lag es an ihm zu erklären, was mir Schlimmes zugestoßen war.
Etwas später kam ich zurück. Ich lehnte am Türpfosten. Die Spannung, die über dem Raum lag, war deutlich spürbar. Dad saß beim Feuer und hielt eine Tasse Tee in seinen großen Händen. Mutter knetete den Brotteig auf dem Küchentisch. Beide schienen so tief in Gedanken versunken zu sein, dass sie mich nicht bemerkten. Mutter blickte kurz auf, knetete aber weiter. Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie wischte sie mit dem Rücken ihrer mehlbestäubten Hand weg und flüsterte: »Bastarde! Solche Bastarde!« – Sie sah zu Dad hinüber und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Was für verdammte, dreckige, elende Bastarde!« – Der alte Tisch zitterte unter der Wucht ihres Schlages, dann drehte sie sich um und lief hinaus. Sie schluchzte so erbärmlich und herzzerreißend, dass sie am ganzen Körper zitterte. Ich konnte ihre Verzweiflung spüren – und bekam Angst.
Dad streckte einen Arm nach mir aus, zog mich zu sich heran und umschlang mich mit seinen Armen. »Sie kommt wieder in Ordnung. Es geht ihr bald besser«, erklärte er. »Sie braucht ein bisschen Zeit.« – Wir starrten ins Feuer und warteten darauf, dass Mutter sich wieder erholte.
Die Tennispartien auf dem Schulgelände änderten sich von da an. Bettina zeigte von nun an ihr wahres Können. Sie spielte brillant und setzte alles daran zu gewinnen. Sie spielte mit wilder Entschlossenheit, klein wie sie war. Sie besiegte ihre Gegner nicht, sie richtete sie geradezu hin. Sie schlug die Bälle so, als ob sie ihrem Gegenüber damit die Zähne einschlagen wollte. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass sie einmal der Liebling der Wiener internationalen Tennis-Szene gewesen war.
Die Schüler der Tarpoly-Schule wurden dazu ermutigt, an einem regionalen Musik- und Lyrik-Wettbewerb in Barraba, der nächsten Stadt, teilzunehmen. Dawn und ich traten in der Kategorie »Kreative Präsentation« an. Ich suchte mir das Lied »The Bushman’s Song« von Banjo Paterson aus und übte es mithilfe meines Vaters ein bis zu dem Tag, an dem ich mit einem abgetragenen karierten Arbeitshemd und dem speckigsten Filzhut meines Vaters auf der Bühne herumstolzierte.
I’m travellin’ down the Castlereagh, and I’m a station hand,
I’m handy with the ropin’ pole, I’m handy with the brand,
And I can ride a rowdy colt, or swing an axe all day …
Ihrem Naturell entsprechend, wählte Dawn etwas viel Sanfteres. In einem altmodischen Spitzenkleid, das Haar zu Locken gedreht, rezitierte sie mit strahlendem Gesicht das Gedicht eines unbekannten Autors:
The bush was grey a week today,
With olive green and brown and grey,
But now the spring has come this way, with blossoms for the wattle.
It seems to be a fairy-tree, and hums a little song to me
And dances to the melody, the graceful, swaying wattle.
Tante Marianne hatte sie zuvor nach ausgewählten Methoden der Grete-Wiesenthal-Theaterschule in Wien unterrichtet. Unsere Cousinen hatten sie dabei unterstützt, jedoch am Tag unseres Auftritts reüssierte keine von uns. Wir waren nicht unter den Preisträgern. Gewonnen hat vielmehr eine Ballerina in einem kurzen Tutu. Bettina war wütend. Prompt titulierte sie die Siegerin als »Gogo-Girl« und erklärte, wenn man ein solches sein müsse, um es im australischen Theater zu etwas zu bringen, dann wollte sie nichts davon wissen und ihre Töchter nicht mehr auf der Bühne sehen. – Es war ganz bezeichnend für sie, dass sie die Arena erst verließ, nachdem sie uns für einen ähnlichen Wettbewerb in den größeren Städten Manilla und Sydney angemeldet hatte. Die Ergebnisse waren die gleichen, nur die Identität der Ballerinas wechselte. Mum kochte monatelang vor Wut, Dad und ich fuhren fort, einander Paterson-Gedichte aufzusagen, und Dawn tanzte herum wie eine Busch-Fee.
Unsere ganze Familie war von Rennen aller Art begeistert. An kühlen Spätnachmittagen stellten etwa Dawn und ich uns nebeneinander auf und fingierten ein Wettrennen auf einer Strecke mit trockenem, rotem Sand direkt vor unserem Haus. Dad saß auf der Veranda und drehte sich eine Zigarette, dann ging er herum und legte die Spielregeln für das Rennen fest. Dazu maß er feierlich mehrere Schritte ab und dann zog er mit dem Stiefelabsatz eine Linie in den roten Sand.
Als Ziel wählten wir zumeist einen Baum oder einen Felsen weit weg. Dawn und ich spielten, wir seien Pferde, und tänzelten rund um den Sattelplatz. Dad gab Kommentare über unsere Besitzer zum Besten, sprach über die Trainingsmethoden, die Zucht und die Erwartungen hinsichtlich unserer Leistung beim Rennen. Um die Spannung zu steigern, erfand er – frei nach Freunden oder Verwandten oder auch nach Tieren, die wir besaßen – noch zusätzliche Mitstreiter. So avancierten etwa unsere Schulkameraden oder unsere Milchkühe – zumindest vorübergehend – zu Stars auf der Rennbahn.
Unser liebster Kommentar war folgender: »Sie muss schnell sein, sie kann gar nicht langsam sein – sie ist eine Kreuzung aus ›Black Betty‹ und ›Hungry Joe‹!« – Wir fanden das sehr lustig und ließen es bei einer Gelegenheit auch unsere Mutter wissen. Sie erklärte unserem Vater daraufhin, wie »unmöglich« er wäre. Ein größeres Lob gab es jedoch nicht und Dawn und ich stritten bei unseren Wettrennen regelrecht darum, die Kreuzung »aus der Schwarzen Betty und dem Hungrigen Joe« sein zu dürfen. – In späteren Jahren wurde daraus ein geflügeltes Wort in Zeiten der Anfechtungen.
Nach dem Vorspiel nahmen Dawn und ich unsere Plätze ein. Auf das Kommando »Los!« rannten wir so schnell wir konnten auf den Zielpfosten los. Die Spielregeln meines Vaters waren zumeist so geartet, dass das Ergebnis unentschieden war. Dawn und ich protestierten heftig dagegen: »Ich habe gewonnen, Daddy, ganz sicher, ich war Erste, ich habe nach hinten geschaut, Dawn war meilenweit hinter mir.« Er antwortete darauf: »Du wärst auf der Stelle auf die Nase gefallen, hättest du beim Laufen nach hinten geschaut!«
Joe konnte kein einziges Mal umgestimmt und dazu bewogen werden, sein »Unentschieden« zurückzunehmen, aber er gab oft zu, dass »er auf diese große Entfernung nicht allzu gut sehen konnte«. Das hatte zur Folge, dass das Rennen wiederholt werden musste, immer und immer wieder …
Bald schon erreichte uns das Gerücht, dass Eddie Rascall nach den Sommerferien nicht mehr zurückkehren würde, um uns zu unterrichten. Meine Mutter war außer sich über diese völlig unerwartete Neuigkeit. Es hatte keine Verabschiedung gegeben und wir hatten keine Chance bekommen, uns allmählich an die Vorstellung zu gewöhnen, von jemand anderem unterrichtet zu werden.
»Ich dachte, er wäre ganz glücklich hier«, murmelte sie mehr zu sich selbst. »Vielleicht hat man ihm ja eine größere Schule angeboten – aber die Kinder haben so viel gelernt bei ihm. Er war ein sehr guter Lehrer.« – Sie suchte verzweifelt nach einer Erklärung.
Dad sagte: »Mich überrascht das nicht so. Er hat manchmal ein bisschen übertrieben. Seine Version von der Besiedlung Australiens durch die Weißen etwa ist sehr speziell und unterscheidet sich gänzlich von allen anderen Darstellungen in den Schulbüchern. Es wird Leute geben, die seine Art zu denken nicht mochten.«
»Meinst du, sie wollten ihn loswerden?«, fragte meine Mutter.
»Gut möglich. Ich glaube, ja. Sie könnten denken, er sei Kommunist.«
Meine Mutter war ratlos und wurde ärgerlich. »Er ist kein verdammter Kommunist«, erklärte sie mit Nachdruck. »Er hatte eben eine anständige Erziehung.«
»Das könnte das Problem sein«, meinte mein Vater. »Man kann es sich nicht leisten, zu viel nachzudenken, wenn man seinen Mund nicht halten kann.«
Ich hörte dem Gespräch meiner Eltern leicht verwirrt zu und fragte mich, was ein »Kommunist« sein könnte. Ich konnte mir die Schule ohne Eddie Rascall und seine behutsame Art zu unterrichten gar nicht vorstellen.
Das war ungefähr zur Zeit meines fünften Geburtstags. An ihn werde ich mich wegen eines wirklich einzigartigen Geschenks immer erinnern. Seit ich ein Baby war, hatte ich meinen Vater immer zum Einzäunen der Weiden begleitet. Ich weiß noch, dass ich dabei an heißen Tagen einen riesigen Hut trug und auf der kühlen Erde saß, in den halb fertig gegrabenen Pfostenlöchern, wo ich die unterschiedlichen Schichten und die Zusammensetzung der Erde studierte. Ich konnte Wurzeln sehen, die sich in den Boden bohrten, und Schiefergestein, das zerbrochen war, und Ameisengänge und Spinnen und Würmer und die aus dieser ungewohnten Perspektive riesigen Füße meines Vaters.
Ich liebte diese Pfostenlöcher. Sie waren auch sicher. Ich wusste, dass man ansonsten in keine Löcher steigen und in keine Höhlen klettern durfte. Man konnte ja nie wissen, was einen da erwartete. Bei Pfostenlöchern war das etwas anderes. Dad hob sie mit der Brechstange aus. Ich wollte auch so eine Brechstange haben, auch wenn sie nicht ganz einfach in der Handhabe war. Man durfte sie nicht in der Sonne liegen lassen, weil sie sonst heiß wurde und man sie dann nicht mehr angreifen konnte. Vielmehr musste man sie senkrecht in die Erde stecken. So blieb sie kühl. Wenn sie so in der Erde steckte, durfte ich sie auch nicht angreifen. Sie hätte umfallen und mich – schwer, wie sie war – verletzen können. Ich wusste das alles und so umkreiste ich sie aus sicherer Entfernung und bewunderte ihre symmetrische Oberfläche, die vom jahrelangen Gebrauch matt glänzte. Joe beobachtete mich dabei.
Einmal nahm ihn ein Nachbar in seinem Auto mit in die Stadt. Spätnachmittags kam er wieder nach Hause. Wir liefen ihm entgegen und Mum fragte ihn: »Hast du es bekommen, Joe?« – Dad brummte mit verschlossener Miene: »Alles in Ordnung, ich hole es später.« – In dieser Nacht noch – ich schlief schon – ging er zurück zum Grundstückstor und holte den geheimnisvollen Gegenstand.
Am nächsten Morgen steckte neben Dads Brechstange eine Miniaturausgabe von ihr in der Erde. Genau meine Größe! Meine eigene Brechstange! Nun konnte ich Löcher graben und Dinge aushebeln! Felsen, Baumstämme und schwere Objekte aller Art konnten jetzt – unter nicht ganz ungefährlichen Umständen – neu arrangiert werden. Die Kinder in der Schule konnten den Wert, den die Brechstange für mich hatte, offenbar nicht richtig einschätzen. Als ich ihnen erzählte, dass ich eine Brechstange zum Geburtstag bekommen hatte, gaben sie sich recht unbeeindruckt. Da war kein Anzeichen von Neid, was ich eigentlich erwartet hatte, aber es war auch nicht so wichtig. Zum ersten Mal, seit ich in die Schule ging, konnte ich es kaum erwarten, nach Hause zu kommen, um ein neues Experiment auszuprobieren.
Wenn ich die Spitze meiner Brechstange unter einen Felsbrocken schob und ihn mit einem Stück Holz verkeilte, konnte ich genug Hebelwirkung erzeugen, um auch große Felsblöcke nach und nach über eine gewisse Distanz zu rollen. Von Zeit zu Zeit besuchten mich unsere Nachbarskinder, junge Burschen, die älter und größer waren als ich. Es war gar nicht leicht, sie dazu zu bringen, mir bei der Umsetzung meiner Baupläne zu helfen. Ich wählte die schönsten Felsbrocken aus und baute mir mein eigenes kleines Stonehenge, eine Festung ganz für mich alleine.
Dad beobachtete mich mit einer gewissen Sorge. Er schritt ein, als ich versuchte, Felsen übereinanderzustapeln. Er sagte, er hätte keine Lust, mich zerquetscht zu sehen.
Ich habe die kleine Brechstange noch lange Zeit aufbewahrt, zusammen mit den anderen Farmutensilien. Sie war ein unendlich adaptionsfähiges und nützliches Werkzeug. Von Zeit zu Zeit kam es vor, dass jemand sie hochhielt und sagte: »Das ist das Richtige, einfach perfekt, damit wird es gehen – aber was ist es eigentlich? Es sieht aus wie eine Kinder-Brechstange!«
»Die Stadt«, das war für uns die kleine Siedlung von Barraba und die lag ungefähr zwölf Meilen entfernt. Damals hatten wir noch kein Auto. Gelegentlich fuhr Dad alleine in die Stadt. Er nahm dann den Zug. Die Bahnlinie führte schließlich nur etwa 100 Meter entfernt an unserem Haus vorbei. Dad ging die Schienen entlang bis zu einem Abstellgleis, wo der Zug regelmäßig anhielt, um schwere Güter zu verladen und Postsäcke abzuholen.
Manchmal gingen wir mit Vater mit, warteten auf den Zug, winkten ihm nach und überlegten, welche Abenteuer ihm wohl bevorstanden, während wir hier den Tag ohne ihn verbringen mussten. Dawn und ich achteten dann immer peinlich genau darauf, dass wir mit unseren Arbeiten fertig waren, ehe es dunkel wurde. Wir füllten die Box neben dem Herd mit Spänen, bis sie fast überging, prüften, ob alle Kälber ordentlich eingesperrt waren, und durchstöberten den Hühnerstall nach einem Extra-Ei. Wenn die Dunkelheit hereinbrach, lauschten wir auf das Zischen und Stampfen der Lokomotive. »Ich kann sie hören! Ich kann sie hören!«, kreischten wir aufgeregt, packten Mutter an der Hand und zogen sie schnell nach draußen, gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie der hell erleuchtete Zug um die Kurve kam.
Der zweispurige Weg, der zu unserem Haus führte, kreuzte die Bahnlinie. Parallel zu den Gleisen waren schwere, hölzerne Bahnschwellen verlegt worden, die man mit Erde befestigt hatte, sodass ein richtiger »Bahnübergang« entstanden war. Dort standen wir drei Mal pro Woche abends, um den Postsack zu fangen, den der Schaffner hinaus in die Dunkelheit warf. Der Feuer speiende Drache näherte sich, pfeifend und zischend stieß er Dampfwolken aus. An seinem Ende leuchtete eine helle rechteckige Öffnung – die Tür des Gepäckwagens –, durch die der Schaffner schwungvoll den Postsack in Richtung unserer kleinen Laterne warf. Mit einem Plumps landete der Sack dicht neben uns. Regelmäßig stritten wir darum, wer ihn dieses Mal nach Hause tragen durfte.
Dort stieg auch mein Vater immer aus dem noch fahrenden Zug aus. Ein wenig bremste der Lokführer, um ihm das Aussteigen zu erleichtern. Die Funken flogen und für einen kurzen Moment zeichnete sich seine Silhouette vor der hell erleuchteten Türöffnung des Gepäckwagens ab: Mit der einen Hand hielt er sich an dem Messing-Geländer fest, mit der anderen umklammerte er einen Berg von Paketen, nach und nach warf er sie aus dem Zug hinaus. Dann verschwand seine Silhouette wieder und der Zug sauste vorbei und verschwand in der Ferne. Wir standen auf unserem finsteren Bahnübergang und warteten. Mutter, Dawn und ich wagten es kaum, zu atmen. Endlich, nach einer Schrecksekunde, drangen die vertrauten und heiß ersehnten Worte aus der Finsternis: »Bist du da, Betty?« Natürlich waren wir da. Wir waren immer da! »Joe, hier herüber!«, rief Mutter. Unsere Augen waren von dem grellen Scheinwerferlicht des Zuges geblendet und so brauchten wir ein paar Sekunden, um uns wieder zurechtzufinden. Endlich erkannten wir Dad, wir liefen ihm entgegen und sammelten die Pakete auf. Natürlich hätten wir unseren Vater gerne umarmt, das ging aber nicht, da wir die Arme voller Pakete hatten.
An einem Abend jedoch war alles anders. Wir sahen Dads Silhouette in der hell erleuchteten Tür. Sie war über etwas gebeugt. Die Funken des bremsenden Zugs flogen mehr denn je durch die Nacht. Dieses Mal verlangsamte der Zug seine Fahrt nicht nur, sondern er hielt ganz an. Langsam stieg Vater aus und jemand übergab ihm etwas Großes, das wir nicht genau erkennen konnten. Dann winkte der Schaffner, gab sein Signal und der Zug setzte sich wieder in Bewegung.
Eine vertraute Stimme aus der Dunkelheit sagte: »Ich könnte hier ein bisschen Hilfe brauchen, Betty.« – Was bedeutete das? Nach und nach gab das Mondlicht den Blick auf etwas – oder vielmehr auf jemanden frei. Vater stützte einen Mann, der fest an ihn geklammert neben ihm her torkelte.
»Bitte halt ihn kurz, Betty«, sagte er, »damit ich die Sachen aufheben kann, die ich verloren habe.« – Nun klammerte sich der Mann an meine Mutter. Fragen hingen im Raum und dennoch sprach keiner ein Wort, als wir zurück zum Haus gingen, wo Vater die Pakete auf der Veranda abstellte, meine Mutter von ihrer Last befreite und damit zum Schuppen ging.
Wir versammelten uns in der Küche. »Ich habe ihm ein Lager aus Wolldecken gemacht, es geht ihm bald wieder gut«, sagte mein Vater.
Mutter konnte sich nicht länger zurückhalten. »Wer ist das, Joe?«
»Ein Freund. Ich habe ihn mitgenommen, damit er dir helfen kann.«
»Ist er krank?«
»Nein, er ist nur betrunken, aber er kommt bald wieder in Ordnung. Wenn er ein bisschen was isst, wird er schnell wieder nüchtern werden und sich erholen – in ein paar Tagen ist er ein neuer Mensch.«
Die Atmosphäre im Raum war angespannt. Schlagartig wurde meinem Vater bewusst, dass Bettina seine Begeisterung nicht teilte. Er sah sie offen, mit inständig bittenden Augen, an: »Ich konnte ihn nicht einfach in der Stadt zurücklassen, Betty – er würde sterben, er hat nichts zu essen. Er ist seit Wochen betrunken. Niemand gibt ihm Arbeit, solange er sich in diesem Zustand befindet. Er wird dir eine große Hilfe sein. Er kann die schweren Arbeiten übernehmen. Du wirst sehen, ich bringe ihn wieder in Ordnung, und wenn du dann trotzdem nicht mit ihm zufrieden bist, dann muss er wieder gehen.« Mit Nachdruck fügte er hinzu: »Er wird dir nicht in die Quere kommen oder zur Last fallen, Betty. Hilly ist ein Gentleman. Darauf hast du mein Wort.«
Am nächsten Morgen lernten wir Hilly kennen. Er war ein kleiner, gebrechlich wirkender, grauhaariger Mann mit faltiger Haut und schwankendem Gang. Der lebendigste Teil an ihm waren seine verschmitzten, funkelnden Augen, die vor Energie sprühten und seine schwache Verfassung Lügen straften. Er saß neben dem Feuer und mein Vater setzte ihm eine Tasse mit einem Getränk vor. Es war ein Gebräu aus heißer Milch, rohen Eiern und einem Schuss von etwas, das ihm neue Lebensgeister einhauchen sollte. Hilly machte nicht den Eindruck, als wollte er davon trinken. Joe meinte jedoch: »Trink! Es wird dir guttun.« – Gehorsam nahm Hilly ein paar Schluck davon.
Allmählich erholte er sich. Er half beim Gießen, begleitete Joe beim Errichten von Zäunen, bewies, dass er gut mit Hunden und Pferden umgehen konnte, und saß abends mit uns am Feuer und erzählte Geschichten von Wetten und Pferderennen aus seiner Zeit in Melbourne, wo er Woche für Woche auf Siegerpferden geritten war. Er begegnete meiner Mutter mit jenem kultivierten Charme der alten Schule. Er überzeugte sie ihn Kürze davon, dass er ein wahrer Gentleman war.
Zu jener Zeit begann Dawn mit der Schule – wieder einmal, um die geforderte Anzahl von Schülern zu garantieren. Zusammen pilgerten wir nun nach Tarpoly, während Bettina, Joe und Hilly die anstehende Arbeit auf der Farm gemeinsam bewältigten.
Im Laufe der Monate verschwand Hilly ein paar Mal. Gelegentlich sah er ein bisschen mitgenommen aus, wenn er wieder nach Hause kam. Manchmal musste auch mein Vater in die Stadt fahren und ihn abholen, jedoch in so einem schrecklichen Zustand wie bei unserer ersten Begegnung war er nie wieder. Darauf bedacht, uns keine Sorgen zu bereiten, informierte er uns stets über seine Absicht, für einige Zeit in die Stadt zu fahren. Er fragte meine Mutter dann auch immer, ob er dort irgendetwas für sie besorgen könnte. Er achtete strikt darauf, etwaige Aufträge vonseiten meiner Mutter zu erledigen, bevor er zur Flasche griff. Man konnte sich unbedingt auf ihn verlassen.
Eines Abends, als ich hinaus auf die Veranda lief, machte ich eine seltsame Entdeckung. Vor dem Haus unter dem Kurrajong-Baum stand eine kleine, rundliche Frau. Ich stand da und starrte sie an. Sie starrte schweigend zurück. Als ich mich von dem Schreck erholt hatte, riss ich mich zusammen, lief in die Küche zurück und stotterte: »Mummy – da ist eine Dame!«
»Eine was?«, fragte sie.
»Eine Dame, eine leibhaftige Dame.«
»Wo?«
»Unter dem Kurrajong-Baum.«
»Das musst du dir einbilden.«
»Mummy, sie ist wirklich da! Schau doch! Siehst du sie nicht?« – Ich zeigte auf den Baum.
Meine Mutter warf einen kurzen Blick hinaus in das gleißende Sonnenlicht.
»Dort ist nichts. Ich kann nichts sehen.«
Ich nahm all meinen Mut zusammen und schlich wieder hinaus auf die Veranda. Die Frau war immer noch da. Sie stand schweigend im Schatten des Kurrajong-Baums.
Ich nahm Mutter bei der Hand und zog sie hinaus auf die Veranda, wo wir nun zusammen mit offenem Mund die Erscheinung anstarrten, die plötzlich zu sprechen anfing: »Guten Abend, Missus. Ich frage mich, ob Sie mir vielleicht dabei helfen können, etwas über den Verbleib von Mister Halbert Hill herauszufinden.«
Meine Mutter begann etwas zu ahnen. »Geh und hol Daddy«, entschied sie. Ich sauste hinein, um Vater zu holen, während die beiden Frauen einander weiter anstarrten – meine Mutter unfähig, mit der Frage, die ihr gestellt worden war, etwas anzufangen, die Dame geduldig auf eine Antwort wartend.
Ich kam um das Haus herum wieder zurück, meinen Vater im Schlepptau. Mit einem Blick erfasste er die Situation, schob seinen alten Hut in den Nacken und kratzte sich am Kopf. Die Frau wiederholte ihre Bitte: »Ich möchte fragen, ob Sie mir dabei helfen können, etwas über den Aufenthaltsort von Mister Halbert Hill zu erfahren.«
»Hilly? Suchen Sie Hilly?«
Die Frau nickte: »Das dürfte er sein.«
»Erwartet er Sie?«, fragte mein Vater.
»Er könnte ein wenig überrascht sein«, sagte die Dame.
Dad rückte den Hut wieder an seinen gewohnten Platz, brummte: »Ich gebe ihm Bescheid, dass Sie da sind« und ging ins Haus.
Inzwischen hatte auch Mutter die Situation erfasst. Sie bat die Lady, auf eine Tasse Tee hereinzukommen. Ich nützte die Gelegenheit, um einen näheren Blick auf sie zu werfen. Sie hatte das sanfteste Gesicht, das ich je gesehen hatte. Es war das Gesicht all der lieben Großmütter aus den Märchenbüchern. Trotz ihrer rundlichen Figur hatte sie einen beschwingten, lebhaften Schritt, als sie die Küche betrat. Sie war gerade dabei, ihren Tee zu trinken, als Hilly hereinkam. Verlegen drehte er seinen Hut in den Händen.
»Ich habe dich wirklich nicht erwartet«, meinte er. Seine Worte klangen nicht bestürzt, sondern vielmehr ehrlich. Dann drehte er sich zu uns um.»Das ist Hannie«, erklärte er mit einem seltsamen Lächeln. Nachdem sie ihren Tee getrunken hatte, gestand sie, ihre wenigen Sachen beim Tor gelassen zu haben. – Als es kühler wurde, ging ich mit meinem Vater zum Tor, um sie zu holen: zwei Getreidesäcke, beide halb voll, Gewand, eine Wolldecke und Kochutensilien. All das hatte sie neben der Einfahrt deponiert, für den Fall, dass sie nicht willkommen gewesen wäre. Sogar damals schon, mit meinen bescheidenen Kenntnissen von der Welt, wusste ich, dass das nicht viel Gepäck war.
Hillys Frau war eine großartige Köchin. Sie lebte sich schnell ein und buk Kuchen, Pasteten und Kekse. Ihre Spezialität war Kürbistorte. In meinem ganzen Leben hat mir nie eine besser geschmeckt. Sie liebte das Haus und die Küche. Sie ging nur selten nach draußen, im Grunde nur dann, wenn es sich um kurze Wege handelte, die mit ihrer Arbeit in der Küche im Zusammenhang standen, etwa zum Holzstoß oder zum Hühnerhof. Sie war kein Fan von Gemüse und sah keinen Sinn darin, es zu gießen. Mit Hunden und Pferden hatte sich auch nichts am Hut. Hannie war das perfekte Gegenstück zu meiner Mutter, die jetzt etwas mehr Freiheit hatte, die Dinge zu tun, die sie liebte.
Trotzdem war Hillys Frau der Grund für den ersten Streit meiner Eltern, an den ich mich erinnern kann. Eines Tages, als er im Gemüsegarten arbeitete, sagte mein Vater: »Betty, du darfst die Frau nicht die ganze Zeit Hannie nennen.«
»Wie soll ich sie sonst nennen?«
»Annie.«
»Wie?«
»Annie.«
»Aber ich dachte, sie heißt Hannie.«
»Ihr Name ist Annie«, sagte mein Vater bedächtig. »So solltest du sie nennen, sonst denkt sie vielleicht, dass du dich lustig machst über sie. Du könntest ihre Gefühle damit verletzen.«
»Ist Hillys Vorname Albert?«
»Möglich.«
»Weißt du es nicht?«
»Ich kenne ihn nur als Hilly.«
»Wie lange kennst du ihn schon?«
Dad wurde wütend, er sprach langsam und deutlich und knirschte mit den Zähnen: »Ich kenne den Mann seit dreißig oder vierzig Jahren. Sein Name ist Hilly. Kümmere dich nicht um ›Halbert‹. Nenn ihn einfach Hilly und sie Annie. So verletzt du ihre Gefühle nicht! Endlich habe ich es einmal ausgesprochen.«
Es war Mutters unbeabsichtigtes »Sich-lustig-Machen« über die Umgangssprache, die besonders in der weniger gebildeten Arbeiterklasse gebräuchlich war, das Dad so zur Weißglut gebracht hatte. Sowohl Hilly als auch seine Frau setzten fälschlicherweise ein »H« vor viele Vokale und ließen es aus, wenn es tatsächlich Teil des Wortes war. Mutter hatte das nicht gewusst. Sie begann zu kichern: »Dabei habe ich wirklich gedacht, dass sie Hannie und Halbert heißen.«
»Nun, jetzt weißt du es besser.« – Dad zog seinen Hut tief ins Gesicht, stand auf und ging. Ich lief neben ihm her. »Du darfst nie die Gefühle von jemandem verletzen, nicht, wenn du es vermeiden kannst. Deine Mutter versteht das nicht.« – Ich zweifelte nie daran, wie ich sie nennen sollte. Für mich waren sie Mr. und Mrs. Hill.
Eines Nachmittags kam ich von der Schule nach Hause und fand die Küche voller Menschen: Hilly, Annie, Mum und Dad und eine fremde Dame mit langen blonden Haaren, die ein kleines Mädchen an der Hand hielt, das größer als ich war und ebenfalls langes blondes Haar hatte. Die Erwachsenen hatten offenbar gerade eine Diskussion beendet, in der sie zu einer Übereinstimmung gekommen waren. Die Dame mit den langen Haaren war dabei, sich zu verabschieden, und mein Vater sagte in beruhigendem Tonfall zu ihr: »Alles wird gut!« Sie winkte allen, die auf der Veranda versammelt waren, und ging allein den Hügel hinauf, um oben an der Straße auf jemanden zu warten, der sie abholen wollte.
Später fragte ich meinen Vater, warum die Dame gegangen war und ihr kleines Mädchen zurückgelassen hatte. »Zu viele Münder«, sagte er traurig. »Zu viele Münder.« – Ich hatte keine Ahnung, was er meinte, aber ich habe nie ihren kerzengeraden Rücken und den festen Schritt vergessen – und den Umstand, dass die Dame, nachdem sie gewinkt hatte, keinen einzigen Blick mehr zurückgeworfen hatte.
Das Kind mit den langen blonden Haaren war Annies und Hillys Enkelkind, Colleen. Aus rätselhaften Gründen, die nur Erwachsene verstanden, blieb sie bei uns. Sie wurde zu meiner ersten Freundin und war eine willkommene zusätzliche Schülerin in der örtlichen Schule. Colleen war sieben, konnte gut lesen und schrieb in gestochen schöner, gleichmäßiger Handschrift, ohne Tintenkleckse zu machen. Das verblüffte mich. Sie konnte sogar buchstabieren. Sie lernte neue Wörter wieder und immer wieder und schrieb sie am nächsten Tag schon völlig richtig. Ich versuchte, diese Methode ebenfalls anzuwenden, hatte aber selten denselben Erfolg.
Hilly, Annie und Colleen waren alle in der Scheune untergebracht, in der auch das Geschirr für die Pferde aufbewahrt wurde. Trotz dieser primitiven Bedingungen erschien Colleen jeden Morgen so sauber, hübsch und adrett wie eine Prinzessin. Ihr Haar war gebürstet und zu Zöpfen geflochten und sie trug eines ihrer zwei sorgfältig geflickten und gebügelten Hauskleider. Da Annie den Küchendienst übernommen hatte, erhielten alle drei Kinder die gleichen Lunch-Pakete, hübsch verpackt in gestärkten Leinenservietten, die um die Päckchen aus fettabweisendem Butterbrotpapier gewickelt waren.
Zur Mittagszeit breiteten wir die Stoffservietten auf unseren Knien aus und wickelten unsere Sandwiches aus. Danach glätteten und falteten wir immer das Butterbrotpapier und legten es zurück in die gestärkte Serviette, damit man es wieder benutzen konnte. Es wegzuwerfen, wäre Verschwendung gewesen.
Wenn die Schule aus war, gingen Colleen, Dawn und ich gemeinsam nach Hause. Immer stand Annie mit frischem Brot und Rübensirup für uns bereit und sorgte dafür, dass wir aus unseren guten Kleidern herauskamen. Wir hatten eine lange Liste von Arbeiten, die auf uns warteten. Wir erledigten sie gerne und mussten nur selten an sie erinnert werden. Wir sammelten Reisig und Kleinholz zum Feueranzünden. Dann holten wir Eier und sperrten die Hühner weg. Wir lockten sie mit einer einzigen Handvoll Getreide in ihr Gehege. Einige von ihnen mochten wir besonders und die behandelten wir bevorzugt. Aus den Federn, die herumlagen, bastelten wir Federkiele, um für die knapp bemessene Zeit nach dem Tee, die wir am Küchentisch verbrachten, schreiben zu üben. Wir überquerten die Koppeln, um die Milchkühe nach Hause zu treiben, und sperrten die Kälber sorgfältig weg, damit es am nächsten Morgen gute Milch gab. Wir halfen beim Gießen des Gartens, wuschen die Hundenäpfe aus und sorgten dafür, dass jeder Hund eine volle Schüssel mit sauberem Wasser hatte. Wir gruben feuchten Lehm am Bachufer aus und modellierten daraus Figuren und Teetassen, die wir zum Trocknen auf die flachen Felsen stellten. Eile hatten wir bei all dem keine. Vielmehr ließen wir uns treiben oder unterbrachen unsere Tätigkeit gelegentlich, um Blumen zu pflücken. Glockenblumen nahmen wir mit nach Hause und pressten sie in Büchern. Wir sprangen über umgefallene Bäume und verfolgten Eidechsen bis zu ihrem Versteck. Die guten Ideen gingen uns nie aus: »Sollen wir klettern gehen? Wollen wir nicht schauen, ob … Sollen wir so tun, als ob … Spielen wir …?« Langweilig war uns nie.
Dieses häusliche Arrangement hielt ungefähr ein Jahr an. Dann, eines Abends, nachdem Hilly, Annie und Colleen schlafen gegangen waren, sagte Dad ruhig: »George Raffan hat Hilly einen Job angeboten. Ich denke, er sollte ihn annehmen. Er bekommt einen regelmäßigen Lohn und ein richtiges Haus.« – Er fuhr fort, uns die Vorteile für Hilly darzulegen, ganz so, als wollte er sich selbst davon überzeugen. »Es ist ein ansehnliches kleines Haus und viel bequemer für Annie und das Kind. Der Winter kommt. Unsere Scheune da draußen ist ein spartanisches Camp, sie haben nicht einmal einen Ofen. In dem Haus wird es ihnen viel besser gehen. Von Zeit zu Zeit wird er herkommen und mir helfen, wenn ich ihn brauche.«
»Und was ist mit Phyllis? Sie versteht sich so gut mit Colleen!«, sagte meine Mutter.
»Nun, sie werden sich in der Schule sehen«, gab Dad zur Antwort, »und von Zeit zu Zeit wird Colleen sie besuchen.«
Unsere Freundschaft hielt noch lange, so lange, bis unterschiedliche Lebensmuster sie aushöhlten. Während meiner ganzen Schulzeit ist es mir nicht gelungen, jemanden zu finden, der an Colleens Liebenswürdigkeit herangekommen wäre. Auch habe ich keine Freundin mehr gefunden, die ich so für ihre natürliche Eleganz bewundert habe.
Viele Jahre später, als Colleen einen hochgewachsenen, scheuen Mann heiratete, gaben wir einen Empfang in dem Haus in Tamworth, in dem wir damals lebten. Inzwischen waren Colleen und ich einander fremd geworden, aber ich war sehr froh, dass Mutter irgendwie von ihrer Heirat erfahren und den Empfang organisiert hatte.
Mum hat auch Hilly niemals vergessen. Vierzig Jahre später erzählte sie mir voll Freude: »Ich habe Hilly gefunden! Er ist im Pflegeheim. Ich habe ihn besucht und wir sind zum Pferderennen in Tamworth gegangen.« – Ihre Augen leuchteten vor Vergnügen bei der Erinnerung an die einfachen, glücklichen Zeiten in Tarpoly.