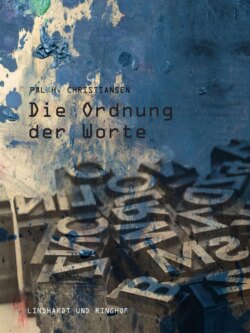Читать книгу Die Ordnung der Worte - Pål H. Christiansen - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Hitze schlug mir entgegen, als ich das Redaktionsgebäude verließ und Richtung Karl Johans Gate ging. Die Pflichtarbeit des Tages war erledigt, und ich konnte mich mit besserem Gewissen meinen Gedanken hingeben, die um meine eigenen Schreibereien kreisten. Meine früheren literarischen Bestrebungen waren nur die erste Phase eines aufblühenden Lebenswerks gewesen. Der Roman Der Brief (1984) handelte dementsprechend von einer Person, die ausbrechen musste, um ihren eigenen Raum zu schaffen: In diesem Raum würde das Allergrößte passieren! In der Kurzprosasammlung Harry war nicht ganz bei Sinnen von 1985 hatte ich zum ersten und letzten Mal die Möglichkeiten der kleinen Form ausgelotet, und in der Gedichtsammlung Auf Abwegen von 1990 machte ich Gebrauch vom Sonett.
Eine Weile hatte Funkstille geherrscht. So war es gewesen. Ehrlich gesagt, hatte ich seit mehr als zehn Jahren kein Buch veröffentlicht. Ich hatte geschrieben und geschrieben, aber es hatte zu nichts geführt. Ein Umschwung im Zeitgeist hatte mich aus den warmen Besuchersesseln der Verlagslektoren hinausgefegt, zuerst auf den Flur, wo ich mit der Mütze in der Hand gestanden und auf eine neue Chance gewartet hatte, während die frischen Kräfte der neuen Zeit in der Warteschlange vor mich gerutscht waren. Später kam ich nicht einmal mehr in den Flur, ich streifte in einem literarischen Winter umher, der Jahr und Tag andauerte.
War ich verbittert? Nein. War ich enttäuscht über das fehlende kulturelle Niveau in diesem Land? Ja. Was wusste denn der durchschnittliche Norweger darüber, wie viel Anstrengungen und Entbehrungen es kostet, einen Traum ernst zu nehmen? Was wussten die schon vom Weg zum Erfolg?
a-ha wussten alles darüber. Sie hatten es am eigenen Leibe erfahren, in London hatten sie gehungert wie eine moderne Ausgabe von Hamsun, wie Ratten zwischen Müll und Dreck. Sie hatten in der Hoffnung gelebt, in der Überzeugung, dass sie etwas in sich trugen, das zu groß für das kleine Norwegen war. Etwas, das die Brust sprengen und weit über die sozialdemokratische norwegische Selbstzufriedenheit hinausfliegen sollte. Die Probleme türmten sich vor ihnen auf, mag sein, aber sie würden sie lösen! Manche tun so, als ob das alles nur Glück gewesen wäre. Denen will ich nur sagen, dass das überhaupt nichts mit Glück zu tun hatte. Das hatte mit Talent zu tun, und damit, wie es in den Köpfen von Morten Harket, Magne Furuholmen und Pål Waaktaar aussah.
Ich bog auf die Karl Johans Gate ein und ging weiter auf das Schloss zu. Die Leute genossen das gute Wetter mit Bier und Sonnenbrillen in den Straßencafés. An der Buchhandlung Tanum hielt ich an und betrachtete die Auslagen im Schaufenster. Die neuen Kriminalromane fläzten sich neben Kochbüchern von Promi-Köchen und anderen, die angeblich Ahnung von der Essenszubereitung hatten. Die seriöse Belletristik war nirgends zu sehen, stattdessen hatte das Riksmål Wörterbuch anlässlich des Schulbeginns eine kleine Ecke zugeteilt bekommen. Ich setzte meinen Weg mit einem Kopfschütteln fort.
Ich hatte nie daran gezweifelt, dass ich mehr zu bieten hatte, als all diese Durchschnittstalente, die versuchten, Bücher zu schreiben, und deren Machwerke tatsächlich auch noch veröffentlicht wurden. Die wussten, wie man über nichts schreibt, denn hierzulande erwartet man von einem Schriftsteller, dass er ein oder zwei Bücher im Jahr herausbringt, dachte ich. Und herausgebracht werden diese Bücher, und staatlich gefördert, und damit werden sie zur Butter auf dem Brot dieser Sippe geistfreier Möchtegern-Dichter.
Aber nun wollte ich mich im Namen der Gerechtigkeit nicht größer machen, als ich im Moment war! Mir war völlig klar, dass meine bisherige Produktion ein einziges Gesellenstück darstellte im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Aber der Keim zu etwas Großem lag da! Der Literaturpreis des Nordischen Rates war augenscheinlich in Reichweite, um es mal so auszudrücken. Und während ich so spazierte, wuchs die Schreiblust in mir. Ich war wie ein Brotteig, der aufging und der bald aus der Form quellen würde, hinaus aus dem Backofen um die Welt zu erobern!
Was hatte Rainer Maria Rilke gesagt?
»Geduld ist alles, nicht rechnen und nicht zählen sondern reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht. So als würde dahinter kein Sommer kommen! Er kommt doch! Aber nur zu den Geduldigen, die da sind, als würde die Ewigkeit vor ihnen liegen,« sorglos, still und unendlich.
Ich muss sagen, dass es mitunter ziemlich nervte mit der Geduld. Außerdem war eher der Herbst meine Jahreszeit.
Ich überquerte die Universitetsgate, danach die Karl Johans Gate und näherte mich Ibsen und Bjørnson, die dort jeder auf seinem Sockel vor dem Nationaltheater standen. Es war vielleicht verlockend, ein bisschen vor sich herzuschmunzeln über die zwei, aber das waren wahrhaftig Leute, die sich höher hinauf geschwungen hatten als neunundneunzig Prozent derer, die sich heute Schriftsteller nannten, dachte ich. Ich hielt an und studierte ihre Gesichter: Bjørnsons etwas pompösen Ausdruck und Ibsens ernsthaften. Zwei Giganten auf ihrem jeweiligen Hügelchen, zwei, die, jeder auf seine Art, diesem Land ihren Stempel aufgedrückt hatten, dachte ich.
Aber was war mit Wergeland? Was war denn aus ihm geworden?
Ich sah mich um und entdeckte ihn einsam und verlassen auf der anderen Straßenseite. Da hatten sie ihn also hingestellt! Zugegeben in einer im Verhältnis etwa zum Parlamentsgebäude hervorgehobenen Position, aber doch alleine.
Wergeland wirkte äußerst zufrieden, als ich zu ihm ging, um ihn näher zu betrachten. Verglichen mit den zwei anderen Kerlen hatte Wergeland etwas Quicklebendiges und Zupackendes, dachte ich.
Jetzt sah ich die Straßenbahn auf der Stortingsgate kommen. Ich ging über die Straße und lief zur Haltestelle. Der Bus nach Tårnås kam aus der entgegengesetzten Richtung, als ich um die Ecke bog.
Als ich aus der Straßenbahn ausstieg, war ich wild entschlossen, meine Wohnung anzusteuern und sofort mit dem Schreiben anzufangen. Auf dem Weg warf ich einen Blick durch das Fenster des »Vier Hühner«. Drinnen saßen keine Bekannten, nur ein paar unermüdliche Tresengäste, die mit einem großen Bier vor sich hin dösten.
Ich hatte neulich einen Text Korrektur gelesen, in dem es darum ging, wie wichtig es sei, sich bei Hitze ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Sonst konnte der fein abgestimmte Mechanismus des menschlichen Körpers ganz schnell abkacken. Dort wurde eine Einnahme von zehn bis fünfzehn Litern täglich angedeutet; das fasste ich mal cum grano salis auf. Trotzdem hielt ich an und fühlte, wie mein Hemd am Rücken klebte. Mein Flüssigkeitshaushalt war offensichtlich aus dem Gleichgewicht. Mein Kopf war schwer, während vor allem die Arme bemerkenswert leicht waren. Ich fürchtete, die Inspiration könnte mir entgleiten, wenn ich nicht sofort etwas dagegen unternahm.
Hirsch stand wie immer hinter dem Tresen und wusch Gläser, wobei er den großen Sommerhit von Hubert & Die Hauskater vor sich hinsummte: »Tritt mich in den Arsch«.
»Sag jetzt nichts«, sagte er, »du willst ein großes Bier.«
»Ohne Schaum«, sagte ich.
»Willst du nicht vielleicht doch mal das neue Bier aus Monrovia probieren?« fragte Hirsch.
»Von wo?« fragte ich zurück.
»Die machen gutes Bier da«, sagte Hirsch.
Ich hatte keine Ahnung, was Hirsch dafür bekam, den Müll aus Liberia zu promoten. Aber ich hatte Ahnung davon, dass ich ein gewöhnliches großes Bier wollte, ohne Schaum und ohne Brotkrümel. Zum Glück gab er den Versuch auf und fing an zu zapfen, während ich dasaß und überwachte, ob auch alles mit rechten Dingen zuging.
»Viel zu viel Schaum«, sagte ich.
»Wart’s doch ab«, sagte Hirsch.
»Ich bezahl nicht für den Schaum«, sagte ich.
Hirsch entfernte den Schaum und zapfte noch etwas nach. Dann schob er das Glas über den Tresen. Ich nahm einen Schluck und genoss es, wie der Gerstensaft sich daranmachte, alle Gleichgewichte im Körper wieder herzustellen.
»Ist dir aufgefallen, dass Higgins in letzter Zeit schlecht riecht?« fragte Hirsch.
»Nein«, sagte ich.
»Er hat gestern mal reingeschaut, und ich musste ihn einfach bitten, wieder zu verschwinden«, sagte Hirsch, »geh nach Hause, duschen, hab ich gesagt.«
»Hmm«, sagte ich.
»Ich hab hier einen Laden laufen«, sagte Hirsch.
»Higgins ist Künstler«, sagte ich.
»Der Spruch ist echt zu alt«, sagte Hirsch.
Ja, war er das? Konnte man von Künstlern verlangen, dass sie sich genauso oft wuschen wie andere Leute? Ich war überzeugt, dass das nicht zutraf, war aber offen dafür, dass die Meinungen auseinander gehen konnten. Wir lebten in einem freien Land. Aber es gab natürlich Grenzen. Wenn er eines Tages wirklich seine Umgebung belästigte, musste dies ausgesprochen werden. Die Frage war bloß, ob der Tag schon gekommen war.
»Was meinst du mit riechen?« fragte ich.
»Ich meine es genau so, wie ich es sage«, sagte Hirsch.
»Meinst du eigentlich stinken?« fragte ich.
»Ich meine riechen«, sagte Hirsch.
Helle kam zur Tür rein, eine Tüte von »Farbenland« in der Hand. Das ließ böse Vorahnungen in mir aufkeimen. Wenn sie gedacht hatte, mich mit zu sich nach Hause zu schleifen, um die Küche zu streichen, hatte sie falsch gedacht. Für mich gab es wichtigere Dinge zu tun, und das musste ich ihr auf eine nette und freundliche Weise klarmachen.
»Hab ich mir doch gedacht, dass ich dich hier finde«, sagte sie.
»Ach ja?« sagte ich, »ihr zwei beiden denkt ja eine Menge schräges Zeug, was? Hirsch denkt auch so Sachen über mich. Er behauptet, er hätte gewusst, dass ich ein großes Bier wollte.«
»Reiner Glückstreffer«, sagte Hirsch.
»In Wirklichkeit will ich direkt nach Hause und SCHREIBEN«, sagte ich, »ich habe da einen Roman, der geschrieben werden muss, und wenn ich ihn nicht schreibe, was glaubst du, wer ihn dann schreibt?«
»Ich will nach Huk«, sagte Helle.
»Nach Huk?« sagte ich, etwas freundlicher gestimmt. Ich beugte mich vor und küsste sie auf die Stirn. Ich legte einen Arm um sie und zog sie an mich heran. Sie roch frisch und gut, nur ein schwacher Hauch von grüner Seife und alten Pausenbroten kündete davon, dass sie direkt von der Arbeit kam.
»Wir können am Strand grillen«, sagte Helle.
Ich warf einen Blick in die Tüte. Darin lagen Farbe, Schleifpapier, Spachtel und Spiritus, und ganz unten einige Malwerkzeuge zwielichtiger Herkunft.
»Ich hab erstmal anderthalb Liter gekauft«, sagte sie.
»Schlau«, sagte ich und wühlte in der Tüte herum.
»Die wollten mir zehn Liter aufschwatzen, aber ich hab nein gesagt«, sagte Helle.
»Braves Mädchen«, sagte ich.
Jetzt hatte ich die Werkzeuge gefunden und nahm sie für eine nähere Begutachtung heraus. Es handelte sich um einige jämmerliche Exemplare mit Plastikgriff und struppigen Borsten. Das waren ehrlich gesagt die unbrauchbarsten Malerwerkzeuge, die ich je gesehen hatte.
»Was ist das?« fragte ich.
»Pinsel«, sagte Helle.
»Ein paar Scheißpinsel, wenn das so ist«, sagte ich, »weißt du denn nicht, dass solche Billigpinsel schlimmer haaren als räudige Straßenköter?«
»Wird schon gehen«, sagte Helle.
»Nein, das wird es nämlich nicht«, sagte ich, »davon verstehst du offensichtlich höchst wenig. Hirsch kann sicher bestätigen, was ich sage.«
Aber Hirsch hatte sich verdrückt und sich irgendwo ganz hinten in der Küche versteckt, von ihm war also keine Hilfe zu erwarten.
»Zwei Dinge sind wichtig im Leben«, sagte ich, »zum einen, reichlich Wasser zu trinken. Zum anderen, beim Streichen ordentliche Pinsel zu benutzen.«