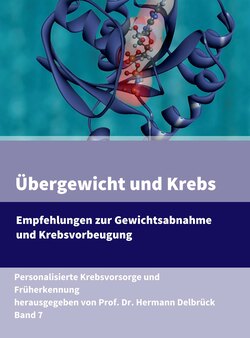Читать книгу Übergewicht und Krebs - Prof. Dr. Hermann Delbrück - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKriterien, die bei der Bewertung von Studien zu Übergewicht und Krebs zu beachten sind
Während sich der Effekt einer Krebsvorsorge-Früherkennung bzw. der einer Chemo- oder Hormontherapie relativ einfach feststellen lässt, ist dies bei der Frage, ob Übergewicht die Entstehung beeinflusst, wesentlich schwieriger. Dies liegt an der Komplexität der Krankheitsentwicklung und der manchmal bis zu Jahrzehnten dauernden Einwirkungszeit von der Einwirkung des Lifestylefaktors bis zur Krankheitsmanifestation. Dies ist aber nur einer der Gründe, weswegen der Nachweis vieler Untersuchungen zum Einfluss von Übergewicht auf das Krebsgeschehen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht standhält.
Zahlreiche Studien sind schon vom Konzept und der Methodik her ungeeignet, da in ihnen fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass Krebs ausschließlich die Folge von Übergewicht ist. Es wird nicht berücksichtigt, dass noch viele andere Einflüsse vorhanden sein müssen, damit es zum Ausbruch der Erkrankung kommt (Pan et al 2009). In der Regel handelt es sich bei den Untersuchungen auch nur um Beobachtungsstudien, die nur darauf hinweisen können, dass zwei Dinge möglicherweise miteinander zusammenhängen. Im Optimalfall können sie Korrelationen, nicht aber Kausalitäten nachweisen.
Eine Korrelation sollte bestenfalls als Grundlage für eine Hypothese dienen, die mittels weiterer Untersuchungen (und anderer Methoden) erhärtet werden muss. Statistisch gesehen, ist es z. B. eindeutig, dass stark Übergewichtige häufiger an bestimmten Krebsarten erkranken als Normalgewichtige. Das ist allerdings noch kein Beweis für eine Kausalität, denn Übergewicht geht häufig mit anderen krebsfördernden Einflüssen einher, so etwa mit Typ-2-Diabetes, schlechter Ernährung, Bewegungsarmut, erhöhtem Alkoholkonsum und psychosozialen Problemen.
Die Schlussfolgerungen aus Beobachtungsstudien beruhen häufig auf Angaben von Fragebögen. Diese sind oft subjektiv gefärbt; auch lässt sich ihr Wahrheitsgehalt meist nur schwer nachprüfen! Die Angaben beziehen sich oft nur auf einen begrenzten Zeitraum, zumeist auf die letzten Jahre vor Ausbruch der Krebserkrankung. Dem steht entgegen, dass die Zeitspanne von der Entstehungsursache bis zur manifesten Erkrankung meist viele Jahre, ja Jahrzehnte, beträgt.
Aussagekräftiger als die Schlussfolgerungen einer einzelnen Studie sind Metaanalysen, die die Ergebnisse aus vielen Studien bei unterschiedlichen Umwelt- und Ernährungsbedingungen zusammenfassen und auswerten. Allerdings hängt die Aussagekraft einer Metaanalyse von der Qualität der Studien ab, die ausgewertet werden. Eine Metaanalyse von 30 selektierten Beobachtungsstudien kann in ihrer Aussagekraft problematischer sein als die jene einer einzigen kontrollierten Studie.
Einteilung und Klassifizierung klinischer Studien
• Bei Beobachtungsstudien werden Personen in ihrer normalen Lebensführung beobachtet. Die Angaben werden anschließend hinsichtlich bestimmter Fragestellungen analysiert. Die Studien zeichnen sich dadurch aus, dass die untersuchten Bedingungen nicht kontrolliert (bewusst gesteuert) werden. Sie können pro- oder retrospektiv sein, also aktuelle oder ehemalige Verhaltensweisen betreffen. Beobachtungsstudien haben im Vergleich zu kontrollierten klinischen Studien eine geringere Aussagekraft. Sie beschreiben häufig Assoziationen; kausale Zusammenhänge sind nur eingeschränkt feststellbar).
• Bei Fall-Kontroll-Studien werden erkrankte Patienten mit nicht erkrankten Personen verglichen, die ihnen möglichst ähnlich sind. In der Regel handelt es sich um retrospektive Studien: Beide Personengruppen werden befragt bzw. ihre Krankenakten analysiert. Um z. B. Risikofaktoren für Lungenkrebs zu erkennen, werden Patienten mit bzw. ohne Lungenkarzinom nach ihren Rauch- und Ernährungsgewohnheiten sowie ihrem Beruf befragt. Die Studien haben im Vergleich zur kontrollierten klinischen Studie eine geringere Aussagekraft.
• Kohortenstudie: Bei einer Kohortenstudie werden zwei (oder mehrere) Gruppen beobachtet, die verschiedenen Einflüssen ausgesetzt sind. Beispielsweise treibt die eine Gruppe viel Sport, die andere weniger. Untersucht wird, wie sich der Gesundheitszustand in beiden Gruppen über die Jahre entwickelt, ob und woran die Teilnehmer erkranken – und wie viele von ihnen sterben. An Kohortenstudien nehmen oft Menschen teil, die bei Studienbeginn gesund sind. Man beobachtet z. B. Raucher und Nichtraucher – und sieht nach einigen Jahren, wie viele von ihnen an Krebs erkrankt sind. Eine Kohortenstudie ermöglicht die direkte Bestimmung der Neuerkrankungsrate (Inzidenz) und stellt somit eine Möglichkeit dar, Hinweise für das mögliche Risiko einer Exposition gegenüber Krankheiten zu bestimmen. Um Ergebnisse zu erzielen, sind viele Studienteilnehmer notwendig, was das Studiendesign teuer und aufwendig macht. Nachteilig ist auch, dass die Ergebnisse erst nach längerer Zeit verfügbar sind.
• Bei retrospektiven Studien werden Untersuchungsbefunde, Röntgenbilder und Datenmaterialien analysiert, die bei Beginn der Studie bereits vorliegen. Bei prospektiven Studien werden die Daten hingegen nach Beginn der Studie eigens für diese neu erhoben. Wie alle Beobachtungsstudien können auch retrospektive Studien mögliche Kausalzusammenhänge nahelegen, jedoch nicht nachweisen. Mögliche zusätzliche, störende Faktoren (Confounder) sind im ausgewerteten Datenmaterial oft nur unzureichend aufgezeichnet oder fehlen ganz.
• Randomisierte Studien: Bei einer randomisierten, kontrollierten Studie werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Zufall unterschiedlichen Gruppen zugeordnet. Die eine Gruppe erhält das neue Medikament A, die andere das bewährte Medikament B oder ein Scheinmedikament (Placebo). Medikament und Placebo sollten äußerlich und im Geschmack nicht unterscheidbar sein. Idealerweise erfolgt die Zuordnung „doppelt verblindet“: Dann wissen weder die Teilnehmenden noch die behandelnden Mediziner, wer zu welcher Gruppe gehört. Verlässliche Aussagen über Ursache und Wirkung sind nur aufgrund der Ergebnisse randomisierter, kontrollierter Studien möglich.
• Meta-Studien kombinieren eine Vielzahl von Einzelstudien zu einer Gesamtschau. Die Resultate bereits gemachter Studien werden verglichen und als Kollektiv ausgewertet. Bei Meta-Studien fallen Fehler, die in einzelnen Studien auftreten, weniger stark ins Gewicht. Die Datenlage wird auf eine breitere Basis gestellt.
• Interventionsstudien sind prospektive Studien. Der Aufbau der Studie wird vorher festgelegt. Es wird geklärt, welche Menschen für die Studie in Frage kommen (Ein- und Ausschlusskriterien). Wissen die Studienteilnehmer, welche Behandlung sie bekommen, so handelt es sich um eine unverblindete Studie. Andernfalls spricht man von einer verblindeten Studie. Werden die Teilnehmer per Zufall unterschiedlichen Gruppen zugeordnet, so handelt es sich um eine randomisierte Studie.
• Querschnittstudie: Die klassische Form der Querschnittstudie ist die Umfrage: Eine repräsentative Auswahl von Menschen – meist eine Zufallsstichprobe – wird für die Erhebung bestimmter Meinungen oder Fakten interviewt bzw. untersucht. Da die Daten nur einmal erhoben werden, sind Querschnittstudien meist schnell und vergleichsweise günstig machbar. Sie können Erkenntnisse z. B. über die Häufigkeit einer Erkrankung liefern. Querschnittstudien erlauben keine festen Aussagen über die Ursache oder die beste Behandlung einer Erkrankung.
Tücken (Pitfalls) bei Studien zum Einfluss von Übergewicht auf Krebs
• Bei vielen Ernährungsstudien wird nicht berücksichtigt, dass Lebensmittel komplexe Systeme sind, deren Inhaltsstoffe und Wirkungen untereinander bzw. mit anderen Einflüssen in Wechselwirkung treten. Kochen und backen ändern z. B. ihre Eigenschaften.
• Häufig konzentriert sich die Fragestellung ausschließlich auf die Ernährung, obwohl sich deren Einfluss nicht separat von anderen Einwirkungen beurteilen lässt.
• In vielen Arbeiten wird nicht berücksichtigt, dass der Body-Mass-Index (BMI) und der Bauchumfang keine eigene Krankheitsidentität darstellen. Der BMI ist ein reiner Surrogat-Parameter, der weder die Anfälligkeit für Krebs noch die Sterblichkeit abbilden kann.
• Die Sensitivität (Empfindlichkeit) einer Untersuchungsmethode sagt nicht zwangsläufig etwas über ihre Wertigkeit bzgl. der Zielkriterien der Studie aus.
• Übergewicht wird häufig nicht näher definiert. Handelt es sich um starkes, mittleres oder leichtes Übergewicht? Die Messparameter sollten angegeben sein (z. B. BMI, Waist to height Ratio, Taille-Hüft-Quotient).
• Ein erhöhter BMI-Wert sagt weder etwas über die Ursache des Übergewichts aus, noch lässt er Schlussfolgerungen für die einzuschlagende Therapiestrategie zu.
• Häufig wird der Zeitpunkt der Gewichtsmessung nicht angegeben, gleichwohl das Körpergewicht bei der Krebsdiagnose kaum etwas über den möglichen Einfluss auf die Krebsentstehung aussagt.
• Gelegentlich erfolgt keine Differenzierung der Krebserkrankung, obwohl die Auswirkungen von Übergewicht von Organ zu Organ unterschiedlich sein können.
• Wie lange das Übergewicht bestand, wird manchmal nicht präzisiert, obwohl dies durchaus einen Einfluss haben kann.
• Gelegentlich ist nicht klar erkennbar, wo und unter welchen Begleitumständen die Angaben erhoben worden sind. Ethnische und soziale Einflüsse werden z. B. selten gewürdigt. Dabei reagieren sozial Benachteiligte anders und leiden häufig unter zusätzlichen Erkrankungen.
• Mitunter wird bei der angeblichen Häufigkeitszunahme von Krebserkrankungen nicht die höhere Intensität an Diagnostik, speziell an Vorsorge-Früherkennungs-Maßnahmen, berücksichtigt.
• Oft erfolgten die Analysen nicht altersangepasst, gleichwohl der Organismus auf Schadstoffe je nach Alter unterschiedlich reagiert.
• Genderunterschiede werden gelegentlich nicht berücksichtigt, obwohl sich Ernährungsverhalten und Übergewicht hier unterschiedlich auswirken. Manchmal werden Erfahrungen aus Tierversuchen – oder gar Zellkulturen – auf den Menschen übertragen, was nicht statthaft ist.
• Gelegentlich fehlen Angaben zu den Zielkriterien. Geht es um das Gesamtüberleben (OS), um krankheitsfreies Überleben (DFS), um ereignisfreies Überleben (EFS), um die Phase bis zur Tumorprogression (TTP um progressionsfreies Überleben (PFS) oder um die Zeit bis zum Therapieversagen (TTF)?
• Heilungen sind nicht identisch mit Fünf-Jahres-Überlebensraten. Sie dürfen deshalb nicht zur Bewertung von Vorbeugemaßnahmen herangezogen werden, da eine vorzeitige Krebsdiagnose zwangsläufig eine längere Überlebenszeit vortäuscht.
• Bei einigen Studien werden Erfolgsquoten in Prozent, bei anderen in Absolutzahlen ausgedrückt, obwohl Angaben in Relativprozent die Wirksamkeit einer Maßnahme verfälschen können.
• Ein häufiger Fehler bei der Beurteilung des p-Wertes ist die Annahme, dass ein statistisch signifikantes Ergebnis automatisch bedeutsam ist. Tatsächlich kann ein statistisch hoch signifikantes Ergebnis völlig irrelevant sein.
• Wesentlich häufiger als negative werden positive Studienergebnisse publiziert. Negative Studienergebnisse verschwinden oft in der Schublade (Publikationsbias)!
• Gelegentlich bestehen Interessenkonflikte. Grundsätzlich sollte geklärt sein, ob eine Zusammenarbeit mit gewinnorientierten Unternehmen stattgefunden hat.
• Empfehlungen sind überzeugender, wenn die Autoren keine Interessenkonflikte nachweisen. Oft werten Lobby-Verbände unliebsame Studien ab und diskreditieren die Ergebnisse, können jedoch ihre Gegenposition nicht mit Untersuchungen belegen (Cochrane-Zentrum).
Kommentar und Empfehlungen: Zur Ermittlung der tatsächlichen Ursache für ein erhöhtes Krebsrisiko bedarf es randomisierter, kontrollierter und prospektiver Studien, bei denen Freiwillige nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen eingeteilt (randomisiert) werden. Die eine Gruppe müsste auf eine Ernährung mit wenig Fleisch festgelegt werden, während die andere sich wie gewohnt ernährt. Das Zufallsprinzip muss dafür sorgen, dass beide Gruppen wirklich miteinander vergleichbar sind. Aus ethischen, technischen und finanziellen Gründen ist ein solcher Nachweis aber nicht anwendbar.
Statistiken sind immer so gut wie die Qualität der Datenerfassung. Diese ist aber bei vielen Studien unbefriedigend. Während sich der Effekt einer Krebsvorsorge-Früherkennungs-Untersuchung – und der Erfolg einer Chemo- oder Hormontherapie – auf die Krankheitsentwicklung leicht feststellen lässt, ist das bei der Frage nach dem Einfluss von Körpergewicht wesentlich schwieriger. Dies liegt vor allem an der Komplexität der Zusammenhänge und der mitunter jahrzehntelangen Einwirkungszeit von Lifestylefaktoren vor dem Ausbruch der Krebserkrankung.
Seriosität und Glaubwürdigkeit von Gesundheitsinformationen im Internet
Zunehmend klagen Ärzte über eine „Cyberchondrie“ ihrer Patienten, von denen sie mit falsch verstandenen Empfehlungen aus dem Internet unter Druck gesetzt werden. Qualität und Seriosität sowie Relevanz und die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen im Internet sind für Laien häufig schwer erkennbar.
Kommentar und Empfehlungen: Bei Suchmaschinen sagt die Reihenfolge der Suchergebnisse nur wenig über die Qualität und Verlässlichkeit der gefundenen Informationen aus. Bei den ersten Treffern handelt es sich häufig um gekaufte Werbung.
Gute Internetseiten sollten zu erkennen geben, inwieweit sie finanziell unterstützt werden und – wenn ja – durch wen. Es muss erkennbar sein, wann die Internetseite aufgebaut und zuletzt aktualisiert worden ist. Werbung und Information müssen getrennt sein.
Grundsätzlich sollte man sich vergewissern, wer hinter den Informationen steht. Gute Seiten nennen die Namen der Betreiber, die Autoren und ihre Qualifikation. Auch die Finanzierung der Website wird offengelegt. Gute Seiten legen dar, was in der Forschung noch unsicher ist. Auch die Therapie-Nebenwirkungen werden erwähnt. Gute Seiten geben Quellen an und benutzen Erfahrungsberichte nicht als Beleg für die Wirksamkeit einer Maßnahme.
Seit Verabschiedung des Präventionsgesetzes haben Krankenkassen die Möglichkeit, gesunde Verhaltensweisen mit Boni zu belohnen. Einige Krankenversicherungen tun das bereits, indem sie den Erwerb von Smartwatches und Fitness-Trackern finanziell unterstützen. Voraussetzung ist, dass die Geräte mit einer entsprechenden App ausgestattet sind und der Kunde die Dokumentation seiner Gesundheitswerte belegt. Die Weitergabe dieser Daten, die damit auch für andere verfügbar werden, ist nicht unproblematisch. Einerseits bringen sie Vergünstigungen, wie etwa „Gesundheitsboni“, andererseits bergen sie Risiken, wie den Ausschluss von Versicherungen oder Krediten. Insofern ist Vorsicht geboten. Das Interesse mancher Krankenkassen beschränkt sich nämlich nicht darauf, etwas für die Gesundheit ihrer Versicherten zu tun. Sie wollen auch weitergehende Informationen über deren Gesundheitszustand erhalten.
Datenschützer warnen davor, mit sensiblen Gesundheitsdaten unbedacht umzugehen. Sie raten dazu, kurzfristige Vorteile gegen langfristige Gefahren abzuwägen. Bevor man die Installation einer Gesundheits-App erwägt, sollte man prüfen, ob es sich dabei um einen vertrauenswürdigen Anbieter mit qualitätsgesicherten Informationen handelt.
Kliniken, Vereine und Selbsthilfegruppen bieten meist werbefreie Anwendungen an, ohne kommerzielle Absichten. Sie arbeiten mit einem wissenschaftlichen Gremium zusammen, das für die Qualität der Informationen bürgt. Das Online-Portal HealthOn (www.healthon.de) informiert regelmäßig über Gesundheits-Apps und gibt hilfreiche Einschätzungen zu deren Qualität. Eine Checkliste, mit deren Hilfe man als Nutzer das Risiko einer App und deren Vertrauenswürdigkeit einschätzen kann, lässt sich – nach (kostenloser) Registrierung – über die unabhängige Informations- und Bewertungsplattform für Gesundheits-Apps von HealthOn problemlos einsehen. Verlässliche Gesundheitsinformationen erhält man auch vom unabhängigen Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sowie – ab 2021 – vom Nationalen Gesundheitsportal.