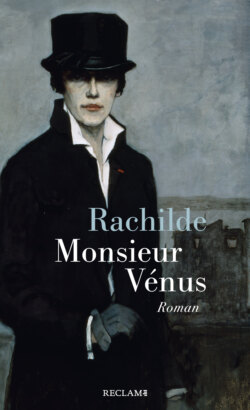Читать книгу Monsieur Vénus - Rachilde - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel I
ОглавлениеMademoiselle de Vénérande tastete in dem schmalen Flur, den ihr der Concierge angegeben hatte, nach einer Tür.
Die siebte Etage war völlig unbeleuchtet, und die Angst überkam sie, unversehens in eine zwielichtige Absteige zu geraten; da fiel ihr das Zigarettenetui ein, in dem alles für ein wenig Licht vorhanden war. Im Schein eines Zündholzes fand sie die Nummer 10 und entzifferte folgendes Schild:
Marie Silvert, Kunstblumen, Musterzeichnungen.
Und da der Schlüssel steckte, trat sie ein, doch auf der Schwelle schnürte ihr ein Bratapfelgeruch die Kehle zu und ließ sie auf der Stelle stehen bleiben. Kein Geruch war ihr so zuwider wie der von Äpfeln, daher musterte sie mit angeekeltem Schaudern das Mansardenzimmer, bevor sie sich bemerkbar machte.
An einem Tisch, wo auf einem schmierigen Topf eine Lampe qualmte, saß mit dem Rücken zur Tür ein Mann, der in eine sehr knifflige Arbeit vertieft schien. Um seinen Oberkörper schlang sich über einem weitgeschnittenen Kittel in Spiralen eine Rosengirlande, großblütige, fleischfarbene, in satinierten Granattönen changierende Rosen, die sich zwischen seinen Beinen hindurchrankten, seine Schulter umwanden und sich um seinen Kragen wickelten. Zu seiner Rechten stand ein Goldlackgebinde, zu seiner Linken ein Büschel Veilchen.
In einer Zimmerecke häuften sich auf einer zerwühlten Pritsche papierene Lilien.
Zwischen zwei löchrigen Korbstühlen lagen ein paar missratene Blumenstängel und verdreckte Teller, mittendrin ragte eine leere Weinflasche auf. Ein kleiner Ofen mit einem Sprung sandte sein Rohr durch das Dachlukenfenster und blickte mit seinem einen rotglühenden Auge begehrlich auf die vor ihm hingebreiteten Äpfel.
Der Mann spürte den kalten Luftzug, der durch die offene Tür hereindrang, schob den Lampenschirm hoch und drehte sich um.
»Habe ich mich geirrt, Monsieur?«, fragte die Besucherin unangenehm berührt. »Marie Silvert, bitte?«
»Da sind Sie schon richtig, Madame, jetzt gerade bin ich Marie Silvert.«
Raoule konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen: Mit dieser männlich klingenden Stimme wirkte die Antwort etwas sonderbar, die verlegene Haltung des Burschen mit den Rosen in der Hand half dem nicht ab.
»Sie stellen Kunstblumen her, genau wie eine echte Blumenmacherin?«
»Gewiss, muss ich ja. Hab ’ne kranke Schwester, schaun Sie, da, in dem Bett, da schläft sie … Armes Mädchen! Wirklich sehr krank. Schlimmes Fieber, ihr zittern die Finger. Bringt nichts Gescheites zustande … Ich, ich versteh was vom Malen, aber ich hab mir gedacht, wenn ich ihre Arbeit übernehme, verdien ich mehr als mit Tiere zeichnen oder Fotos abmalen. Die Aufträge regnen nicht gerade vom Himmel«, sagte er abschließend, »aber ich komm schon über die Runden.«
Er reckte den Hals, um zu schauen, ob die Kranke schlief. Nichts rührte sich unter den Lilien. Er bot der jungen Frau einen der Korbstühle an. Raoule zog ihren Nerzumhang enger zusammen und setzte sich widerwillig; ihr Lächeln war verschwunden.
»Madame wünschen?«, fragte der Bursche und ließ die Girlande fallen, um den Kittel zu schließen, der über seiner Brust weit offen stand.
»Man hat mir«, antwortete Raoule, »die Adresse Ihrer Schwester gegeben und sie mir als echte Künstlerin empfohlen. Ich muss sie unbedingt wegen eines Ballkleids sprechen. Können Sie sie nicht wecken?«
»Ein Ballkleid? Ach, keine Sorge, Madame, da muss man sie nicht wecken. Ich mach Ihnen das … Schaun wir mal, was brauchen Sie denn? Pikeearbeiten, Litzen, Applikationen?« …
Die junge Frau fühlte sich nicht gut, am liebsten wäre sie gegangen. Aufs Geratewohl griff sie nach einer Rose und musterte eingehend deren Inneres, das der Blumenmacher mit einem Kristalltropfen benetzt hatte:
»Sie haben Talent, viel Talent«, sagte sie, während sie zugleich die seidenen Blütenblätter auseinanderbog … Dieser Bratapfelgeruch wurde ihr unerträglich.
Der Künstler nahm gegenüber seiner neuen Kundin Platz und zog die Lampe vom Rand des Tisches zwischen sie. So sitzend, konnten sie sich von Kopf bis Fuß betrachten. Ihre Blicke kreuzten sich. Wie geblendet blinzelte Raoule hinter ihrem Hutschleier.
Marie Silverts Bruder war ein Rotschopf – von sehr dunklem Rot, fast rehbraun, leicht gedrungen um die hervortretende Hüftpartie, gerade Beine mit schlanken Fesseln.
Sein Haar wurzelte tief in der Stirn, ohne Wellen oder Locken, vielmehr drahtig, dicht, und man ahnte, dass es sich jedem Kamm widersetzte. Die Augen unter den schwarzen, scharf geschnittenen Brauen waren ungewöhnlich dunkel, gleichwohl dümmlich.
Dieser Mann hatte den flehenden, leicht feuchten Blick eines geprügelten Hundes. Solche Tiertränen treffen immer schrecklich ins Herz. Sein Mund besaß die festen Konturen gesunder Münder, die der Rauch, der sie mit seinem männlichen Duft sättigt, noch nicht hat welken lassen. Bisweilen blitzten hinter den überroten Lippen ungemein weiße Zähne auf, und man fragte sich, warum diese Milchtropfen nicht zwischen den beiden Glutscheiten verdampften. Das Kinn mit seinem Grübchen und dem ebenmäßigen, kindhaften Fleisch war hinreißend. Der Nacken hatte ein Fältchen wie bei einem Neugeborenen, das Speck ansetzt. Einzig die recht große Hand, die dunkle Stimme und das widerspenstige Haar ließen bei ihm auf sein Geschlecht schließen.
Raoule vergaß ihre Bestellung; eine merkwürdige Benommenheit befiel sie und nahm ihr sogar die Worte.
Indessen fühlte sie sich besser, die warmen Dämpfe, die den Äpfeln entstiegen, störten sie kaum noch, und von den Blüten, die verstreut auf den verdreckten Tellern lagen, schien sogar eine gewisse Poesie auszugehen.
Mit bewegter Stimme setzte sie von Neuem an:
»Folgendes, Monsieur; es geht um einen Kostümball, und ich pflege zu solchen Anlässen eine eigens für mich entworfene Garderobe zu tragen. Dieses Mal gehe ich als Wassernymphe, in einem Kostüm nach der Art von Grévin, einer mit grünen Pailletten bestickten Tunika aus weißem Kaschmir, mit Schilfbesatz; ich brauche daher eine breite Auswahl an Flusspflanzen, Seerosen, Pfeilkraut, Teichlinsen, Wasserlilien … Sehen Sie sich imstande, das innerhalb einer Woche zusammenzustellen?«
»Ich denke schon, Madame, ein echtes Kunstwerk also!«, antwortete der junge Mann und lächelte seinerseits, dann griff er nach einem Zeichenstift und warf ein paar Skizzen aufs Papier.
»Genau, genau so«, stimmte Raoule zu, während ihre Augen ihm folgten. »Ganz zarte Nuancen, nicht? Lassen Sie kein Detail aus … Oh! Ich zahle, was immer Sie wollen! Das Pfeilkraut mit langen, spitzen Stempeln und die Seerosen schön rosa mit braunem Flaum.«
Sie hatte den Stift genommen, um ein paar Konturen zu verbessern; als sie sich zur Lampe hinunterbeugte, blitzte der Diamant auf, der ihren Umhang zusammenhielt. Silvert sah ihn und sagte ehrerbietig:
»Die Arbeit kommt mich auf 100 Franc, den Entwurf gebe ich Ihnen für fünfzig, da bleibt mir nicht viel, wirklich, Madame.«
Raoule entnahm einem wappengeschmückten Portemonnaie drei Banknoten.
»Hier«, sagte sie schlicht, »ich habe vollstes Vertrauen in Sie.«
Der junge Mann machte eine abrupte Bewegung, mit einer solchen Freudenaufwallung, dass sein Kittel erneut aufsprang. In der Furche seiner Brust bemerkte Raoule den gleichen rötlichen Flaum, der auch seine Oberlippe zierte, etwas wie fein gesponnene, ineinander verschränkte Goldfäden.
Mademoiselle de Vénérande schien es jetzt, als könnte sie vielleicht wirklich einen dieser Äpfel essen, ohne allzu großen Widerwillen.
»Wie alt sind Sie?«, fragte sie, ohne den Blick von der durchscheinenden Haut abzuwenden, die noch seidiger war als die Rosen der Girlande.
»Ich bin vierundzwanzig, Madame«, antwortete er, und linkisch fügte er hinzu: »Stets zu Diensten.«
Die junge Frau senkte den Kopf und schloss die Augen; sie wagte nicht, noch länger hinzuschauen.
»Ach! Sie sehen aus wie achtzehn … Wie merkwürdig, ein Mann, der Kunstblumen macht … Mit Ihrer kranken Schwester sind Sie in diesem Mansardenzimmer ziemlich schlecht untergebracht … Meine Güte! … Durch diese Dachluke dringt ja kaum Licht … Nein, nein! Behalten Sie das Wechselgeld … Dreihundert Franc, das ist doch gar nichts. Apropos, notieren Sie meine Anschrift: Mademoiselle de Vénérande, Avenue des Champs-Élysées 74, Hôtel de Vénérande. Bringen Sie mir alles persönlich vorbei. Ich kann doch auf Sie zählen?«
Sie stockte beim Reden und spürte, wie ihr der Kopf schwer wurde.
Silvert nahm mechanisch einen Gänseblümchenstängel in die Hand, rollte ihn zwischen den Fingern hin und her und legte dabei, ohne darauf zu achten, die gleiche Geschicklichkeit an den Tag wie eine Frau vom Fach, wenn sie nur eben den Stoffhalm einkneift, um ihn wie einen Pflanzenhalm aussehen zu lassen.
»Abgemacht, nächsten Dienstag, Madame, ich werde da sein, zählen Sie auf mich, ich verspreche Ihnen lauter Meisterwerke … Sie sind zu großzügig!«
Raoule erhob sich; ein nervöses Zittern erfasste ihren ganzen Körper. Hatte sie sich bei diesen Elenden etwa ein Fieber geholt?
Der Bursche hingegen rührte sich nicht, in seine Freude versunken, betastete er mit aufgerissenem Mund die drei blauen Scheine: dreihundert Franc! … Er dachte nicht mehr daran, den Kittel über seiner Brust zu schließen, wo die Lampe goldene Pailletten aufflammen ließ.
»Ich hätte die Schneiderin mit meinen Anweisungen herschicken können«, murmelte Mademoiselle de Vénérande, als müsse sie auf einen inneren Vorwurf antworten und sich vor sich selbst rechtfertigen; »doch nachdem ich Ihre Probestücke gesehen hatte, zog ich es vor, selbst zu kommen … Apropos: Sagten Sie nicht, Sie seien Maler? Ist das hier von Ihnen?«
Mit dem Kopf deutete sie auf ein Gemälde, das zwischen einem grauen Lumpen und einem Schlapphut an der Wand hing.
»Ja, Madame«, erwiderte der Künstler und hob die Lampe zum Bild hoch.
Mit raschem Blick erfasste Raoule eine unbewegte Landschaft, in der fünf oder sechs steifbeinige Schafe erbittert zartes Grün weideten, unter derart genauer Wahrung der Perspektivgesetze, dass zwei von ihnen, entlehnt von anderen, fünf Beine zu haben schienen.
In seiner Unbedarftheit erwartete Silvert ein Kompliment, ein paar aufmunternde Worte.
»Seltsamer Beruf«, fuhr Mademoiselle de Vénérande fort, ohne das Bild weiter zu beachten. »Eigentlich sollten Sie besser Steine klopfen, das wäre weitaus natürlicher.«
Er begann einfältig zu lachen, ein wenig verdutzt, weil diese Unbekannte ihm vorwarf, er nütze jedes mögliche Mittel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen; dann sagte er, um überhaupt etwas zu antworten:
»Pah! Das hindert einen nicht daran, ein Mann zu sein!«
Und sein weiterhin offener Kittel ließ die goldenen Löckchen auf seiner Brust erkennen.
Ein dumpfer Schmerz fuhr Mademoiselle de Vénérande in den Hinterkopf. Von der übelriechenden Mansardenluft waren ihre Nerven überreizt. Eine Art Schwindel zog sie zu dieser entblößten Haut hin. Sie wollte einen Schritt zurückweichen, sich losreißen von diesem Zwang, flüchten … Ein wahnsinniges Begehren fasste sie am Handgelenk … Ihr Arm erschlaffte, sie ließ die Hand über die Brust des Arbeiters gleiten, als würde sie eine blonde Bestie streicheln, ein Monster, dessen Existenz ihr nicht bewiesen schien.
»Das sehe ich!«, sagte sie in ironisch kühnem Ton.
Jacques erbebte, verwirrt. Was er zunächst für eine Liebkosung gehalten hatte, erschien ihm nun wie eine Beleidigung.
Der Handschuh dieser Dame von Welt führte ihm das eigene Elend vor Augen.
Er biss sich auf die Lippen, und in dem Bemühen, irgendwie verrucht zu erscheinen, gab er zurück:
»Ach wissen Sie, wir haben die am ganzen Körper!«
Angesichts dieser Ungeheuerlichkeit verspürte Raoule de Vénérande tödliche Scham. Sie wandte den Kopf ab; da erhob sich inmitten der Lilien ein garstiges Gesicht, in dem zwei graugrüne Augen düster aufleuchteten: Es war Marie Silvert, die Schwester.
Einen Moment lang hielt Raoule inne und sah der jungen Frau direkt in die Augen; dann grüßte sie mit einer unmerklichen Kopfbewegung, senkte hochmütig ihren Schleier und ging langsam hinaus, ohne dass es Jacques, der mit der Lampe in der Hand starr dastand, in den Sinn gekommen wäre, sie zu begleiten.
»Was sagst du dazu?«, fragte er, als er wieder zu sich kam, während Raoules Wagen bereits die Boulevards erreicht hatte und in Richtung Champs-Elysées rollte.
»Ich sage«, antwortete Marie und ließ sich mit einem höhnischen Lachen zurückfallen in ihre Decken, die durch den Glanz der Lilien noch schmutziger wirkten, »ich sage, wenn du dich nicht ganz dämlich anstellst, haben wir die Sache im Sack. Sie hängt an der Angel, Kleiner.«