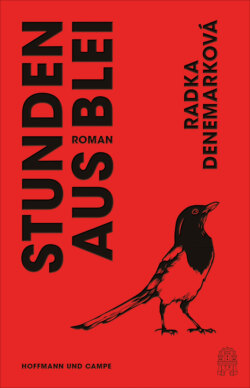Читать книгу Stunden aus Blei - Radka Denemarkova - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unter dem Himmel aus Blei
ОглавлениеPommerantsch ist ein tausendjähriger Kater, der aussieht wie ein Tiger. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens flüstert er dem bernsteinäugigen Kater Mansur wichtigtuerisch zu, die Geschichte, die er ihm erzähle, sei zwar eine aus dieser Welt, die Schriftstellerin aber existiere nicht; er habe sie erfunden, die Figur gehöre ihm. Mit der Romangeschichte habe er dem Freund Erleichterung auf Erden verschaffen wollen; denn seine Seele habe sich dem Körper entzogen, und mit jeder Silbe rücke der Freund dem Tod entgegen. Er, Pommerantsch, habe einen Abguss von der Schriftstellerin gemacht und dem Herrn diese Illusion eingeprägt, damit dessen Hoffnungslosigkeit ein Ende finde. Sonst bleibe er sein Leben lang nur der Herr, und die Herren sterben einer nach dem anderen an Einsamkeit; er, der Freund, habe nie in Erfahrung gebracht, was es bedeutet, ein Freund zu sein. Der Roman wächst und gedeiht in Pommerantschs Gedanken. Er ist verliebt in seine erdachte Figur und benimmt sich wie ein Mensch; verliebte Männer und Frauen nehmen angeblich nicht mal Zeitungsnachrichten wahr.
»Eines Tages wird ihr der Kopf platzen wie eine Walnuss. Aber weil es ein hartnäckiger Kopf ist, dauert das noch, und wir, Mansur, halten es so lange mit ihr aus, bis sie ihre feurige Stirn auf den Platz des Himmlischen Friedens gelegt hat. Der Schutzengel jedes Menschen heißt Zeit. Frauen wie sie sind ewig dabei, erwachsen zu werden, aber es gelingt ihnen nicht; sie bleiben unerreichbar, wie nah sie einem auch stehen.«
Mansur mag den Platz des Himmlischen Friedens; in China sind Dichteraugen die Namensgeber. Ein Lavendelberg, von Schmetterlingen umflattert, die Halle der Höchsten Harmonie, ein Tempel der Universalen Freude, der Palast der Himmlischen Reinheit, die Prinzessin der azurblauen Wolken, die Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie. Pommerantsch gibt zu, ein Detail übersehen zu haben; er hätte für den Herrn ebenso gut einen homosexuellen Schriftsteller erschaffen können. Auch ein anderer Beruf wäre möglich gewesen. Doch einzig die Schriftstellerinnen können Einsamkeit und Zweifel ertragen und haben keine Angst. Er sei zu faul, die Komposition noch zu ändern. Die Zeit ist kompakt wie Blei. Pommerantsch könne sie so komprimieren, dass die Uhr sie nicht anzeige. In der Antike hielt man Blei für ein Zaubermetall und ritzte Flüche in Bleitafeln. Der tigerfarbene Pommerantsch hat gelbe Augen. In ihnen spiegelt er alle Menschen wider, die es auf der Erde je gegeben hat. Pommerantsch weiß, was Literatur, was Poesie ist; seit Menschengedenken ertönt es immer wieder, ach, die Kunst, diese herrliche Absurdität – wie die Liebe oder das Abenteuer des menschlichen Lebens überhaupt, ähnlich wie die Hoffnung; ein Risiko, das man unbedingt eingehen muss; solange man am Leben ist, muss man es wieder und wieder versuchen.
»Oder denken Sie etwa, Mansur, die Menschen wissen das nicht?«
Mansur hört ohne besonderes Interesse zu und tritt den langen Marsch nach Hause an. Pommerantsch ermahnt den schwarzen, langhaarigen Mansur.
»Katzen sind unabhängig und unumerziehbar. Hoffentlich verstehen Sie, was Unabhängigkeit heißt. Man verbreitet keine Hass- oder Phantasiegeschichten, weder über sich selbst noch über andere. Katzen sind mit Drachen verwandt. Sie sind ein Sohn des Himmels, Mansur. Lassen Sie das Gähnen sein und hören Sie mir zu. Gute Herren und Herrinnen, mit denen ich im Laufe der Jahrhunderte gelebt habe, wussten es sofort: Mit mir zu spielen bedeutet, dass ich mit ihnen spiele und nicht umgekehrt. In Wirklichkeit hängen sie mehr an uns als wir an ihnen. Unser jetziger Herr ist weise. Er weiß, dass Katzen ihn nicht gleichermaßen brauchen, wie er sie braucht.«
Zu Hause im Innenhof kriecht Mansur schläfrig in seinen Korb aus Schilf und Bambusmatten, um das Gleichgewicht der Welt zu halten. Es ist eine quadratische Konstruktion mit gewölbtem Dach, die Himmel und Erde symbolisiert. Den Ming Tang alias den Tempel des Lichts bauten die Söhne des Himmels nach kosmischem Vorbild. Indem der Sohn des Himmels jede Jahreszeit in dem ihr zugewiesenen Raum beging, sicherte er dem Kosmos und den irdischen Dingen einen geordneten Lauf. Pommerantsch spricht durch die Spalten zwischen Bambusmatten und Schilf zu Mansur.
»Sie haben eine gefährliche Veranlagung, Mansur, Sie betrachten die Welt mit ängstlichen Waisenaugen. Aber Katzen klammern nicht. Sie dürfen nicht anhänglich werden, sich nicht an Menschen oder Götter klammern. Man kann höchstens an einem Ort hängen. Wir haben Glück, Mansur. Wenn sich Tiere zu stark vermehren, werden sie von den Menschen getötet, das war schon immer so. Und was ist mit den Menschen, wenn die sich zu stark vermehren? Vielleicht schließen sich eines Tages die Tiere zusammen und rotten den Menschen aus, den größten Massenmörder aller Zeiten. Die Menschen beklagen sich, weil sie ihre Städte von Vögeln verunreinigt sehen. Bedauerlich. Sie sollten die Vögel fragen, was sie davon halten, dass die Menschen ihnen die Erdkugel zubetoniert haben. Wir haben Glück, Mansur. Wir sind Exilanten. Wir haben in Ägypten gelebt und in Vorderasien. Seit der jüngeren Steinzeit besiedeln wir nach und nach die ganze Welt und begleiten die Menschen auf ihren Handelswegen. Wir haben Glück, Mansur. Viele andere Tierarten sind ausgestorben. Aus der wilden Katze wurde die Hauskatze, das war unser Evolutionsschritt. Sie haben uns gebraucht, Mansur. Katzen fingen Ratten, sie brauchten uns auf ihren Schiffen, wir haben Ozeane und Meere mit ihnen überquert; schweigsame Eroberer auf weichen Pfoten. Ich erzähle Ihnen ein Märchen, Mansur, damit Sie besser einschlafen. Es war unser Gott, der die Welt erschaffen hat, als er freigebig und erfindungsreich mit der Erdkugel spielte. Mit der Tatze schob er sie wie ein Wollknäuel hin und her und erschuf Festland, Ozeane, Meere, Berge, Flüsse und Felsen, Niederungen und Wiesen, Seen und Wasserfälle, Blumen, Bäume und Menschen. Er schuf Katzen. Und dann kam ihm das Ganze zu perfekt vor. Deswegen machte er den Menschen. Die Götter gehören nicht zu den Menschen; Menschen interessieren Götter nicht. Wäre ich Gott und hätte die Menschenwelt erschaffen, wäre ich schon längst weggezogen.«
Mansurs Atem geht regelmäßig; Pommerantsch flüstert dem Schlafenden sein Geheimnis zu:
»Das Ganze ist ausschließlich meine Geschichte, Mansur, meine Mehrstimmigkeit. Und die nimmt mir keiner, verstehen Sie, keiner weg.«
Der Diplomat ist in Peking für Staatsdelegationen zuständig. Diese Stadt ist für ihn eine permanente Feuerprobe; den Beilstiel zimmern. Wenn er überlebt, öffnen die Stunden in Peking ihm die Tore zu ersehnten Posten in London, Paris oder Washington. Ausländische Botschaften wickeln ihre Bankgeschäfte bei der Bank of China ab; mitten in der riesigen Glashalle wächst ein Bambuswald. Die Bank ist geschlossen, und die Schritte des Diplomaten eilen entschlossen und skrupellos an den bewaffneten Wächtern vorbei. Für ihn ist die Bank geöffnet.
Das ist China.
Der Diplomat kratzt sich am Kopf. Auf Anweisung des Präsidenten, des Außenministers und des Botschafters seines Landes hat er alle unumerziehbaren Tschechen und unumerziehbaren Chinesen vom Körper der tschechischen Botschaft und von Mitgliedskörpern der offiziellen Delegationen fernzuhalten. In China verlaufen Gespräche freundschaftlich, in geselliger Druschba-Atmosphäre, und Dissidenten stehen doch außerhalb der Realität.
Der Diplomat hat ein Problem. Er muss das Wort unumerziehbar für sich definieren. Und Namen auf eine Liste setzen. Das Lied des Botschafters hallt nach, und die Worte dringen warnend in sein linkes Ohr: Beilstiel zimmern, Beilstiel zimmern, ist das Muster doch nicht fern. Václav Havel ist wie Gift in die chinesische Gesellschaft eingesickert; die chinesischen Dissidenten halten seinen Namen hoch wie eine Fahne, verkriechen sich mit dem tschechischen Kumpel in den Untergrund.
Der Botschafter wartet auf die Namensliste. Ihm liegt viel daran, in der Öffentlichkeit als nachsichtiger Mensch zu gelten. Er behandelt alle mit ostentativer Freundlichkeit. Damit jeder merkt, wie weitherzig, großzügig und gutmütig er ist; da läuft ihnen die Galle über. Am helllichten Mittag lümmelt er in malerisch ausgeleierter roter Jogginghose vor der Glotze. Er sieht sich seine deutsche Lieblingsserie an, die er auf dem vorherigen Posten ins Herz geschlossen hat. Nippt am vierten Bier. Erteilt dem Diplomaten Befehle. Der Diplomat steht aufrecht und achtet darauf, die Sicht auf den Fernseher nicht zu versperren. Wer wie er das Pech hat, Männern mit politischer Autorität zuhören zu müssen, der weiß, dass diese Leute ihr Gegenüber entwerten und das Denken fürchten. Nur ihre eigenen Klischees und Selbsttäuschungen finden sie gut.
»Vor allem halten Sie den unumerziehbaren Freund im Zaum. Er bringt Unruhe rein. Ich brauche Ruhe.«
»Wird erledigt.«
»Und dann auch noch diese Schriftstellerin. Wir geben einen Empfang für sie. Und Sie lassen sie nicht aus den Augen. Noch einen Floh im Tigerfell können wir nicht gebrauchen.«
»Verstehe.«
»Noch was. Meine Frau meint, im Garten schleicht eine fremde fette rote Katze herum. Mit einer schwarzen Krähe in der Schnauze. Schaffen Sie die weg.«
»Wird gemacht.«
Der Diplomat ist ratlos. Obwohl der Freund mancherorts anwesend ist, gehört er nirgendwo hin. Für viele Tschechen ist er eine innere Quelle der Hoffnung, unabhängig von den Prognosen gewisser Prognose-Institute und von wirtschaftsorientierten Staatspräsidenten. Er tut nicht so, als hätte man ihn mit Weisheitsbrei gefüttert. Aufmerksam betrachtet er die Welt um sich herum und achtet die Vergangenheit. Aus dem Guten wie aus dem Schlechten zieht er Lehren und gibt sein Wissen weiter.
»Gut und freundlich zu sein lohnt sich«, sagt der Freund zum Diplomaten. »Es ist nie vorgekommen, dass einer, der gegenüber anderen Menschen keine Toleranz zeigt, ihnen als Beispiel vorangehen kann.«
Der Diplomat sucht im gemeinsamen Zeitfeld vergeblich nach gemeinsamer Sprache. Der Freund bringt Konfuzius ins Spiel und sagt, der Meister habe häufig dieselben Fragen von verschiedenen Sprechern unterschiedlich beantwortet. Diese Methode hänge mit Konfuzius’ Überzeugung zusammen, Ausgangssituation und Motivation seien für die Antworten wichtiger als abstrakte Wahrheiten. Keine Frage sei dieselbe, selbst wenn sie so klinge. Deshalb müsse auch die Antwort nicht zwingend dieselbe, könne gar nicht dieselbe sein. Das Paradox der richtigen, aber widersprüchlichen Antworten zeige die Bedingungen, unter denen wir fragen.
»Das meinte übrigens Havel auch. Wahrheit ist nicht nur das, was wir denken, sondern auch, was wir unter bestimmten Bedingungen zu wem sagen«, provoziert der Freund den Diplomaten.
In der Botschaft spielt man Blinde Kuh. Der Freund lehnt die schwarze Binde über Augen und Ohren ab. Er hat noch gut in Erinnerung, über welch ausgezeichnete Diplomatie Österreich und Ungarn einst verfügten; Überbleibsel der K&K-Monarchie. Die Wiener Diplomatenakademie ist bis heute eine Eliteanstalt. Die mehrstufig vermittelte Bildung sowie Möglichkeiten der Beförderung werden transparent gehandhabt; es gibt immer jemanden, der stärker und schneller ist, wortmächtiger.
Heute zählen der Rang und die Menge der Körper, denen man übergeordnet ist; nicht die Leistung an sich. Dem ungarischen Präsidenten ist es gelungen, binnen weniger Jahre die ausgezeichnete Diplomatie zu zerstäuben. Auch im Prager Außenministerium existierte die ungeschriebene Regel: Ein Zugpferd, tüchtig und zuverlässig, bekommt manchmal als nette Aufmerksamkeit einen Auslandsposten, der sonst für Zuchtpferde reserviert war. Heute gibt es nur Zuchtpferde; loyal, mit undurchschaubarer politischer Deckung. Aber nicht mal das gilt noch. Verfügt ein Land nicht über eine klare Außenpolitik, spielt nur noch der Klientelismus eine Rolle.
Der Diplomat steckt in der Klemme. Der erste Versuch des Botschafters, dem Freund Angst einzujagen, ist fehlgeschlagen. Als wahrer Zögling der Stadt Moskau hatte der Boschafter die schöne Chinesin vom Empfang zur Besprechung eingeladen. Eine kluge Frau, die auf ihrer bescheidenen Stelle beharrt. Der Botschafter berät sich oft mit ihr unter vier Augen und zieht mit ihrer Hilfe die örtlichen, hinter den Kulissen agierenden Berater heran. Diese trafen den Freund im Teehaus Purpurrebe. Die örtlichen Kader sind geübte Fragensteller, und in ihrer sorgfältig gepflegten Akte Cyanopica cyana führen sie eine Liste der Unumerziehbaren. Sie unterschätzen niemanden, sie wissen gut, dass auch ein Tiger wegen eines unumerziehbaren Flohs in Rage geraten kann. Der Freund sagte ihnen, alle ihre Fragen würden von seinem bisherigen Leben beantwortet, auch die Frage, warum sich ein Mensch stets um verantwortungsvolles Handeln bemühen solle. Er wolle an seinem Leben nichts ändern.
Der Botschafter zimmert Beilstiele und findet nur schwer zu seiner gewohnten Sorglosigkeit zurück, zu dieser Pose eines aufrechten Kerls mit männlich direktem Blick. Nur mit Mühe setzt er sein Beamtenlächeln auf. Was will der Freund eigentlich? Er wird dem verfluchten Typen schon zeigen, wie unnötig Fragen und Antworten sind.
Jeder hat seine Schwachstelle.
Und jetzt an die Arbeit.
Die tschechische Staatsdelegation hat sich im Voraus verpflichtet, alles zu glauben, was das hiesige Regime behauptet. Vom Diplomaten bekommen die Delegationsmitglieder schwarze Binden ausgehändigt. Anstelle von Augen und Ohren sitzen Diamanten. Sie finden die hiesige Form von Blinde Kuh prima. Sie mögen auch die hiesige Form der Demokratie. Es finden demokratische Wahlen für die Ortsausschüsse statt.
Unter Aufsicht der Kommunistischen Partei.
In der Schule singen Kinder ein tschechisches Volkslied, verneigen sich und grüßen auf Tschechisch. Die aalglatten Politiker dieser Welt lächeln den Kindern zu; es interessiert sie nicht die Bohne, dass die Schule von der Partei zu diesem feierlichen Empfang verdonnert wurde. Die Kinder haben das Lied und die Begrüßungsworte in ihrer Freizeit bis zum Umfallen geübt. Drill, Müdigkeit, zitternde Stimmchen, zur Strafe mussten sie hungrig im Regen stehen. In der ersten Reihe stehen aufrechte, gleich große Kinderkörper; das strahlend weiße Lächeln, das sie im Gesicht tragen, verschwindet nie. Sie singen mit einer Stimme, wie ein einziger Körper.
Süße Kinder, sagen die aalglatten Politiker dieser Welt.
Die Spezialität der Chinesen ist ihre Höflichkeit. Beim Diskutieren weichen sie dem Kern des Problems aus. So vermeiden sie unangenehme Situationen. Wenn der tschechische und der chinesische Präsident miteinander diskutieren, sind beide die Höflichkeit selbst. Ihr Abendessen ist ein Fest der Freude und Fröhlichkeit. Sie traktieren sich gegenseitig mit Volksliedern aus gemeinsamen guten alten Zeiten.
Am schlimmsten sind nicht die Diktatoren. Am schlimmsten sind die aalglatten Politiker dieser Welt, Echolote ohne eigene Meinung, vorsichtige Amateure, die sich die lange Mauer entlanghangeln, intrigieren und manipulieren; wes’ Brot ich ess, des’ Lied ich sing. Sie ermöglichen den Brotgebern ein leichtes Leben und plappern rasch fremde Sprachen nach; Fremdsprachenkenntnisse haben nur bedingt mit Bildung zu tun.
Die Delegationen der aalglatten Politiker interessieren sich nur für Marktreformen und Wirtschaftsaufschwung. Die Gesellschaft der Luxuswaren zieht sie an. Das sozialistische Land der unbegrenzten Ungleichheiten.
Sie wissen längst nicht mehr, dass kommunistische Gesellschaften einst zur Bekämpfung der Ungleichheit aufriefen.
Pommerantsch beobachtet alles und alle, und er weiß, dass die heutigen Kommunisten Chinas die religiöse Kraft des Konfuzianismus für tot halten. Dafür werden mit aller Macht die konfuzianischen Werte verehrt. Um die Untergebenen ruhig zu halten, die das rasante Tempo der Änderungen erschreckt, der neue Materialismus, der Generationenabgrund. Als hätte man ganze Lebensetappen übersprungen. Weder im menschlichen noch im Leben eines Landes lässt sich eine Etappe überspringen; moderne Länder müssen der Spirale ihrer Absurdität bis zum Tiefpunkt folgen, damit sie den Blick wieder nach vorn richten können. Nichts lässt sich überspringen. Alles ist bedingt, alles knüpft ans Vorangegangene an, ohne einen zweiten Schritt kein dritter. Überspringen oder ausweichen gibt es nicht.
Sie machen sich die konfuzianische Moral zunutze. Autoritätshörigkeit und Familienzusammenhalt als Grundlage der moralischen Werte.
Beides dient als Begründung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Gehorsamkeit dem Herrscher gegenüber, ob er nun Kaiser heißt oder Kommunistische Partei.
Gehorsamkeit steckt dem Land in den Knochen.
Mehr als zweitausend Jahre wurde China durch Religion und Konfuzius’ Sittenlehre geformt.
Beides kann gerade deswegen gut missbraucht werden, weil Textinterpretationen keine Grenzen kennen.
Die chinesische Kommunistische Partei hält eisern an ihrem Prestige fest.
Lässt aber mit sich handeln.
Pommerantsch beobachtet alles und alle, und er weiß, dass die tschechische Delegation keine Leidenschaft für Geschichten über Philosophen und Kaiserfamilien hegt. Sie ist mehr an Geschichten über Krieger der Neuzeit interessiert. Deng Xiaoping finden sie faszinierend. Zhu Rongji, den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Shanghai, finden sie faszinierend, Wirtschaftsberater von Deng in den neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Bis Dezember 1978 hatte Deng Xiaoping ausreichend Macht gesammelt. Er brachte die Kommunistische Partei dazu, die sogenannten Vier Modernisierungen durchzuwinken. Darauf stützte er sein Reformprogramm und sah über die unglückbringende Zahl vier hinweg. Er merzte die marxistischen Wirtschaftsmaximen aus. Führte private Landwirtschaft ein. Drosselte die zentrale Wirtschaftsplanung. Taute das Einfrieren ausländischer Investitionen auf.
Die Abkehr von der marxistischen Wirtschaft war aus seiner Sicht ein kleiner Preis für den Machterhalt der Kommunistischen Partei.
Für den ewigen Machterhalt.
Heute ist das Volk der Kommunistischen Partei dankbar. Sie hat die kapitalistische Wirtschaft ermöglicht.
Deng Xiaoping führte 1978 Wirtschaftsreformen und erste Wirtschaftszonen ein.
Deng Xiaoping unterdrückte 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Opposition. Auf seine persönliche Anordnung hin wurde der Protest junger Körper von Panzern zermalmt.
Pommerantsch möchte der Welt mitteilen, dass die chinesische Prosperität einen einzigen Sinn hat: die Demokratie zu umgehen.
Nicht, sie zu unterstützen.
Die Reformen sind dazu da, den Kommunismus am Leben zu erhalten. Sie richten sich gegen die Demokratie.
Keiner der nach Peking gereisten Politiker oder Diplomaten erwähnt die Arbeitslager, Laogais. Täten sie es, würden alle Chinesen wie ein Mann wortlos den Raum verlassen. Und mit ihnen die Hoffnung auf Investitionen in Millionenhöhe. Keiner der europäischen Diplomaten reißt sich heute wegen eines Inhaftierten ein Bein aus. Noch seltsamer: Auch in Tschechien reißt sich niemand wegen eines Inhaftierten ein Bein aus. Nicht einmal nachdem einst in den westlichen Medien sofort über jeden Inhaftierten des tschechoslowakischen Kommunismus berichtet wurde und westdeutsche Schriftsteller wie Heinrich Böll und Günter Grass konkrete Hilfe organisierten und das Land bereisten. Aber auch die heutigen Medien berichten weder von Toten noch von Inhaftierten des chinesischen Kommunismus. Blindheit steckt in den Knochen von Tschechien. Die anderen müssen uns helfen, wir ihnen nicht.
Dafür sind die Chinesen gut darin, Unmut zu äußern.
Keiner der angereisten Politiker und Diplomaten wagt zu erwähnen, dass Verträge einzuhalten und Urheberrechte zu schützen sind. Erst recht nicht wagt es einer, das Regierungssystem zu kritisieren.
Osteuropäische Diplomaten meinen, es gehe sie nichts an, pssst. Sie meinen, es sei unhöflich, den Gastgeber zu beleidigen, pssst. Sie seien froh, wenn sie das ausgeworfene Lasso fangen, pssst; alle tragen sie die diamantenbesetzte schwarze Binde über Augen und Ohren, ihnen seien die Hände gebunden, pssst.
Nicht einmal aus Protest gegen den Tod des Schriftstellers Liu Xiaobo, des Nobelpreisträgers, verlassen die aalglatten Politiker dieser Welt ihre Delegationen; Geschäft ist Geschäft. Sie machen sich lustig und zitieren Kafka, den sie nicht gelesen haben: Das Böse weiß vom Guten, aber das Gute vom Bösen nicht. Sie sind nach China gefahren, um das Böse kennenzulernen, und halten sich für das Gute.
Im Blinde-Kuh-Spiel gelten strenge Regeln. Ein Blatt vor den Mund nehmen. Einen Kotau vor der Wirtschaft machen. Verstöße gegen die Menschenrechte vergessen. Verneige dich und berühre den Boden mit der Stirn.
Die Chinesen nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie geben ungern nach. Und wenn sie schon nachgeben müssen, ziehen sie ihre Gegenspieler mit ins Problem hinein. Alle Vertreter der Demokratischen Partei, die sich in Opposition zur Kommunistischen Partei gebildet hatte, wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Ein tschechischer Politiker fasst sich ein Herz und spricht informell seinen chinesischen Partner an. Sie stehen am Fenster mit Ausblick auf den Platz des Himmlischen Friedens. Der tschechische Politiker räuspert sich, die Faust vor dem Mund; er spricht unhörbar in seine Faust. Leise fragt er nach der Dissidentin, die unter Hausarrest gehalten werde und wohl stilisierte Puppen fotografiere; sie hatte eine Ausstellung in Prag. Peinlicherweise kann er sich an ihren Namen nicht erinnern, weil ihn dieses törichte Weib in Wirklichkeit gar nicht interessiert. Der Dolmetscher dolmetscht und schwitzt.
»Sie meinen Liu Xia. Die Frau von Liu Xiaobo«, sagt der chinesische Außenminister mit eiserner Ruhe.
»Ja.«
»Wir sehen, was sich machen lässt.«
Der chinesische Politiker lächelt, nickt höflich, bedankt sich. Der tschechische Politiker lächelt, nickt höflich, bedankt sich. Uff, geschafft. Er ist stolz auf sich. Gesellt sich wieder zu dem Unternehmergrüppchen.
Vor dem Abflug nach Hause sollen die Delegationsteilnehmer die diamantenbesetzten schwarzen Binden abgeben. Die meisten behalten sie als ein Requisit für die Kunst des Herrschens.
Zu Hause bei der Pressekonferenz erzählt der tschechische Politiker den Journalisten, die sich nicht dafür interessieren, der mutige tschechische Löwe habe in China für das Einhalten der Menschenrechte gebrüllt. Aber den Löwen, den das Land im Wappen trägt, gibt es in tschechischen Gefilden nicht. Er ist ein Zugereister. Gut integriert. Die schwarzen Krähen von Peking waren überrascht, dass das Land im Staatswappen einen Löwen führt. Sie dachten, es sei ein Maulwurf.
Die Schriftstellerin steigt in der für sie schicksalhaften Stadt Zürich um. In der Schnellbahn zum Flughafen meint sie Glockengebimmel von Schweizer Kühen und Geblöke von Alpenschafen zu hören; Fast Food für Reisende. Sie ist auf dem Weg zum Freund nach Peking und hat vor ein paar Stunden ihr Land verlassen, wo die Menschen die Situation immer unter Kontrolle haben; sie entscheiden nichts, mischen sich nirgendwo ein, sie kommentieren das Weltgeschehen bloß.
Die Schriftstellerin lässt das Volk der Besserwisser zurück. Im Gepäck gefährliche Ware; sich selbst.
Der Flugzeugflügel blitzt in der Sonne und schießt durch die Wolkenwatte. Die Schriftstellerin isst sich hungrig durch die ganze abenteuerliche Speisekarte, die als SWISS Economy Menu angeboten wird. Frühstück: Kontinentales Frühstück mit Aufschnitt und Käse, Croissant, Brötchen, Butter, Konfitüre, Joghurt mit saisonalen Früchten.
Mittagessen: Vorspeise: Pfeffermakrele, Mais-Favabohnen-Salat. Hauptgang: Rindsragout mit grobkörniger Senfsauce, Bratkartoffeln, Brokkoli, Karotten. Oder frittierter Mapo-Tofu mit Sauce, Reis, gebratenes Gemüse. Dessert: Erdbeermousse.
Das Flugzeug als Sanatorium. Statt mit Wecker und Wassereimer zu scheppern, machen die Krankenschwestern Licht an; statt Thermometer werfen die Stewardessen den Reisenden heiße Waschlappen in den Schoß.
Die Europäer waschen sich die Hände.
Die Chinesen wischen sich das Gesicht.
Die Stewardessen stellen die Patientenkopfstützen aufrecht; das Frühstück kommt. Die Dämmerung flieht einen Meter über der Sandwüste, und in der Ferne brennen die Feuer der Farmen der chinesisch-tschechischen Freundschaft. Wolken rotten sich wie Eisschollen um das vorbeischwimmende Schiff zusammen.
Die Patienten haben das Miteinander satt. Sie schnauzen sich an, schnappen direkt vor den Augen des anderen nach der fremden Decke und streiten es ab. Der Mittelgang wird beherrscht von chinesischer Großmutter, Mutter und Enkeltochter; so schön, so grausam, so reich und laut und ohne jegliche Rücksicht auf die Schläfer um sie herum. Die flugzeugtypische Mittelgangmentalität; Familienverpflegung und Verhätschelung des Einzelkindes; wie es wohl in der Familie dieser Enkelin aussieht? Der Schlag in den Nacken deutet an: Egoismus, Aggression, spitze Ellenbogen. Die Chinesin neben der Schriftstellerin studiert in Montreal. Sie ist neunzehn Jahre alt und besucht nach einem Jahr ihre Eltern.
7980 Kilometer Distanz bis zum Reiseziel.
Nach der Landung fühlen sich alle Tschechen bemüßigt, irgendwo anzurufen; sie müssen unbedingt jemandem mitteilen, dass sie in der Welt angekommen sind. Kaum steht das Flugzeug, springen sie auf und drängeln als Erste in den Gang.
Selten gelingt es bei null anzufangen, noch dazu mit schneeweißer Seele. Man müsste die Widerhaken vergessen, mit denen sich die Familie in einem festkrallt; Heimat, Muttersprache und ehemalige Gefährten, die ihren Opfern nie verzeihen werden.
Noch 983 Kilometer bis zum Ziel. Eine Stunde Flug, weißer Saum am runden Horizont und die Stadt Peking kurz nach fünf Uhr morgens; in Zürich ist das Flugzeug um 13.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet.
Der Körper gerät in eine atmosphärische Mischung aus sowjetischem Stalinismus der fünfziger Jahre, amerikanischer Konsumgier der dreißiger Jahre und modernen Autobahnen, Wolkenkratzern, Hotels und Computern und zeitgenössischer Popkultur. China weiß nicht, dass es auch anders ginge. Ist der rücksichtsvolle Umgang also anerzogen? Das hieße: Hoffnung. Nach all den großmäuligen Experimenten des zwanzigsten Jahrhunderts ist es kein Wunder, wenn die Menschheit seelisch ausgebrannt ist; von verordneter Blindheit erwischt benötigen auch Stalins posthume Kinder die Kurortpflege europäischer Städte und örtlicher Gemeinschaften.
China ist ein vager, nicht mitteilbarer Traum. Das Zerreißende an der Atmosphäre liegt darin, dass man zwar frei unternehmerisch tätig sein kann, aber nicht frei sprechen oder gar schreiben darf; nicht einmal über die eigene Ohnmacht.
China ist die Karikatur einer verzweifelten Gesellschaft, die aus der Haft entlassen wurde und mit dem psychischen Schaden nicht fertig wird.
Das Land befindet sich nervlich in keinem guten Zustand.
Tschechien befindet sich nervlich in keinem guten Zustand.
In China muss man nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch zwischen den Leben lesen können.
Das geheimnisvolle Regime der Geheimdienste ist so blütenweiß wie der stalinistische Schnee. Die Wirtschaft wird von einer starken Armee gestützt. Immobilien kaufen oder Geld auf die hohe Kante legen, das tun die Chinesen im Ausland; nur dort ist ihr Privatbesitz sicher. Zu Hause sind sie dem Staat ausgeliefert; vielleicht nimmt er ihnen das Geld weg, konfisziert das Haus. Ihre Kinder schicken sie ins Ausland; so können sie auf doppelte Staatsbürgerschaft hoffen. Offiziell dürfen sie zwar nur die chinesische haben, das wird aber nicht kontrolliert.
Sie träumen davon, eine Supermacht zu werden. Wirtschaftliche Erfolge sind ihnen nicht genug, sie rüsten auf, und mit der Armee fahren sie auf Kuschelkurs. Ähnlich wie Hitlers Deutschland schüren sie Konflikte in den Grenzgebieten und liefern sich dort Scharmützel, um später freundlich erklären zu können, dass sie aufrüsten und zur Verteidigung aufrufen mussten. Alle Reden, die die Schriftstellerin in China gehört hat, sind kommunistisch, das Vokabular gleicht dem ihrer Kindheit.
Es ist eine geheime Gesellschaft, und kaum einer dringt bis zu ihrem Kern durch. Dazu noch das virtuelle und das reale Leben. Die beiden auseinanderzuhalten fällt nicht leicht. Hirngewaschene xenophobe Gesellschaften reagieren überall auf der Welt gleich: Sie hassen alles, was anders ist. Berge zu versetzen und den Lauf der Flüsse zu ändern ist kinderleicht, den Charakter der Menschen zu ändern aber schwer.
Der erste tschechische Sinologe, der Jesuit, Missionar, und Mathematiker Karel Slavíček, geboren 1678 und in Peking begraben, brauchte für seine Schiffsreise nach China ganze sechs Monate. Seit dem achtzehnten Jahrhundert waren am Kaiserhof der Qing-Dynastie Jesuiten als Berater tätig. Aus Interesse an fernöstlicher Kultur sammelten sie chinesische Sprichwörter, übersetzten sie in europäische Sprachen und versuchten die Chinesen zum Christentum zu bekehren.
Der Körper ist auf einem anderen Planeten gelandet und betritt den sterilen Raum des verglasten, desinfizierten Flughafens. Samt Gedanken wird er ins Areal der Fließbänder transportiert, wo das Gepäck wartet. Die Koffer werden von den Kulis illegaler Taxifahrer angequatscht; sie schreien, und die Silben verspreizen sich in ihren Körpern. Mit Schleim vermischt spucken sie sie aus. Der Mensch begibt sich an einen vertrauten Ort und weiß doch nicht, wo er landet.
»Also, ich bin jetzt da«, teilt in der Ankunftshalle die Schriftstellerin dem Freund am Telefon unpathetisch mit.
»Um den offiziellen Reisebericht vorzustellen?«
»Auch.«
»Ich wurde nicht eingeladen.«
»Hast du etwas anderes erwartet?«
Das Pathos der gelben Katzenaugen ist ihr zuwider, daher behält sie für sich, wie mysteriös sie die Art findet, wie das menschliche Gehirn, also auch seins oder ihrs, arbeitet, dieses Organ, das sowohl Poesie zustande gebracht hat und die Ode an die Freude oder die Deklaration der Menschenrechte als auch nazistische Konzentrationslager, den bolschewistischen Gulag, den Toaster und das Automobil. Nachts, wenn sie nicht schlafen kann, spinnt sie ganze Pommerantschphantasien darüber.
In Prag schläft sie nicht.
Die Pekinger U-Bahn ist steril, sauber und für die Olympiade gebaut worden. In jedem Waggon ein Bildschirm mit laufender Telenovela; beherzte Chinesen massakrieren hinterhältige Japaner und schneiden ihnen reihenweise die Kehle durch; einfache Muster des äußeren Kollektivfeindes und Ammenmärchen für Erwachsene. Die Schriftstellerin verlässt die unterirdischen Gänge und raucht. Wartet auf den Freund mit den Schmetterlingswimpern. Es dämmert, und die Augen der hohen Wolkenkratzer blinzeln in die scheidende Nacht; von Taschenlampen in die Dunkelheit gemorste Rettungssignale. Die lange Chinesische Mauer ist eine Projektionsfläche, die der Schriftstellerin und dem Freund die heutige Welt zeigt. In Peking wohnen sie einem Film über ihr europäisches Zuhause bei.
Der Freund taucht auf.
»Ich dachte, du schreibst ein Buch über das, was hier geschieht.«
»Ich weiß es noch nicht. Aber wenn ich ein Buch schreibe, dann, damit sich nicht alles wiederholt. Und es ist fast sicher, dass alles nochmals geschieht, also sollte ich es schreiben.«
»Schreib eine Komödie! Aber mir ist immer noch nicht klar, warum du eigentlich gekommen bist«, spricht der Freund in die dichte Smogluft vor ihm und legt sich ein weißes Tuch vor den Mund; Knebel und Sauerstoffmaske.
»Ich bin hier, weil man in Tschechien nicht mehr weiß, dass der Maulwurf blind ist.« Der Mund der Schriftstellerin schreit in den zarten Rücken. »Ich zerre an den Ketten, die mich an meine Sprache, mein Geschlecht, mein Land und meine Zeit fesseln. Und ich liebe die Kalligraphie. Du hast mich zum Anwalt mitgenommen. In Prag habe ich die Wanderausstellung der Frau des Nobelpreisträgers gesehen. Ich kann nur hier begreifen, was mit der Welt los ist.«
Die Schriftstellerin holt aus ihrem kleinen schwarzen Rucksack ein Foto der zierlichen Frau mit Kopftuch. Der Freund wirft einen nicht gleichgültigen Blick auf das Bild und zuckt mit den Schultern.
»Sollte dich jemand in der Botschaft fragen: Du und ich, wir haben nichts miteinander zu tun.«
Als wüssten der Smog und die schwarzen Krähen nicht längst über jeden ihrer Atemzüge Bescheid.
Ein Empfang, einer aus der unendlichen Serie von Partys, Premieren, Vernissagen, kalten Buffets, Gartenfesten; Gelächter, Gläserklirren, Stimmen fremder Menschen, die Havel’sche Ptydepe-Sprache. Was sich doch alles hinter Routine und Ritual verbirgt.
»Noch ein Gläschen?«
»Sind Sie zum ersten Mal in China?«
»Wie war der Flug?«
»Wie finden Sie China?«
Der tschechische und der chinesische Verleger haben gemeinsam mit dem Übersetzer eine Lesereihe überall im Staub der Welt organisiert; etwas anderes als kurze Reiseberichte und Kochbücher wollen sie nicht mehr veröffentlichen. Sie verteilen Exemplare und halten Reden, auch in Botschaften; sehen und gesehen werden, ein Lob auf besiegte Aristokraten und herrschende Geschlechter, und im Buch der Lieder heißt es:
Dort ist kein Hass,
hier kein Überdruss.
Tagein, tagaus
alles des Lobes voll …
Noch nie hat sich ein Herrscher anders als auf diesem Weg überall unter dem Himmel einen Namen gemacht.
Alle männlichen Gäste unter siebzig scheinen quietschfidel und jung zu sein und unablässig Golf zu spielen. Unverhüllt gieren sie nach einem Gespräch. Als könnte die Schriftstellerin ihnen Absolution erteilen. Als wüsste nur sie, was zu tun ist. Nach der offiziellen Begrüßung wird sie vom Programmierer gepackt und vollgeplappert; das überbevölkerte China habe immer noch keine Fußballmannschaft von Weltniveau, das sei eine Schande, aber Tschechien könnte doch eine zusammenstellen und trainieren. Zwischen den beiden Ländern herrsche ja Tauwetter, die Fluglinie Prag–Peking stehe in den Startlöchern, der Flug werde neun Stunden dauern. Und auch sonst könnte Tschechien helfen, einen weiteren Schandfleck zu beseitigen. China habe noch keine weltbekannte Automarke, das Land brauche eine neue Strategie in der Öffentlichkeitsarbeit, um den Durchbruch in der Welt zu schaffen.
»Die werden’s schon packen, das mag ich an China nämlich. Sie kaufen die besten Spieler der Welt ein, die chinesische Superliga läuft nach probatem Fünfjahresplan. Ihr strategisches Ziel, das globale strategische Ziel also, ist, zwanzig weltbeste Spieler einzukaufen. Das kriegen die mühelos hin, in der chinesischen Liga gibt es schon über einhundertfünfzig Brasilianer, sie kaufen auch die besten Trainer ein. Alles ist nur ein Geschäft, auch der Sport.«
»Warum?«
»Wie?«
»Warum?«
»Warum was?«
»Warum ist alles nur ein Geschäft?«
»Der Fußball gibt dem Land das Etikett. So wird es in der Welt gesehen.«
»Das Etikett?«
Der Programmierer arbeitet im mittleren Management. Mit seinem Geplapper sondiert er vorsichtig vermintes Terrain. Für berühmte Menschen hegt er eine seltsam irrationale, mit Abscheu gepaarte Bewunderung. Er pinnt die Schriftstellerin an die Wand. Spuckt ihr seine Privatgeschichte ins Gesicht, für sie keine erzählenswerte Geschichte. Er zerschlägt die Wörter; sie schluckt die Scherben. Er zerschlägt Wörter in der Gegenwart und befördert sie durch sein Erzählen direkt in den Mülleimer der Schriftstellerin.
Schon während des Studiums, ja, in den goldenen Neunzigern, habe er sich selbstständig gemacht und eine Firma gegründet, zusammen mit zwei Kommilitonen und mit Hilfe seines Vaters im Hintergrund und dessen zahlreicher Kontakte. Die beiden anderen wollten nicht auf seinen Vater hören, also hätten sie sich alle zerstritten. Dann hat er woanders als Angestellter angefangen. Und war wieder genervt. Diesmal, weil die Leistung keine Rolle spielte. Sondern Kontakte. Trotzdem ist er Idealist geblieben, Perfektionist. Natürlich hat er hohe Ansprüche an sich selbst, selbstverständlich. Manchmal kommt es ihm so vor, als würden seine Kräfte seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. In der Firma wurde am Lohn, an der Technik, an Reparaturen und am Kaffee gespart. Also hat er auch diese Firma verlassen. Da war er schon verheiratet. Und hat ein Kind. Olivie. Noch vor der Hochzeit sind sie in Prag in eine Plattenbauwohnung gezogen. Zweimal in der Woche haben sie Freunde getroffen, zum Spielen, Canasta, Rommé und Tennis. Einmal in der Woche Volleyball.
Die Gelegenheit, nach China zu gehen, fand er prima, war sofort Feuer und Flamme. Nur seine Frau hat gezögert. Er hat zu ihr gesagt, sie soll das Geldverdienen ihm überlassen. Er war über vierzig. Und wild entschlossen. Er brauchte Veränderung. Sie haben die engen Räume im Plattenbau verlassen, mit einer Hypothek ein Haus gekauft und es im Handumdrehen für gutes Geld vermietet. Sie haben jedes Pro und Contra geprüft; es ist nicht einfach, in einem so fernen Land eine Stelle anzunehmen, es ist nicht einfach, zu einem derart langen Marsch aufzubrechen. Die Frau war immer noch unschlüssig, sie wusste nicht, ob Olivie von der Schule genommen, von ihren Freunden getrennt werden sollte. Dem Programmierer ist ihr Zögern auf die Nerven gegangen.
Der Schriftstellerin geht sein egomanisches Erzählen auf die Nerven, und im Raum flattern Phrasen herum.
»Sind sie zum ersten Mal in China?«
»Wie war Ihr Flug?«
»Wie finden Sie China?«
In den ersten Monaten hat Olivie ständig geklagt. Bauchschmerzen. Kopfschmerzen. Abends hat sie nur noch geheult. Schon immer hatte sie alles zu ernst genommen, schon als Kind konnte sie nicht lachen. Und jetzt mitten in Heulattacken hat sie sich beschwert, dass sie in der Schule nichts versteht und wegen ihres Akzents ausgelacht wird. Aber sonst ist es nicht schlimm.
»Ende gut, alles gut?« Die Schriftstellerin versucht einer Geschichte zu entkommen, die sie längst zu kennen meint.
Ja, ja, natürlich, am Ende ist alles gut ausgegangen. Die Frau des Programmierers hat sich um den Haushalt gekümmert und zu Hause auf ihren Mann gewartet. Er war begeistert. Zumindest anfangs. Hat seinen Eltern Fotos von der neuen Wohnung geschickt, von der Terrasse mit Aussicht über die Stadt, von den Marmorfußböden und von seinen Autos, er hat ihnen Videos von seinen Erkundungsreisen geschickt und in jeden Gruß die Formel gestreut, hier ist alles so wundersam. Nach einem Jahr aber ist das altbekannte unzufriedene Gefühl wieder da. Tagein, tagaus sitzt ihm die Frage im Nacken, ob das schon alles war, ob es jetzt für immer so bleibt. Seine Frau will nicht mehr zu Hause hocken und hat bei einer Pharmafirma angefangen. Ein großer Sprung für sie, bisher kannte sie nur die Arbeit in der Apotheke in ihrer Plattenbausiedlung. Aber nun hat sie Dimensionen von Luxus entdeckt, nach denen es sie, ähnlich wie die meisten Chinesen, nicht einmal im Traum verlangt hätte.
»Ende gut, alles gut, richtig?«
Das Geplapper hängt der Schriftstellerin zum Hals heraus, und sie möchte den langweiligen Tentakeln entkommen. Plötzlich fasst der Programmierer sie am Ellenbogen und flüstert ihr vertraulich seine süßen Geheimnisse ins linke Ohr. Auf der Arbeit stagniert er. Junge Menschen rücken nach. Völlig unbeschwert, ganz ohne Gepäck. Sie drängeln nach vorn. Ihre Rücksichtslosigkeit, die sie nicht einmal als solche verstehen, findet er schockierend. Sie sind so bestimmt, und so … so primitiv. Ein chinesischer Kollege, sein Spitzname ist der Verlobte, der Programmierer könnte glatt sein Vater sein, der sitzt ihm manchmal im Büro genau gegenüber. Ohne was zu sagen hockt der einfach da. Erledigt etwas auf seinem Mobiltelefon oder im Notebook, und dann starrt er dem Programmierer direkt ins Gesicht, als wollte er ihn hypnotisieren; eine halbe Stunde hält er mit offenen Augen ein Nickerchen. Der Programmierer hat schweißnasse Hände. Der Verlobte wacht auf, gähnt, steht auf und verlässt wortlos den Raum. Ohne ein einziges Wort zu sagen. Kann die Schriftstellerin das verstehen?
»Das muss doch gar nichts bedeuten.« Die Schriftstellerin räuspert sich verstimmt. Bis jetzt fand sie an seiner Geschichte höchstens die Gegenwärtigkeit spannend. Für den Programmierer scheint sich sein Leben ausschließlich im Jetzt abzuspielen. Vergangenheit gibt es für ihn nicht, und Zukunft findet keine statt. Er schleppt die gesamten Emotionen seit Jahren mit sich und stellt nun feierlich seinen Dreckwäschekorb ihr vor die Füße, um so sein bisheriges, ihm überdrüssig gewordenes Leben abzuschließen. Nur der Verlobte, der bleibt ihm unklar. Einmal, als sich der Programmierer über Kopfschmerzen beschwert hat, zückte der Verlobte ein goldenes Ölfläschchen aus der Brusttasche, Gold Medal Medicated Oil. Er tropfte vier dickflüssige Tropfen auf seine Zeigefingerkuppe und schmierte sie dem Programmierer auf die heißen Schläfen. Er sagte, keine Sorge, das Fläschchen hätte er von seiner Braut, der jungen Chinesin. Medizinstudentin an der Pekinger Universität. Ihre Großmutter würde noch traditionelle chinesische Medizin betreiben. Er hat ihm das Öl mitgegeben.
Angeekelt hat der Programmierer auf der Toilette versucht, den Ölfilm mit einem Feuchttuch von seinen Schläfen zu reiben. Unterwegs nach Hause hat er das goldene Fläschchen aus dem Auto gepfeffert und im Schlafzimmer eine rosa Pille hinuntergeschluckt. Er glaubt dem hiesigen Ekelzeug nicht. Später hat es noch eine schlimmere Geschichte mit dem Verlobten gegeben, die macht ihm richtig Angst.
»Ach ja?«
Der Programmierer hätte sich eine interessiertere Reaktion gewünscht. Das weiß die Schriftstellerin genau, aber sie möchte sich lösen und gehen. Der Programmierer hat ihr den Fluchtweg abgeschnitten. Also, einmal wurde der Verlobte nach dem Mittagessen von fiesen Bauchschmerzen gepackt, Schweiß lief ihm in Strömen über das verzerrte Gesicht. Es sah nach Blinddarmentzündung oder Nierenkolik aus. Der Programmierer hat vorgeschlagen, ihn zum Arzt zu bringen oder einen Krankenwagen zu rufen. Bei den Worten Krankenhaus und Krankenwagen hat der Verlobte laut auf Chinesisch gebrüllt, da muss sein Körper das Englisch vergessen haben. Das verzweifelte Gebrüll schoss bis zur Decke, füllte das Büro. Aus anderen Büroräumen und Abteilungen kamen chinesische und europäische Kollegen angerannt. Es sah aus wie ein gewaltiger Streit. Der Verlobte lehnte einen Krankenwagen ab, deutete mit dem Finger auf den Programmierer, und seine Stimme rasselte mit chinesischem Kriegswerkzeug. Der Programmierer blieb allein im Raum zurück. Als hätte er etwas ganz Schlimmes und Unverzeihliches getan. Keiner hat ihn aufgeklärt. Wenn er seine Stelle behalten möchte, muss er sich wohl entschuldigen. Aber wofür?
»Ende gut, alles gut?«
Am nächsten Tag haben sie im gleichen Raum gesessen, als wäre nichts passiert. Der Verlobte hat Tee getrunken und Nudeln mit Pilzen gegessen. Die bringt er immer von zu Hause mit. Mit dem Programmierer hat er nicht gesprochen. Er kommuniziert nicht mehr mit ihm. Seine Nichtkommunikation ist allumfassend und spielt sich auf drei Ebenen ab: keine Worte, keine Gesten und keine Mimik. So wird der Programmierer nicht über Vorgänge informiert, die mit seiner Arbeit zu tun haben. Außerdem hat ihn der Verlobte auf der Karriereleiter übersprungen und ist sein Vorgesetzter geworden.
Die Schriftstellerin stellt ihr leeres Glas ab. Mit einer Haarklammer steckt sie eine frei gewordene rote Locke fest. Sie strahlt melancholische Verschmitztheit aus. Ein Kellner kommt mit vollem Tablett vorbei. Ihr Arm schießt hoch wie eine Schlange; gierig ergreift sie ein neues Sektglas. Nachdem der Programmierer seine Wörter verpulvert, der Schriftstellerin das Ohr abgekaut hat, ist er sichtbar ruhiger geworden. Am liebsten würde er sie an sich drücken, umarmen. Am liebsten wäre er mit ihr allein, würde ihr in den Ausschnitt greifen, an die Pussy gehen.
Das kommt für die Schriftstellerin nicht überraschend. Sie könnte ihn mit einem heftigen Gefühlsausbruch verjagen. Selbstsichere Männer haben die Größe, auch in der Öffentlichkeit zu ihrem Verzaubertsein zu stehen. Sie sind so leidenschaftlich wie ungewöhnlich, werfen Schicksal und Glück in die Waagschale. Gewöhnliche Männer hingegen geben ihr Interesse an einer Frau nicht zu; gewinnt die Frau zu schnell Macht über sie, bekommen diese Männer es mit der Angst zu tun. Die Schriftstellerin möchte dem Programmierer sagen, dass es eines Tages ans Sterben geht. Bald schon ans Altwerden. Er soll sich die Zeit, die ihm zur Verfügung steht, nicht kaputtmachen. Sie kenne viele Greise, die keine Angst hatten vor einer Liebesbeziehung mit einer viel jüngeren Frau, aber es laufe doch immer auf dasselbe hinaus. Der andere Körper dient als Droge, um die Zeit zu vergessen. Sie selbst aber interessiere sich nicht für deutlich jüngere Männer. Die bräuchten noch Zeit bis zum Erwachsenwerden, der Abstand zu Gymnasiasten sei noch nicht groß genug. Auch dem Programmierer gehe es doch nur ums Vergessen. Lediglich dazu brauche er ihren Busen. Da gebe es ein lustiges Gedicht von Yeats über einen alten Wüstling.
Sie lindert seine Unruhe lieber mit Sprüchen; ja, die junge Generation würde immer die ältere überrollen. Das sei doch überall das Gleiche, wirklich, auch in der Literatur. Nein, Unsinn, unter den Autoren sei es sogar noch schlimmer. Die würden auf eigene Kosten Belege elementarster Dummheit veröffentlichen, als reichte es aus, einen Satz übers Kochen und Kräuterzüchten zusammenzustellen, um sich über den grünen Klee zu loben. Manchmal würde sie, die Schriftstellerin, vor Peinlichkeit am liebsten im Boden versinken, so sehr schäme sie sich angesichts der verkrüppelten Sprache. Die Ärmste, die Sprache – sie huste Blut, humpele und versuche vergeblich, die gebrochenen Knochen ihrer Silben zu heilen. Andere Kollegen würden sich gleich der Selbstzensur unterwerfen, nur damit ihre Bücher auch in China erscheinen können. Dabei sei es so, dass die bereits vorzensierten Texte ohne Wissen der Autoren von den chinesischen Herausgebern noch einmal zensiert würden, wie es zum Beispiel bei den Memoiren von Hillary Clinton der Fall war.
»Hillary Clinton kennen Sie, oder?«
»Ja, natürlich«, der Programmierer bebt.
»Ihre Memoiren wurden hier, ohne dass sie davon wusste, in kastrierter Form veröffentlicht. Sie wollte die ganze Auflage zurückziehen. Aber so viel Macht hat sie hier nicht. Seien Sie nicht besorgt wegen dieses Verlobten, die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit zählt hier zu den Schlüsselkategorien. Uns bleibt das ein Rätsel, so wie unsere Pflege des Individuums denen ein Rätsel bleibt. Was ich an diesem Land so überaus spannend finde, ist die Rückkehr zum Konfuzianismus. Für Konfuzius’ ethisches Gesamtwerk ist die Kategorie der Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit, also die Persönlichkeitsbildung, wirklich ausschlaggebend. Sie besteht aus innerer Arbeit am eigenen Geist. Daraus vollzieht sich die Vollendung des Geistes.«
»Wie sollte so eine Vollendung des Geistes aussehen?«
»Meinen Sie, Ihres Geistes?«
»Vielleicht.«
»Da muss ich passen. Vermutlich so ähnlich wie die Vollendung jeder Geisteshaltung. Was man hier Persönlichkeitsbildung nennt, hat mit der rechten Ausrichtung des eigenen Geistes zu tun, sagt Konfuzius im Großen Lernen. Ist aber eine Persönlichkeit für Zorn und Hass oder Angst und Bange anfällig, fängt sie rasch Feuer für andere oder gibt sich leicht Verzweiflung und Enttäuschung hin, dann lässt sich nur schwer etwas ausrichten.«
Was kann sie ihm noch sagen. Seine Frage zielte ohnehin nicht auf das bessere Verständnis seiner selbst, lieber lügt er sich in die eigene Tasche. Er will nicht einmal wissen, wie sich die Schriftstellerin fühlt, woran sie denkt, welchen Eindruck er auf sie macht. Dementsprechend kann er über ihre Gedanken nur frei phantasieren. Seine Vorstellungen aber verfestigen ihr feindliches Bild; er überprüft es nicht, hält eisern daran fest. Wovor hat der Programmierer eigentlich Angst? Fürchtet er, die Schriftstellerin könnte ihm von ihrer Angst erzählen und ihn damit anstecken? Wie seltsam, dass Männer keinen blassen Schimmer vom weiblichen Denken haben. Sie stellen keine Fragen; dazu braucht es Mut und Intelligenz. Von diesem Mann kann sie keine Wahrheit erwarten. Eine Frau, die mit ihm ein echtes Gespräch anfängt, macht er lieber klein; stempelt sie als Tratschtante ab. Ursache zwischengeschlechtlicher Neurosen. Männer müssen anfangen, Frauen Fragen zu stellen. Man muss bei null loslegen.
»Die Vollendung des Geistes bedeutet nicht Gleichgültigkeit des Geistes.«
Seine Probleme sind aus ihrer Sicht keine Probleme. Er hat sich doch von seiner Midlife-Crisis erwischen lassen. Wenn man das Leben wirklich satt hat, dann entkommt man ihm nur durch einen Selbstmord. Er aber wollte hier einfach ordentlich reich werden. In den Augen Europas und der ganzen Welt sind die Reichtümer Chinas wie der himmlische Engelsatem selbst. Alles hier ist so weitläufig, so riesig, das nötigt dem Menschen tiefsten Respekt ab. China ist ein Paradies, keine Gesellschaft der Welt kann es mit China aufnehmen. Aber in China ist nichts groß genug. Der Maßstab ist ein anderer. Und es gibt ein anderes Ausmaß an Unruhe. »Zehn« bedeutet »viel«. So wie »hundert« viel bedeutet. Fünf Geschmacksrichtungen, zehn Jahre, hundert Familien, tausend li, zehntausend zhang.
Die Schriftstellerin schweigt. Und schweigt.
Als litte sie unter Makropsie. Eine Sehstörung, die das Gesehene vergrößert.
Pommerantsch sitzt auf einem Baum im Botschaftsgarten. Er findet es nicht gut, dass seine Schriftstellerin so lange ausgerechnet mit dem Programmierer redet; ein Mann aus einem hinterhältigen Land. Vermutlich ist kein Land hinterhältiger als das, das ein sogenanntes neutrales Gesicht aufsetzt und nirgendwo hilft und nichts verhindert. Diese Länder plustern die Federn der Selbsttäuschung auf und wähnen sich mit Herzensgüte und freundlicher Heiterkeit gesegnet. Allerdings nimmt ihr Humor häufig zynische Züge an, er gleicht dem Humor eines unter Minderwertigkeitskomplexen leidenden Arschlochs oder Alltagsfaschisten. Pommerantsch kommt der hundertjährige Meister aus Prag in den Sinn. Der alte Mann lebt zurückgezogen und hat einen faltigen Schildkrötenhals, auf den die Schriftstellerin beim Abschied einen Kuss haucht; er ist hochgewachsen, sie erreicht seine Wange nicht. Seine Hände zittern nicht, und in seinem Schlafzimmer hängt mit Reißzwecken befestigt das Foto einer Studentin, in die er früher einmal verliebt war. Das Foto der verstorbenen Gattin duckt sich auf dem Schreibtisch in einem Bilderrahmen. Die Schriftstellerin lebt gern zurückgezogen; Nähe schadet der Zurückgezogenheit nicht, sie gibt ihr die Würze. Die Haare des Witwers sind lang und weiß, seine Augen blicken in die Vergangenheit. Er ist auf sich selbst und seine Arbeit konzentriert. Seine Arbeit ist ihm immer noch wichtig, er glaubt an sie. Er liest Texte über die Renaissance, schreibt philosophische Abhandlungen und literaturtheoretische Arbeiten darüber. In seiner Wohnung herrscht Chaos, überall liegen Zeitschriften und Bücher herum, als baute er sich ein sicheres Vogelnest daraus. Er wehrt sich gegen die Behauptung, geschliffene Kunst habe in der heutigen Zeit nichts verloren. Er wehrt sich gegen alle, die Werke hinreißender Kraft und unglaublicher Schönheit zunichtemachen wollen. Ein ohnmächtiger Greis. Der immer noch über die Macht verfügt, andere zu schikanieren; in seiner Anwesenheit kommen sich sogar Professoren und Professorinnen wie ungelenke Jungs und Mädchen vor. Schweißgebadet stehen sie vor ihm.
Die Schriftstellerin lebt aus eigener Entscheidung zurückgezogen. Alleinsein macht unglaublich stark. Nach ihrer ersten Scheidung fühlte sie sich einsam unter den Menschen, über jedem Schritt und Tritt von ihr schwebten mittelalterliche Fragezeichen in der Luft. Als hätte sie ein Soll nicht erfüllt, als wäre sie nicht gut genug gewesen. Tief in der Gesellschaft hielt sich die Meinung: Es sei die Aufgabe einer Frau, beim Manne zu bleiben, und auf dem Lande hätte man sie noch im neunzehnten Jahrhundert nackt hinter einen Pflug gespannt; ein beliebter Spaß für tschechische Dörfler. Bei ihrer vierten Scheidung verzog keiner mehr eine Miene.
In erster Linie muss sie sich selbst treu bleiben, weiß sie. Das ist die größte und wichtigste Aufgabe, so war es immer, so wird es immer sein. Dem eigenen Ich treu bleiben, das sich sonst auflösen würde. Wäre sie ihren Männern treu geblieben, hätte sie das eigene Ich umgebracht. So ist bloß der überflüssige Teil ihres Selbst hopsgegangen. Sie hat die naive Weiblichkeit und die manipulativen Waffen einer Sklavin beerdigt, die Frauen in ihrem Land so gern einsetzen. Eine Sklavin lernt, Sklavin zu sein. Beim Abschied händigte sie ihre Waffen dem Exmann feierlich aus; sie verneigte sich und legte ihre Rüstung samt Waffenschein ab. Sie war frei. Süße Zurückgezogenheit, persönliche Freiheit, Unabhängigkeit. Gegen nichts auf der Welt würde sie sie eintauschen. Hochzeit, verpuffende Liebe, Trennung, Versöhnung, Scheidung. Sie stürzte sich in die Arbeit. Für kurze Zeit auch als Literaturwissenschaftlerin, arbeitete mit dem launischen Witwer zusammen, der alles schlecht fand, was sie tat; zufrieden war er mit der Qualität ihres Schreibens, nicht aber mit ihrer Themenwahl. Er wollte nicht, dass sie sich mit der Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts auseinandersetzte, denn seiner Meinung nach hatte die Literatur in eben jenem Jahrhundert aufgehört zu existieren. Sie hat es geschafft. Ihre vier Kinder, längst keine Kinder mehr, wissen, was es hieß und was es bis heute heißt. Sie hat es trotz spöttelnder Kollegen geschafft; viel dumme Bemerkungen, aber kein Angebot, ihr einen Babysitter oder eine Kinderfrau zu spendieren. Nur dank Unabhängigkeit hat sie eigenständiges Denken bewahrt. Konfuzius hat einmal gesagt: Was zehn Augenpaare sehen, worauf zehn Hände zeigen, das muss ernst genommen werden! Reichtum verschönert das Haus, Tugend verschönert die Persönlichkeit, der Geist weitet sich, der Leib entspannt sich; deswegen muss sich der Edle so aufrichtig wie möglich um eigenständiges Denken bemühen.
Dank Pommerantsch kann die Schriftstellerin die unter der Oberfläche verborgene Wahrheit entdecken und begreifen. Sie sieht um sich herum Männer, die möchten die Welt lenken und haben alle Hände voll mit sich selbst zu tun. Männer, die ihre Unabhängigkeit betonen, würden sich am liebsten verkriechen. Männer, die ihre Lebenserfahrungen betonen, träumen im Grunde von einem Neubeginn. Männer lassen nur solche Eindrücke zu, die ihre bisherige Meinung unterstützen. Pommerantsch hat der Schriftstellerin zu verstehen gegeben, dass nicht arm ist, wer wenig besitzt, sondern wer wenig sieht. Egoismus macht die Menschen unglücklich und unzufrieden. Pommerantsch unterdrückt seinen Wunsch, den Empfanggästen ein Stück gewöhnliches Brot anzubieten.
Die Augen der Schriftstellerin huschen über die lärmende Menge. Zwischen den Menschenbeinen hervor schießt ein orangefarbener Feuerstrich. Oder hat sie schon zu viel getrunken und sieht getigerte Mäuse. Ihr langes Schweigen verunsichert den Programmierer.
»Und Sie … Sie wollen hier schreiben?«
»Beobachten. Vielleicht schreibe ich einen Schelmenroman. Auf dem Sterbebett. Da hätte ich Spaß daran.«
»Bitte?«
»Nichts.«
»China ist wunderschön. Die Natur, die Architektur, die Geschichte, der Aufschwung. Ich beginne jetzt mein drittes Jahr hier. Aber ich möchte gerne noch irgendwo anders hin.«
»Immer auf der Flucht, stimmt’s?«
»Keinesfalls!«
»Die Neigung wegzurennen ist nicht neu.«
»Ich renne nicht weg.«
»Viele erhoffen sich Bewunderung mit exotischen Reisen.«
»Ich nicht. Ich bewundere das hiesige Kollektivdenken.«
»Es gibt kein kollektives Denken. Denken kann man nur individuell. Allerdings lässt sich in China ein Kollektivhandeln beobachten.«
Der Programmierer räuspert sich. Wie umschifft er bloß das heikle Thema. Er findet wieder Boden unter den Füßen.
»Nur für das Lesen bleibt mir keine Zeit. Aber von meinem Vater kenne ich das Buch Gesänge aus dem alten China.«
»Na, dann haben Sie ja eine Ahnung von der Ewigkeit.«
»Wir hatten die Gesänge als Thema im Abitur. Zum fernen Grenzberg bist du gegangen, mein Freund …«
»Und weiter?«
»Ich krieg’s nicht mehr zusammen.«
Zum fernen Grenzberg
bist du gegangen, mein Freund,
seit einem Jahr beben unter deinen Händen
meine Brüste nicht.
Bestimmt bist du schlank geworden im Kampf,
ein herbstliches Gewand schneidere ich dir:
schmaler muss es sein,
schmaler als bisher.
Die Schriftstellerin kippt den Sekt hinunter. Starrt in ihr leeres Glas.
Schon wieder trinke ich heute nach langer, langer Zeit
in der Abenddämmerung allein vor einem Rosenstrauch …
Der Programmierer holt den Fisch an der Angel etwas näher heran:
»Schreiben Sie auch Gedichte?«
»Die würden Sie nicht mögen.«
»Ich verstehe nichts von Lyrik.«
»Unnötige Minderwertigkeitskomplexe.«
»Nein, wirklich. Tragen Sie etwas vor.«
»Etwas von mir? Nein.«
»Dann von jemand anders.«
Es bleiben Gewässer, es bleiben Wälder,
die Städte bevölkert mit neuem Volk.
Einer wird hängen, der andere nicht,
man wird weiter glücklich leben.
Spuren der Morde werden garantiert
vom Sand dieses Jahrhunderts verweht.
Die stummen Opfer mit ihren Henkern
bleiben weiter in eisiger Umarmung verbunden.
»So genau erinnere ich mich an die Gesänge aus dem alten China nicht mehr.«
»Das war Zbyněk Hejda. Etwas wie Gesänge aus dem alten China und Gesänge aus dem heutigen Tschechien und Europa in einem. Ich hole mir ein Glas Wein. Möchte keinen Sekt mehr.«
»Ich hole es Ihnen. Rot? Weiß?«
»Nein danke, mache ich selbst.«
Die Schriftstellerin schiebt den Programmierer zur Seite und lässt ihn verdattert am weißen Stehtisch zurück. Er schnappt sich ein gekühltes Bier und spült seine Wut hinunter. Der Stehtisch ist ein phosphoreszierender Teller auf langer Stange. Um den Programmierer herum rotieren Dutzende solche Teller, gleich hebt der internationale Zirkus ab. Zwischen seinen Füßen huscht ein fetter orangefarbener Kater hindurch; nicht mal die blöden Viecher haben sie hier im Griff. Der Jongleur Mond hat auf der Nasenspitze des Katers eine Schale in Schwung gebracht. Der Programmierer stellt sich vor, wie die Schriftstellerin auf einem der weißen Tische Cancan tanzt, ohne Unterwäsche.
Der Verlobte geht vorbei; er bleibt nicht stehen. Der Botschafter geht vorbei, nickt, bleibt nicht stehen; dabei ist er seit Jahren mit dem Vater des Programmierers befreundet, außerdem hat ihm der Programmierer einen Hackerschutz in seinen Rechner gebaut. Immer neue Körper wuseln wie Amöben an den Tischen vorbei, die Europäer halten die Visitenkarte förmlich und verkrampft, wie im Reisebericht der Schriftstellerin beschrieben: Eine Visitenkarte soll mit beiden Händen überreicht und ebenso in Empfang genommen werden. So drückt man Respekt vor der hiesigen Kultur aus.
Visitenkarte für Visitenkarte huschen durch die Nacht, wechseln die Besitzer. Die eigenen Visitenkarten brennen dem Programmierer in der ausgebeulten Jackentasche. Er muss sich unter die Leute mischen, sonst bringt der Abend nichts. Den Nebentisch meidet er; dort stehen der Verlobte und die Tochter der perfekt angezogenen Chinesin, die bei der Botschaft arbeitet; sie empfängt und begrüßt dort die Besucher auf Chinesisch und verabschiedet sie auf Englisch. Eine liebreizende Frau mit fast unanständig faltenloser Haut. Auch wenn sie sicherlich nicht dumm ist, wirkt sie doch etwas beschränkt. Der Verlobte grinst von einem Ohr zum anderen, die Augen zu Schlitzen verengt. Die junge Chinesin ist auf den ersten Blick rührend schüchtern, still. Allerdings nur auf den ersten Blick, jetzt lachen die beiden. Gut, dass Olivie zu Hause geblieben ist, sie ist zu dünn und zu unsicher für eine größere Gesellschaft.
Aus dem Augenwinkel betrachtet der Programmierer die Schriftstellerin; sie macht zu viel Gewese um sich. Jetzt redet sie mit dem Goldgräber. Bestimmt raunt er ihr dasselbe ins Ohr, was er jedem ins linke Ohr flüstert: Ob sie ihm etwas Geld leihen, einen Scheck ausstellen könne, vielleicht sogar Bares dabeihabe? Der Goldgräber ist einer der vielen »böhmischen Chinesen«. Keiner weiß, wovon diese Leute in Peking leben; sie gründen tschechische Kneipen, machen Pleite und kippen um wie Dominosteine. Der Goldgräber trinkt gerne Bier und macht sich gerne an wichtige Menschen heran. Der chinesische Boss der nächsten neu zu eröffnenden böhmischen Kneipe hat den Goldgräber ins Herz geschlossen; von seinen chinesischen Kollegen wird der Goldgräber deswegen gehasst, aber das ist ihm herzlich egal. Er kommt morgens zur Arbeit, setzt Kopfhörer auf und tut, als würde er arbeiten. Die ganze Woche hockt er eingesperrt im Bereich der Hoffnungen, und am Wochenende holt er sich in der Botschaftsbar den Rausch. Er klatscht viel und gern, weil er über die anderen am meisten weiß. Er ist nett. Aber etwas an ihm macht dem Programmierer Angst. Er würde ihm nie Geld leihen; da könnte er es gleich wegschmeißen.
Die Schriftstellerin lehnt Sekt und Wein ab und trinkt nun mährischen Sliwowitz. Sie flirtet mit dem Diplomaten und seiner schlanken Gattin mit Geierblick und Honigstimme. Alle Diplomatengattinnen sehen emanzipiert aus, aber das ist nur der folkloristische Umhang, den sie sich übergeworfen haben. In einigen Jahren werden die jüngeren Ehefrauen alle zum Verwechseln aussehen und die Linie Kinder, Kirche, Küche vertreten. Die Schriftstellerin flattert im Raum herum und lächelt, dabei hatte der Programmierer vor, selbst mit ihr zu flirten. Er möchte sie betrunken machen, erniedrigen, ihr zwischen die Beine fassen. Das wollen die Frauen doch alle.
Er stellt sich zu einem Paar; an deren Tisch kann er sich hoffentlich in Ruhe betrinken. Den Mann, Murmel, kennt er schon lange, seine Schwester war mit einem Kumpel des Programmierers verheiratet. Und als Murmel nach Peking zog, hat der Programmierer ihm eine Wohnung besorgt. Murmels Körper steht eng an dem seiner neuen chinesischen Freundin, die Blicke ineinander vertieft, verliebt in die Welt, demütig die Linien von Wasser und Boden annehmend wie Konfuzius. In großer Demut tradierte Konfuzius die Grundsätze der Kaiser Yao und Shun, führte beispielhalft die Grundsätze der Könige Wen und Wu aus; oben am Himmel folgte er dem Rhythmus des natürlichen Zeitenwechsels, unten auf Erden nahm er demütig die Linien vom Wasser und Boden an.
Die Augenlider des Programmierers werden schwer, aber ganz abgefüllt ist er noch nicht. Sein Blick hellt sich auf; seine bessere Hälfte rauscht herein. Zum ersten Mal nach vielen langen Tagen sieht er sie wieder aufmerksam an. Sie ist zu spät, ein Heiligenschein umgibt ihr Gesicht, man sieht ihr die Vorfreude an, die Planlosigkeit, sie hat nicht nur ihren Hals, sondern auch die Schultern und die nackten Arme mit Parfum besprüht; eine Luft ist das hier, zum Schneiden, Mensch, wo ist denn die Bar, ich muss dringend etwas trinken, sagt sie außer Atem. Sie küsst ihn flüchtig auf die Wange, sieht sich um, entschuldige, früher ging’s nicht, ich muss sowieso noch zur Arbeit zurück, kümmere du dich um Olivie, macht euch was zu essen, ja? Holst du mir einen Wein, Weißwein, das weißt du doch, Schatz; und schon ist sie weg, schon wirbelt sie voller Energie herum, schon haucht sie jedermann ein flüchtiges Küsschen auf beide Wangen, woher kennt sie bloß all die Leute, sie schwirrt herum, alle sind scharf darauf sie kennenzulernen; sie verteilt Visitenkarten, sie agiert mit vielen Spielern gleichzeitig, als wäre der Abend eine simultane Schachpartie. Er steht an seinem Schachtisch allein, unsichtbar; mit ihm spielt keiner.
Der Programmierer steuert das Buffet an. Über der schneeweißen Tischdecke leert er das nächste Bier. Er greift nach einem Weißwein für seine Frau; die ist in ein lebhaftes Gespräch mit der Schriftstellerin und der Diplomatengattin vertieft. Sie trinken Sliwowitz.
Die Frau des Diplomaten streicht ihren Rock glatt und blickt aufgeregt zu der Schriftstellerin hoch, diese rothaarige schlanke Frau im Abendkleid, ach, wie sie die beneidet, die Geheimnisumwitterte, die muss nicht immer niedlich aussehen, ist nicht verheiratet, hat ihren festen Platz im Leben und eine eigene Karriere und, wie man munkelt, auch eine schöne Wohnung und lauter Männer um sich herum, alle liegen ihr zu Füßen, auch wenn sie sie fürchten, den Ehemännern macht sie Angst, manche hassen sie auch. Na und, was soll’s, sie sitzt fest im Sattel und ist einfach sie selbst. Vielleicht könnten sie Freundinnen werden.
Der Programmierer beobachtet, wie sich die Frau des Diplomaten voller Bewunderung zur Schriftstellerin neigt und ihr lebhaft etwas erzählt. Seine Wut wächst. Hat sie es denn gar nicht kapiert? Dass er sich ihrer angenommen hätte? Dass sie sich gemeinsam hätten verdünnisieren sollen von der Party? Er wollte sie fragen, was sie von ihm hält. Sie ist schlagfertig und witzig und kann Dummköpfe nicht ausstehen, er wollte sich ihr anvertrauen, weil sie offen ist und kein Blatt vor den Mund nimmt, dabei aber höflich bleibt. Sie meint alles ernst und hat keine Angst vor einer Konfrontation. Sie gibt nichts vor, sie verheimlicht nichts, das verunsichert die Männer und macht sie verstockt. Er hat doch eine angenehme Bekanntschaft mit ihr geknüpft, er wollte jemanden, bei dem er sich beklagen, sich Trost holen konnte. Sie hat gesagt, sie lebt nicht dafür, die Männer bei Laune zu halten, das hat sie nicht nötig, und sie hat auch gesagt, talentierte Menschen werden mit den Augen erzogen und die Mittelbegabten mit Wörtergerassel.
»Und die Dummen?«, fragte er.
»Die Dummen mit dem Rohrstock.«
Er hat sie retten wollen, mit Alkohol und heiterer Stimmung nach der Party, sie lebt doch allein und hat bestimmt Zärtlichkeit, Berührungen, Sex nötig. Jetzt will er ihr nur noch sagen, wie ihm die Galle überläuft. Nie wieder wird er ihre Bücher anfassen, darauf kann sie Gift nehmen. Woher kommt seine Wut so plötzlich, wundert sich der Programmierer. Jemand rempelt ihn an.
»Darf ich?«
»Entschuldigung.«
Er macht einer hübschen Frau Platz, die sich zwischen den Partykörpern hindurchschlängelt. Die amerikanische Studentin spricht Tschechisch, Englisch, Chinesisch. Selbstbewusst, mit schneeweißem Permalächeln. Der Programmierer folgt ihrem nackten Rücken. Gibt ihrer langen Zigarette Feuer.
»Wie finden Sie China?«
»Sind Sie zum ersten Mal hier?«
»Wie war Ihr Flug?«
Die amerikanische Studentin raucht viel. Abwechselnd mischt sie sich hier ins Gespräch, schüttelt da eine Hand, legt dort jemandem den Arm um die Schultern, wer möchte noch einen Schluck? Sie beäugt den Programmierer. Im Moment beneidet sie diesen interessanten Mann um seinen festen Platz im Leben. Beneidet seine Frau um ihre Familie und den sicheren Platz inmitten ihrer Liebsten. Sie beneidet die beiden um ihr bequemes Leben. Sie brauchen sich nicht mehr abzuhetzen, den Dingen hinterherzurennen. Ihre einzige Tochter soll außerordentlich begabt sein, aber kränklich. Die amerikanische Studentin schließt sich der Frau des Programmierers an, die mit der Schriftstellerin redet. Seit tausenden von Jahren schon wolle sie nicht mehr rauchen, sagt die Schriftstellerin, aber kaum sehe sie jemanden mit einer Zigarette in der Hand, zünde sie sich gierig selbst eine an. Dabei hält sie Glas und Zigarette in der linken Hand, damit ihre rechte frei bleibt. Als wäre sie ständig bereit, sich Notizen zu machen, Gedanken, Ideen aufzuschreiben. Die meisten Menschen erinnerten sich an den Tag, fährt die Schriftstellerin fort, wo sie beschlossen haben, mit dem Rauchen aufzuhören, sie erinnere sich wiederum an den Tag, wo sie beschlossen hat, mit dem Rauchen nicht aufzuhören. Hinter ihnen rauschen Stimmen und knicken Knie ein, »… aber sicher, kein Problem …«, »… man kann ihn hier doch nicht so lassen, oder?«
Die amerikanische Studentin pustet Rauch aus. Unter Männern findet sie selten Gesprächspartner. Männer wollen reden, nicht zuhören. Frauen, die für sich Aufmerksamkeit beanspruchen, können nicht mit einer dauerhaften Beziehung zu einem Mann rechnen. Männer ziehen sich so lange in sich zurück, bis sie ganz vergessen haben, was die Frau eigentlich von ihnen wollte. Sie erinnern sich lediglich an ihre erotische Ausstrahlung oder Schönheit, und dann pochen sie auf ihr Besitzrecht, ganz selbstverständlich und ohne Vorwarnung, sie haben sich doch so sehr nach Zärtlichkeit gesehnt, nach Intimität.
Die amerikanische Studentin mustert die Schriftstellerin. Ständig unter Dampf und scheint es nicht einmal zu bemerken. Es muss mehr sein, was sie antreibt, nicht nur die Schaffenslust, obwohl sie unter bemerkenswertem Druck arbeitet, ihr qualmt jetzt schon die Birne, eine Glorie aus Rauch. Eines Tages wird da ein glimmendes Kohlestück sitzen anstelle des Kopfes. Ständig unter Dampf und trotzdem nur von einem einzigen Wunsch angetrieben: sich allein, mit innerer Genügsamkeit und Demut, auf einer Insel zu verkriechen und zu schreiben. Auf der Amrum-Insel, von der sie ständig schwärmt, sei es so still, dass man das Rascheln der Flügel höre, wenn ein Vogel einem über den Kopf fliegt. Plappernde Münder, wohin der Blick der Schriftstellerin reicht, ihr Auge muss wachsam bleiben.
Der Diplomat schließt sich dem Grüppchen an, gluckst gierig und beschwipst. Gar nicht zugeknöpft, der Typ, auch nicht überheblich, er rackert wie ein Pferd und braucht Stärkung; schon seine pure Anwesenheit bringt alle Fraueninseln an diesem frühen Abend zum Leuchten. Er mag seine Frau sehr, aber er wünschte, sie hätte mehr strahlende Schlagfertigkeit. Er flüstert der amerikanischen Studentin etwas zu; ihre Lippen gleichen einer aufgehenden Lotosblüte. Ob sie vielleicht Lust auf einen weiteren Drink hat? Mit ihm. Allein. Hmmm. Von welchem raffinierten Zauber ließe sie sich wohl verführen?
Der Raucherbereich, mit Kreidestrichen auf dem Beton markiert, füllt sich mit immer neuen Körpern. Der lange Murmel, ein, wie alle behaupten, genialer Wissenschaftler und Assistent an der Universität Peking, lässt seine Gedanken Murmelbahn fahren und überlässt seinen Körper den Krallen der chinesischen Geliebten. Er schmiegt sich an sie, seine Umgebung nimmt er nicht wahr. Das Paar steht für Wein an, einer von ihnen hat die Frau des Programmierers mit dem Ellbogen angestoßen. Die beiden entschuldigen sich, verneigen sich, das Wort Verzeihung gehört hier zum Familiensilber. Murmels chinesische Freundin ist schön, temperamentvoll, fleischfressend. Sie will nach Europa. Murmel lässt sich küssen und findet die Naivität der außereuropäischen Welt verdächtig; alle träumen sich Richtung Europa. Vom Regen in die Traufe. Die Tschechen in der Schlange reden über einen Anschlag auf europäische Touristen. Ein siebzehnjähriger Muslim hat in Tunesien seinen Körper geopfert, fällt diesen Islamleuten nichts Besseres ein? Definieren sie wirklich ihre Identität nach der Religion? Aha, und was sagen Sie dazu?
Die Frau des Programmierers hört mit halbem Ohr zu und blickt sich nach Murmel und seiner Freundin um. Wie eine Stichflamme schießt Neid in ihr hoch, nur mühsam kann sie die Aufwallung unterdrücken, sie zieht den Neid in die Lunge hinein, in jede Pore des Körpers; er zirkuliert in ihrem Blut. Ihr Eheleben ist auf sporadischen Sex und sonntägliches Mittagessen geschrumpft. Noch einmal jung sein. Einen zärtlichen, netten, intelligenten und vielversprechenden jungen Mann an der Seite haben. Wieder jung sein und jung aussehen. Die Welt der ehelichen Lover.
»Sind Sie zum ersten Mal in China?«
»Wie war Ihr Flug?«
»Wie finden Sie China?«
Der Programmierer hat sich einen anständigen Rausch angetrunken. Sein Körper fühlt sich schwer an, seine Wut ist verraucht. Vorhin hätte er am liebsten etwas zerschlagen. Sein Schweigen dauert schon zu lange, inzwischen ist das Stadium der Resignation erreicht, wo man das Schimpfen aufgegeben hat, das Herumwüten. Alles hat sich in ihm abgelagert, der Giftpegel steigt, die nächste Eruption kann schicksalhafte Folgen haben.
Der Zeitgeist hat alle fest in der Hand, und ein gottesfürchtiger Abt erzählt am Tisch seinen Traum.
»Ich aß mit drei Brüdern zu Abend. Im Mund des ersten Bruders verwandelte sich trockenes Brot in süßen Honig. Im Mund des zweiten blieb das Brot wie immer. Dasselbe Brot schmeckte dem dritten bitter wie Galle. Wie kann ein und dasselbe Brot dreierlei Geschmack haben?«
Die Anwesenden denken nach. Der Abt spricht: »Der Erste aß sein Brot mit Dankbarkeit, in Demut und mit Frieden in der Seele. Der Zweite aß es gleichgültig, also konnte er nicht genießen. Der Dritte schluckte sein Brot unter Murren und mit unzufriedenem Herzen.«
Die Frau des Programmierers muss noch zur Arbeit. Der Programmierer will kein Taxi nehmen. Er setzt sich selbst ans Steuer, um sich zu beruhigen. Rasch überholt er die anderen, zwingt sie, auf die Bremse zu treten. Manchmal klebt er am Hinterteil seines Vorgängers fest, hupt, atmet nervös. Wütend schüttelt er den Kopf. Manchmal blökt er fröhlich. »Du Schnecke, du Schleimkriecher, an die Wand mit dir, geschieht dir recht!«
Zu Hause macht er den Kühlschrank auf. Schließt die Augen und versucht sich zu erinnern, was er eigentlich wollte. In Olivies Abteilung steht seit Tagen ein Topf mit Brokkolisuppe. Aus dem Brokkoli ist ein stinkender sumpfiger Brei geworden. Auf dem Quarkaufstrich mit Gemüse prangen grüne Schimmelflecken, zwischen ihnen wuchert weicher weißer Flaum. Auf Untertassen liegen Gemüsereste herum, aufgeschnittene grüne Gurken, rote Paprika, gelbe Melonenhäppchen. Alles gammelt allmählich vor sich hin. Olivie lagert hier die nicht aufgegessenen Reste. Auf Anweisung der Frau des Programmierers dürfen die Putzfrauen den Kühlschrank nicht öffnen. Sie hatte sie im Verdacht, die gekühlten Flaschen mit teurem Wein und Sekt zu klauen.
Das Telefon klingelt. Die Mutter des Programmierers mit ihrer klagenden, herrschsüchtigen Stimme ruft an. Für sie ist es kein Problem, sich den Wecker auf jegliche Nacht- und Tageszeit zu stellen. Eine klagende Stimme ist Aggression. Schon wieder sei einer gestorben, meldet sie, aber der Programmierer bringt die Namen durcheinander. Seine Mutter lenkt sein Leben. Obwohl sie hier nichts zu melden hat. Sie hat die Fernkontrolle über seine Tage.
»Habt ihr euch schon das Wassergerät angeschafft? So ein Ding, wo das Wasser auch gleich gereinigt wird?«
»Nein.«
»Ist das Weihnachtsgebäck schon alle?«
»Ja.«
»Vergiss nicht, bei Smog eine Maske aufzusetzen. Wie war heute das Wetter?«
»Bewölkt.«
Seit Neuestem wird in Peking die Luftverschmutzung gemessen. Von den Amerikanern. Sie wollten wissen, unter welchen Bedingungen ihre Menschen, ihre Arbeitskräfte hier atmen. Die Ergebnisse haben sie auf ihren Webseiten veröffentlicht. Das fanden die Chinesen nicht gut; sie löschten die Seiten. Amerika ist eine Großmacht, sie anzugreifen trauen sich die Chinesen nicht. Die Amerikaner haben eigene Messinstrumente eingeführt, die sehr genau sind. Die festgestellten Zahlen sind gruselig. Bisher hat sich um Smog niemand geschert, seit dreißig Jahren nicht.
»Und Olivie?«
»Was ist mit ihr?«
Der Programmierer weiß genau, was seine Mutter meint.
»Isst sie?«
Die Hand des Programmierers wirft den Inhalt des Kühlschranks in den Müll. Das depressive Gebrabbel seiner Mutter macht ihn wütend, seine Wut schwillt an, er verabscheut die weiblichen Schwächen, er möchte Männer bewundern. Olivie kommt aus ihrem Zimmer in die Küche geschlurft.
»Ahoi Papa.«
»Ahoi. Wann bist du nach Hause gekommen?«
»Wie immer.«
»Wie immer.«
»Ja.«
»Was heißt wie immer?«
»Gleich nach der Schule.«
»Oma will dich sprechen. – Mama, ich geb sie dir.«
Olivie nimmt seufzend das Telefon entgegen. Ein Wortschwall überflutet sie. Tosende Brandung der Sätze.
»Okay, Omi, mach ich. Das Rezept hab ich noch.«
Olivie gibt ihm das Telefon zurück.
»Und wie war’s?«
»Wo?«
»In der Schule.«
»In der Schule? Gut.«
»Gut.«
»Ja.«
»Gut reicht nicht. Heutzutage ist gut nicht genug. Wenn du auf der Schule bleiben willst, dann musst du die beste sein. Anders läuft es nicht auf der Welt, meine Süße.«
Olivie starrt ihn durch ihre Schildpattbrille an.
»Zeig mir dein Zimmer. Hast du aufgeräumt?«
Der Programmierer bemüht sich mit dem Suppentopf gar nicht erst ins Bad. Er kippt den sumpfigen Inhalt direkt in die Spüle. Er schwankt. Das Brokkoligrün spritzt auf die gelben italienischen Kacheln hinter dem Wasserhahn und hinterlässt Tröpfchen wie Tränen, die in flimmernden Wellen die Wand hinunterfließen. Der Programmierer stürmt ins teure Zimmer seiner Tochter. Auf dem Bett liegen Klamotten. Über der Stuhllehne hängt der Morgenmantel, darauf ein feuchtes Badetuch. Auf dem Tisch stapeln sich kleine Teller mit Orangen- und Bananenschalen, vertrockneten Apfelgriebsen. Halbvolle Gläser. Er reißt angeekelt das Badetuch vom Stuhl, schmeißt es auf den Boden.
»Das gehört in die Schmutzwäsche. Oder ins Bad. Hier stinkt’s nach vergorener Milch.«
Olivie hebt artig das zerknitterte Badetuch vom Boden. Es wirbelt Staub auf, zieht Fusseln mit sich. Olivie bringt es ins Badezimmer, und als sie zurückkommt, findet sie ihren Vater in ihre geöffneten Bücher stieren.
»Was ist das?«
»Bücher.«
»Bücher?«
Unergründlich, unbezähmbar. Seine Tochter. Manchmal findet er sie sympathisch. Manchmal kann er sie nicht riechen. Auf den ersten Blick schüchtern, verschlossen, gibt sie plötzlich unerhörte Sprüche von sich. Sollte sie nicht eher mit Kopfhörern auf dem Kopf Musik hören, sich dauernd neue Klamotten kaufen, mit Freundinnen die Höhe der Absätze diskutieren, davon träumen, eine freche kleine Miss zu sein, sollte sie sich nicht die Nächte mit Fernsehserien um die Ohren schlagen, auf Konzerten herumtoben? Sollte sie nicht wenigstens einen E-Reader haben? Wer liest denn heute noch so dicke Wälzer? Die taugen doch höchstens als Stützen für wackelige Schränke und Tische. Oder für den Bau von Schallwänden.
»Vorher meintest du …«
»Marcel Proust. Schopenhauer. Nietzsche. Voltaire. Anne Frank. Simone Weil. Raewyn Connell. Hannah Arendt. Rahel Varnhagen. Was soll der Scheiß?«
»Sie alle haben nachgedacht … über die Welt.«
»Da war die Welt noch verdammt anders, meine Süße.«
»Glaube ich nicht.«
»Leben sollst du. Nicht lesen.«
»Hannah Arendt hat zum Beispiel am Fall von Eichmann den Mechanismus entdeckt, nach dem ein Durchschnittsmensch eine Entscheidung trifft zwischen richtig und falsch. Ihm fehlen nämlich die Kriterien.«
»Behalte deine Frechheiten für dich. Räum zuerst den Mist hier auf, wenn du schon keine Putzfrau reinlässt. Wie war der Test in Geschichte?«
»Gut.«
»Gut?«
»Gut.«
»Warst du eine der Besten?«
»Was meinst du mit … eine der Besten?«
»Die Erste in der Klasse. Die Erste in der Schule.«
»Nein.«
»Nein?«
»Nein. Tut mir leid.«
Ihre Wehrlosigkeit und sklavische Gehorsamkeit reizen ihn bis aufs Blut. Als wüsste sie genau, dass er sich auf den versnobten Firmenabenden und sonstigen Partys vor lauter Nervosität immer volllaufen lässt. Beim Anblick ihres unglücklichen Gesichtsausdrucks würde er am liebsten schreien. Weil er frei über Olivie verfügen kann, ist sie eine Provokation für ihn. Sie provoziert ihn, um zu testen, wie weit er geht. Sie provoziert, weil sie ein durchschnittliches Wesen ohne Pepp ist, uninteressant und fügsam. Dabei würde er sie so gern zu Empfängen und Firmenpartys mitnehmen und angeben mit seiner heranwachsenden Tochter. Aber mit dem Ding hier? Schon ihre Anwesenheit ist die pure Provokation, eine Erinnerung daran, dass er auch hier versagt hatte. Weil sie von ihm abhängig ist, weil er sie hätte schützen sollen und es nicht getan hat; gleichzeitig erinnert sie ihn an die schmerzliche Tatsache, dass auch ihn keiner schützt. Dass er ein Loser ist. Es reizt ihn, ihr Unschuldsengelchengesicht zu verschandeln. An dieser Stelle hat nämlich nicht er zu stehen, sondern seine Frau. Seine Frau soll ihn mit einem warmen Abendessen und einem Blech Quarkbuchteln oder Schokoschnitten oder sonstigen Desserts in einer aufgeräumten, freundlichen Wohnung empfangen. Damit er in der Ecke seine Wunden lecken kann, die ihm die Welt verpasst hat. Jetzt steht er hier allein, entblößt, dem Leben ausgeliefert. In seiner Jackentasche brennen die nicht verteilten Visitenkarten. Keiner ist auf ihn zugekommen. Er wird bei keinem betteln. Er wollte die Schriftstellerin flachlegen, aber auch das übernimmt jemand anders. Er muss einen Widerstand spüren, eine Auflehnung, damit er seinen Frust hinausschreien kann. Und dieses Geschöpf, das hier vor ihm steht, das soll seine Tochter sein? Sie steht und wartet. Ein wehrloses Lämmchen. Als wüsste sie, dass er ein Problem hat, nicht sie.
Sie streitet nicht. Sie widerspricht ihm nicht, wie Pubertierende es sonst tun. Wenigstens das sollte doch in seinem Leben noch funktionieren. Er hasst seine Tochter für die Situation, in die sie ihn bringt. Er hasst sie für die Rolle, die sie ihm aufzwingt, zu der sie ihn heimtückisch anstiftet. Er hasst ihre hellseherischen Fähigkeiten, ihr intuitives Wissen davon, wie gut es ihm tut, wenn er sie erniedrigen kann. Sie zu quälen. Die Vorstellung ist so verlockend, dass er sie am liebsten noch rechtzeitig vor sich selbst warnen und aus der Tür werfen möchte. Damit sie ihm aus den Augen geht. Und ihm diesen Blödsinn nicht aufzwingt, das tief in ihm schlummernde Ich nicht weckt, ihn nicht zwingt, diese widerliche Gestalt anzunehmen. Eine Haltung, die ihn gleichzeitig anzieht, weil sie vor Macht strotzt, vor Stärke. Er packt die Bücher, die auf dem Tisch liegen, und schleudert sie auf den Boden. Fegt auch die vom Regal hinunter.
»Erst Staub wischen, dann Geschichte lernen. Erst dann darfst du das hier lesen.«
»Gut.«
Sie hat es getan. Er hat es gesehen. Sie hat die Augen verdreht. So. Endlich liefert sie ihm einen Vorwand.
Bücher sausen durchs Zimmer, ein erschreckter, mit offenen Seiten herumflatternder Vogelschwarm. Flügel aus Druckerschwärze. Er pfeffert ihr eine. Die Brille fliegt davon. Zerschellt an der Wand. Vor lauter Überraschung fasst Olivie nicht einmal ihre Wange an, wo ein roter Rorschachklecks erblüht.
»Heb das auf, du Brillenschlange.«
Olivie bückt sich nach der kaputten Brille. Mit zitternden Händen setzt sie sich das Gestell ohne Gläser auf die Nase.
Und schon wieder hat sie es getan. Ein salziges Rinnsal fließt ihr die Wange hinunter. Sie lässt vor seinen Augen eine Schwäche ihre glühende Wange hinunterfließen. Sie provoziert. Die Angst in den Augen seiner Tochter wird ihn von nun an und für immer davon abhalten, sie zu mögen. Er hat sich nicht im Griff, und dafür hasst er sie.
Die Salzträne kriegt eine zweite Ohrfeige. Das Gesicht der Schriftstellerin taucht vor ihm auf. Er trommelt auf den roten Fleck, damit er verschwindet. Schleudert den Mädchenkörper aufs Bett.
Die chinesische Mutter hat vom Diplomaten den Auftrag, die Schriftstellerin zu überprüfen. Niemand ahnt, welch professionelle Grausamkeit in dem freundlichen Wesen und zierlichen Körper steckt. Die Nacht beäugt die verwaisten weißen Tischchen, der Empfang ist vorbei. Als eine der Letzten unterhält sich die Schriftstellerin mit der jungen Chinesin, während deren Mutter energisch das Abräumen dirigiert und eine Putzkolonne kommandiert. Die Tische verschwinden, der fröhliche, fürs Catering zuständige Mann zeigt den Köchen, wo die Essensreste und Getränke gelagert werden sollen, damit die schwarzen Krähen sie nicht wegpicken. Bevor die letzte Flasche weggebracht wird, schenkt sich die Schriftstellerin Weißwein nach. Die junge Chinesin trinkt Wasser.
Die Schriftstellerin weiß, dass die junge Chinesin und ihre Mutter nur deswegen hier sind, um die anderen zu denunzieren. Diese Festung darf nicht von Menschen mit Gefängniserfahrung oder sonstigen Schönheitsfehlern betreten werden. Die chinesische Mutter ist nüchtern und unsentimental, sie hat ein loses Mundwerk und ist eine ganz schön widerliche Person, so einer macht man kein X für ein U vor. Die Tochter hilft ihr; ein verwöhntes und verlegenes Kind. Lebenslang wird die chinesische Mutter die mentalen Schwankungen ihrer Tochter korrigieren müssen.
Am besten sollte die Schriftstellerin klipp und klar sagen, was sie wirklich für eine ist; die chinesische Mutter findet es äußerst verdächtig, dass sich die Schriftstellerin zu keiner Ideologie bekennt. Die chinesische Mutter ist nämlich der Meinung, wenn man sich zu der einen Ideologie nicht bekennt, bekennt man sich zu einer anderen. Sie kann sich nicht vorstellen, wie man ohne Ideologie leben soll.
Geheimdienstagenten sehen wie schöne schlanke chinesische Töchter und Mütter mit langen Haaren aus. Der Schriftstellerin ist es egal. Sie möchte einzig und allein die ihr zur Verfügung stehende Zeit in Würde gelebt haben. Die junge Chinesin lobt China und gibt stolze Sätze von sich.
Der Empfang ist doch nicht zu Ende. Die Schriftstellerin hat einen lebendigen Traum. Sie schwimmt nachts im Außenschwimmbecken. Sie bekommt keine Luft. Auf der Weide flackern sonnige Tupfer. Vom quellklaren Wasser des Schwimmbeckens zurückgeworfen. Die Sonne jongliert mit Lichtreflexen. Als stünde im Blitzgewitter eine Berühmtheit am Beckenrand. Nachts flüstern alle der Weide ihre Geheimnisse zu. Schon unter den Kelten war die Weide ein Psychologe, der sich träumend ins menschliche Leid hineinstahl. Der Körper der Schriftstellerin schwimmt, schiebt die von der Sonne ins Wasser geschriebene chinesische Schrift auseinander. Die flimmernden Reflexe sind schwarze Blauelsterköpfchen und ihr Gefieder; die Elstern trinken das Wasser aus dem Schwimmbecken. Studenten wedeln mit roten Büchlein und skandieren eine von Maos Banalitäten, das Dogma sei weniger wert als ein Kuhfladen. China exportiert Elektronik, keine Ideen. Das Land hat alle Rätsel geknackt, Anleitungen und Informationen geklaut; nur weil die Europäer sich gern bestechen lassen.
China. Als wäre den Menschen von einem Tag auf den anderen befohlen worden, einen anderen zivilisatorischen und kulturellen Code zu entschlüsseln. Dabei kennen sie das Alphabet nicht. Vom Fahrradsattel sind sie direkt ans Steuer eines Rennautos umgestiegen.
Sie haben unser Alphabet übernommen und führen uns damit vor, wie krank Europas zivilisatorischer Code bereits ist.
Als es nach Mitternacht an der Tür klingelt, schläft die Schriftstellerin endlich. Die Diplomatengattin, wespenschlank und fahl wie Mondpapier, kommt von einem anderen Empfang. Sie sieht aufgewühlt aus, hat eine Flasche italienischen Weins in der Hand. Sie braucht eine Weide und ein linkes Ohr. Bei ihrem Fliegengewicht ist sie schnell betrunken, sie beharrt auf ihrer Portion Selbstmitleid und Bedauertwerden. Wird ihr von beidem nichts zuteil, schürt sie manipulativ das Feuer unter dem Kessel, das Ganze nimmt die Züge einer Telenovela an; eine Freundin hat Selbstmord verübt, sie selbst wurde vom Schwiegervater belästigt, die achtjährige Tochter und der vierjährige Sohn, für die sie keine Kraft mehr aufbringen kann, machen ihr Sorgen, sie hat in einem chinesischen Krankenhaus eine Abtreibung über sich ergehen lassen, weil sie befürchtet, dass ihr Gatte einen genetischen Fehler hat und sie deshalb besser keine weiteren Kinder haben sollten, sie fürchtet, ihr Mann betrügt sie, sie hat ihn mehrmals am Notebook ertappt, und als sie wissen wollte, an wen er schrieb, hat er das Ding rasch zugeklappt. Er kommt immer spät nach Hause, heute hat sie ihn zusammen mit der amerikanischen Studentin lachen sehen. Die Schriftstellerin fühlt sich einem solchen Ansturm nicht gewachsen. Der manipulative Überfall eines gut behüteten Kindes, das im Mittelpunkt der selbst eingefädelten Dramen stehen will. Die Schriftstellerin schließt die zarte Frau, die im selbstinszenierten Selbstmitleid ertrinkt und keine Hilfe von außen annehmen will, in die Arme. Sie weigert sich, mit ihrem Mann über ihren Verdacht zu reden, sie möchte Diplomatengattin bleiben. Sie möchte bis in alle Ewigkeit Ehefrau sein. Sie ist jung und schön, bei den Empfängen wird sie umgarnt und kann sich Kindermädchen, Putzfrauen und Haushälterinnen leisten. Haben sie und ihr Mann Peking überlebt, winkt ihnen ein Lebensabend in London oder Paris.
Diplomatenfrauen sind zum Repräsentieren da. Sie werden von Langeweile zerfressen. Abwechselnd widmen sie sich dem Sport und Besuchen von Kosmetik- und Verjüngungssalons, sie lassen sich die Haare schneiden und Frisuren richten, sie reisen mit auffällig weiß leuchtenden Zähnen unablässig herum und suchen nach etwas, das ihre leere Zeit füllen würde. In die Politik und in die Arbeit ihrer Männer mischen sie sich nicht ein. Womit sie paradoxerweise auch auf die einzige Möglichkeit verzichten, das Geschehen zu beeinflussen.
Der Schriftstellerin wird bewusst, wie gern sie die Diplomatenfrau mag. Dieses kleine, seinem Gatten ergebene Mädchen, das sich ihr anvertraut. Als hätte sie die Lösung parat, als könnte nur sie hinter die Geschichte ihrer Geheimnisse blicken und ihr helfen. Die Schriftstellerin bleibt bei ihrer üblichen kühlen Zurückhaltung, sie mag die Frau zwar gern und zeigt es ihr auch, aber naives Geplapper hat sie noch nie ausstehen können. Behutsam bringt sie die Diplomatengattin zur Wohnungstür. In ein paar Stunden fliegt sie mit der ganzen Diplomatenfamilie in den Urlaub, sie scheint sich vor der Reise und Einsamkeit zu viert zu fürchten, vielleicht wollte sie sich vor dem Abflug reinigen, ihre Fragezeichen weiterreichen, sie zu Punkten machen. Die blanke Sehnsucht nach einem Dialog. Als sollte ihr die Schriftstellerin Absolution erteilen. Als wüsste nur sie, was zu tun ist. Der Schriftstellerin wird bewusst, wie gern sie die beiden mag, die Frau und den Diplomaten. Sie sind beide so ratlos. In der Ehe. Als Eltern. In der Sexualität.
Stabat mater, ganz oben auf der Pyramide steht die Gehorsamkeit den Eltern gegenüber, die Sohnestreue. Die Kommunistische Partei ist die Mutter. Alle üben sich in Gehorsamkeit; nicht einmal die Kulturrevolution hat ihnen die in den Knochen steckende konfuzianische Tradition austreiben können.
Jeder chinesische Politiker, jeder chinesische Geschäftsmann beteuert dem höchsten Sekretär der Kommunistischen Partei seine tiefe Ergebenheit. Alle betonen immer wieder, China sei entschlossen, den Weg des Sozialismus mit chinesischem Antlitz fortzusetzen, lasse aber gleichzeitig »die Tür offen« für die Reformpolitik.
Vielen am Herrscherhof geht es gut. Sie wissen, am besten fährt man, indem man sich anpasst.
Wem das Regime die Feindschaft erklärt hat, dem bricht es das Genick.
Wen hat sich hier das Regime wohl als Feind auserkoren?
Menschenrechte. Nichtchinesische Minderheiten. Unerlaubte Religionen. Frauen.
Nach dem Empfang stellt die chinesische Mutter eine operative Verbindung zwischen ihrer Tochter und der Schriftstellerin her, um die geheime Mission der Schriftstellerin rascher herauszufinden; sie ist nicht lesbar und verkehrt mit dem Freund. Vor allem hat sie vier Kinder zur Welt gebracht, zwei Söhne und zwei Töchter. Die chinesische Mutter hegt tiefste Verachtung für die Schriftstellerin, einen bodenlosen Neid.
Sie selbst würde China nie verlassen, China ist die Mutter. In der tschechischen Literatur liebt sie sozialistische Parolen, sie hat das Ganze nicht mehr genau in Erinnerung, aber ein Detail schon: Verlässt du mich, gehe ich nicht unter, verlässt du mich, gehst du unter. Jeder, der China verlässt, wird untergehen. Jeder, der China verlässt, kann nur auf eine einzige Weise seine Reue zeigen; im fremden Land eine Zweigstelle von China gründen, chinesische Viertel oder China Towns.
Die Schriftstellerin hält sich im bürgerlichen, öffentlichen oder politischen Gebiet auffällig zurück. Das kennt die chinesische Mutter gut. Viele Menschen halten ihre Underground-Arbeit als Dissidenten, ihre unauffällige Tätigkeit im religiösen Umfeld oder ihre stimulierende Teilhabe am unabhängigen philosophischen Geschehen für immens wichtig. Aber sie wollen sie nicht mit auffälligen und konfliktträchtigen Auftritten in der Öffentlichkeit gefährden. Also tun sie, als wäre ihr Leben eher nach innen als nach außen gerichtet. Was für eine grandiose Verstellung.
Die chinesische Mutter kann sich nicht vorstellen, dass sich solche Menschen nicht verstellen.