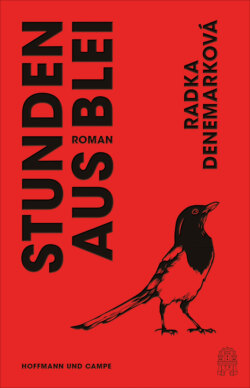Читать книгу Stunden aus Blei - Radka Denemarkova - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Sitz des Jadekaisers
ОглавлениеMurmels Schwester schließt die Tür ihrer Zahnarztpraxis ab. Bevor sie das Auto startet und die Zwillinge vom Kindergarten abholt, mustert sie erneut die einzige Postkarte, die ihr Bruder nach langen Monaten in Peking geschickt hat. Die einzige Antwort auf ihre ellenlangen Briefe.
Sei herzlich gegrüßt aus der schönsten Stadt der Welt.
Es geht mir blendend.
Ich habe in Peking die Schriftstellerin kennengelernt. Wir verstehen uns gut.
Ich lade sie an unsere Fakultät ein. Vielleicht wird ein Zyklus literaturwissenschaftlicher Vorlesungen daraus. Gruß an die Eltern, dich, den Gatten (den zweiten) und die Kinder (alle).
Sie stopft die Karte ins Handschuhfach. Auf dem Gehsteig trottet eine tschechische Mutter mit Kinderwagen, an der Hand ein weiteres Kind. Sie gehen im Schneckentempo, unterhalten sich. Wenig auf dieser Welt ist so erfrischend wie der Anblick einer Mutter mit Kind. Ihr erster Mann hat sie, Murmels Schwester, und das gemeinsame Kind von sich abgeschnitten; sie hat ihn angeschrien, er ist doch dein Sohn, du kannst nicht die Fliege machen, ihn im Stich lassen. Eine Erniedrigung, auf die sie nicht gefasst gewesen war. Eine Erniedrigung, die sie zugelassen hatte. Da hatte tatsächlich jemand eine dämonische Macht über sie gehabt. Wie peinlich. Die Scham des Opfers. Die Täter empfinden nie Scham. In ihrer Vorstellung gleicht ihr Exmann einem Gebieter, der sie nach Belieben quälen durfte. Wenn sie ihn brauchte, war er nicht zu erreichen; er hatte seine Telefonnummer gesperrt, das Nazischwein. Permanent sägte er an ihrem Selbstbewusstsein; verdrehte die Augen, wenn ihr unter seinem arroganten Blick vor Nervosität eine Erbse von der Gabel fiel. Ihr Exmann hatte ein Händchen für die Schwachstellen der anderen, er machte die anderen fertig, ließ fremde Energien in seine Adern fließen wie bei einer Transfusion. Jetzt wird sie bis zu ihrem Lebensende beim Gedanken an ihn die Augen verdrehen; der Weg aus der Dunkelheit ins Licht. Das Kappen der Nabelschnur von der Mutter und vom Exgatten dauert an, wenn meines Herrn Gefühl sich gespalten hat, warum soll ich – seine Frau – weiter hierbleiben?
Bei seiner zweiten Scheidung hat er sich gemeldet, als er die neuen Kinder und die neue Ehefrau wegen eines noch jüngeren Körpers verlassen hatte. Da klopfte er bei ihr an, mit dem Wunsch nach Unterhaltsminderung, aus wenig wollte er nichts machen, plötzlich appellierte er an ihr Mitgefühl. Üblicherweise beantragt man alle drei Jahre beim Gericht eine Unterhaltserhöhung, je größer die Kinder, desto größer die kindlichen Bedürfnisse; den Antrag hat sie nie gestellt, obwohl sie ein Recht dazu hätte. Er war schuld daran, dass sich Davids Gesundheit verschlechterte, weil er ihn vor Gericht zitiert hatte. Maßlose Erniedrigung. Als wäre der einzige Grund ihres Lebens, unter den Folgen seiner Lebensweise zu leiden. Die Folgen seiner Lebensweise bekommen immer andere ab. Es hört nie auf. Bei seinem langen Marsch durch die Welt greift er mit vollen Händen nach allem, was ihm gefällt, die herumliegenden Leichen fallen ihm nicht einmal auf. Interessanterweise kommt er damit immer wieder durch. Solche Stärke wird von der Gesellschaft goutiert. Ihre Stärke hingegen wird von der Gesellschaft argwöhnisch beäugt. Im Recht zu sein kann sich vor Gericht entschieden zum Nachteil entwickeln. Es geht um Stärke, so ist es doch.
Eine Zeit lang malte sie sich immer wieder eine Szene beim Scheidungsgericht aus. Während der gewiefte Anwalt ihres Exmannes mit Falkenschwingen begründet, warum das Unterhaltsgeld reduziert beziehungsweise annulliert werden müsse, hüstelt der Richter, verlegen, als wäre ihm das Ganze peinlich.
»Während meiner gesamten Laufbahn ist mir etwas Derartiges nicht untergekommen. Die Gegenseite will auf den gesamten Unterhalt verzichten. Dazu ist sie allerdings nicht berechtigt. Es geht schließlich um das Kind.«
Sie steht auf, beschirmt von ihrem neuen Namen und dem hervortretenden Bauch der frischen Schwangerschaft.
»Ich bin die jahrelangen Erniedrigungen, die Betteleien und Verletzungen leid. Der einzige Weg, dieses Konzentrationslager zu beenden, heißt zu verzichten. Sobald unser Sohn volljährig ist, können sich die beiden unter vier Augen einigen. Ich reiße mir den Granatsplitter aus dem Körper, der nach der Explosion in mir stecken geblieben ist. Alle weiteren Splitter will ich aber meiden, den beim Prozess abgefeuerten Wutgranaten aus dem Weg gehen, heute und später. Ich will nichts mehr von ihm. Dieser Mensch ist ab sofort ein Fremder für mich. Am schlimmsten war nicht, dass er so schrecklich böse wurde. Am schlimmsten war, dass auch ich plötzlich böse wurde. Das will ich nicht noch einmal erleben.«
Murmels Schwester verlangt, dass viertausend Zeugen des Lebens ihres Sohnes vorgeladen werden. Das sei ihr Recht.
»Ich habe ein Recht auf ein öffentliches Gerichtsverfahren. Es ist mein privater Prozess gegen die Verbrechen an der Menschlichkeit. Egal was zwischen ihm und mir gewesen ist. Als Mensch hat er für immer verloren, indem er seinen Sohn David schlecht behandelt hat.«
Murmels Schwester träumt vor sich hin. In ihrem Tagtraum geht die Tür des Gerichtssaals auf und ein großer Tiger schlendert herein. Und setzt sich neben sie.
Sie nimmt noch einmal die Ansichtskarte in die Hand. Den Namen der Schriftstellerin kennt sie. Ihre Bücher versteht sie nicht. In ihnen spielt die Sprache eine Rolle. Nicht die Handlung.
Vielleicht hat ihr Bruder eine chiffrierte Botschaft an sie geschickt.
Sie wird sich die Bücher nochmals vornehmen.
Die chinesische Mutter hüllt ihren Körper in teuerste Stoffe, um den Wert ihres Körpers zu betonen. Der Körper hat nur eine Tochter zur Welt gebracht. Hätte er einen Sohn geboren, hätte sie jetzt einen gehorsamen Fürsprecher, einen Beschützer in der verzweigten Familie und in der Welt. Die Tochter ist lediglich ein Abklatsch der Mutter; nicht einmal einen Hauch meiner Lotosschönheit hast du abbekommen, liebes Töchterchen. Werden Gehirn und Nervensystem mit falschen Informationen über die Außenwelt gefüttert, reagiert der Mensch wie ein vom Computer gesteuerter Roboter. Verformte Informationen fördern verformte Konzepte zutage. Die Reaktionen der heutigen Menschen bestehen aus verformten Konzepten. Die chinesische Mutter hält es für ihr persönliches und bürgerliches Versagen, keinen Sohn zur Welt gebracht zu haben. Die Schlinge der Zeit schmiegt sich um ihren Hals, die Uhr zeigt ihre Zeit an, und der Körper wird keinen Sohn mehr gebären.
»Gott, verzeih mir«, schreit sie wütend. »Es fehlt mir an Sohnestreue.«
Die Sohnestreue besteht nicht nur darin, dass junge Menschen die schwere Arbeit leisten, die geleistet werden muss, oder dass sie ihren Eltern zuallererst Essen und Wein anbieten; es geht um etwas unsagbar viel Höheres.
Das System bohrt sich in die intimste Privatsphäre hinein wie eine Mehlmottenraupe in einen Sack Mehl. Männer haben beschlossen, dass der Körper der chinesischen Mutter nur ein Kind zur Welt bringen durfte. Eine Folge der Ein-Kind-Politik ist die Frage an die himmlischen Mächte, warum Mütter ihre Töchter nicht respektieren. Alle Mütter Chinas protegieren ihre Söhne. Unter der Haut der Männer und Frauen stecken patriarchale Denkmuster. Die Ein-Kind-Politik zeigt, wie stark sich in einer patriarchalischen Gesellschaft das Leben der Geschlechter unterscheidet. Deswegen verlangt jedes seelische Phänomen nach männlicher und weiblicher Perspektive, auch Sprache und Literatur, sogar die Psychologie. Eine Frau ist ein Mensch. Aber das kommt für das Patriarchat nicht infrage. Ein Mann sieht sich als etwas Absolutes. Mehrere absolute Dinge nebeneinander, das geht nicht; eine Gleichberechtigung kann es nicht geben, nur einen absoluten Sieger. Die chinesische Mutter wurde von dieser Beschränkung geformt; persönliche Entwicklung und Selbstbewusstwerdung erfolgt nie im luftleeren Raum, außerhalb der Zeit oder des Systems. Die Zeit, in der ein Mensch heranwächst und reift, hat Einfluss auf seine Gedanken und seine Empfindungen. Die Erde vergisst die große Gruppe der Unumerziehbaren. In ihr haben sich weibliche Körper schon immer nach unerlaubtem Mutterdasein gesehnt und tun es bis heute. Sie bringen stummen Trotz zur Welt. Sie begreifen nicht, warum Überbevölkerung ein Problem sein sollte, wenn in anderen Ecken der Welt die Angst vor zu wenig Neugeborenen wächst. Europa und Japan sind erschrocken über ihre alternde Population; es stehen immer weniger Menschen im Arbeitsprozess, die die Generation ihrer Eltern ernähren könnten. Zur Ein-Kind-Politik gehören erzwungene Abtreibungen, das Töten von Neugeborenen, die Kontrolle der Körper. Kontrolle der schwächeren Körper. Eine Form der Erniedrigung: Der Staat stellt sich breitbeinig über einen Körper und entscheidet. Er reduziert unter Drohungen die Geburten, in dem einen Land. Wozu ist eine Gesellschaft fähig, wenn sie etwas so Intimes lenkt wie die Empfängnis?
In einem anderen Land verlangt der Staat unter Drohungen einen Geburtenanstieg und erlässt Antiabtreibungsgesetze, versüßt vom katholischen Obskurantismus wie zum Beispiel in Polen. Wann immer Unsicherheit und Angst in der Luft flattern, richten die Mächtigen die Aufmerksamkeit hin zu Territorien, die unter ihrer Kontrolle stehen. Das Territorium der mit einer Vagina ausgestatteten Körper. Angst treibt die Menschen in die Privatsphäre ihrer Häuschen zurück, die man Staaten nennt. Nationalismus gedeiht in Symbiose mit Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und patriarchaler Aufwallung. Nationalismus braucht Nationalisten. Schon wieder schrumpft das Leben einer Frau ein auf den Dienst an der Nation: der Nation möglichst viele Kinder schenken. Eine andere Aufgabe auf dieser Welt haben Frauen nicht, sie sind da, um sich zu reproduzieren. Die Nationalisten beanspruchen ihre Ehefrauen und Töchter für sich allein, als hätten sie brav Friedrich Nietzsche gelesen; in Liebesbeziehungen eine Niete wusste Nietzsche aber von einem Mittel gegen ehrgeizige Frauen; die Frau ist wie ein Mysterium, zu dem es eine Lösung gibt, und die Lösung heißt Schwangerschaft. Damit sich eine Frau freiwillig auf ihre Sklavenrolle einlässt, darf sie weder des Lesens noch des Schreibens kundig sein, und sie darf nicht denken. Da hat der Staat ein Problem. Wie schließt man heutzutage Frauen von der Bildung aus? Das Problem aller Diktatoren: Wie holt man die Menschen in die Sklaverei zurück? Der wichtigste Konflikt der Welt im einundzwanzigsten Jahrhundert wird nicht ein Konflikt zwischen Klassen oder Religionen sein, sondern der zwischen den Geschlechtern. Die westliche und die östliche Gesellschaft bewegen sich auf eine Erneuerung traditioneller sexistischer Werte und auf den Chauvinismus zu, sie richten sich ein in Gewalt und der irrigen Überzeugung von eigener Macht. Patriarchale Männer, heute noch in erdrückender Mehrheit vorhanden, kennen keine Selbstzweifel und haben eines gemeinsam: die Überzeugung, eine Frau habe dem Mann zu dienen und sich in Gehorsam zu üben. Das weibliche Glück laute: Er wünscht.
Die chinesische Mutter hat zweimal entbunden. Das zweite Mal heimlich. Sie hatte Granatapfelkerne geschluckt, Symbole der Fruchtbarkeit, und für Zwillinge gebetet, laut die Sutras rezitiert, auf dass sie zwei Söhne zur Welt bringen dürfe; eine begehrte, bewunderte Variante in einem Land, in dem es pro Familie nur ein staatlich bewilligtes Einzelkind geben darf; die Frauen können demonstrieren, so viel sie wollen, ein weiteres Kind erlaubt ihnen das Gesetz nicht, und im Buch der Lieder steht geschrieben: »Die Tugend ist leicht wie ein Flaum.« Ein Flaum aber gehört zur Erde. »Der hohe Himmel nährt alles Leben, ohne Laut, ohne Geruch.« Das ist das Allerhöchste.
Die chinesische Mutter pilgerte zum heiligen Berg Tai Shan, dem erhabenen Berg des Daoismus, dem Lieblingsort chinesischer Kaiser; am Fuße des Berges hatten sie ihre Tempel errichtet. Jahrhundertelang schlängelten sich kilometerlange kaiserliche Umzüge bis zum Gipfel; mit Pomp und Prunk ging es Schritt für Schritt auf den Himmel zu. Prächtige Feierlichkeiten feng (Opfer an den Himmel) und shan (Opfer an die Erde) wechselten sich ab. Heute sind dort Touristen unterwegs und bärtige Pilger. Jahrzehnte nach Maos kommunistischer Verfolgung sind der Daoismus und die Legende von den Acht Unsterblichen zurück. Die Vorstellung von Sittlichkeit geht sowohl auf Konfuzius als auch auf den Daoismus zurück, der Selbstgenügsamkeit forderte, Bescheidenheit, Verachtung irdischer Güter und Unterordnung unter die Gesetze der Natur. Auch andere Religionen werden wiedergeboren. Schmückt sich der Tiger aber mit einem Rosenkranz, ist die Frömmigkeit nicht echt; die Menschen bitten die Gottheiten in erster Linie um raschen Reichtum. Bienenstöcke säumen die Straßen; hingeworfene Schuhkartons.
Die chinesische Mutter betete zur daoistischen Gottheit Bixia Yuanjun, der Prinzessin der azurblauen Wolken; diese hilft kinderlosen Frauen, ein Kind zu empfangen. Sie betete nur für die Empfängnis eines Sohnes. Es gibt drei große Schicksalsschläge: in der Jugend den Tod des Vaters zu erleben, in den besten Jahren den Mann oder die Frau zu verlieren und im Alter ohne Sohn zu sein. Die chinesische Mutter versprach der Prinzessin der azurblauen Wolken, den erbetenen Sohn zur Macht zu erziehen, damit er dem legendären Herrscher Shun gleiche.
»Prinzessin der azurblauen Wolken, ich weiß, es gibt drei legendäre Herrscher, Yao, Shun und Yu. Aber seit meiner Kindheit wohnt Shun in meinem Herzen, das Vorbild der Sohnestreue und Demut. Er war erst zwanzig Jahre alt, als der Kaiser Yao ihn zu sich erhob, ihn mit seinen zwei Töchtern vermählte und ihn anstelle seines missratenen Sohnes zu seinem Nachfolger machte. Sollte ich Zwillinge bekommen, einen Sohn und eine Tochter, opfere ich dir die Tochter.«
Die zweite Geburt verläuft schweigsam und geheim. Schon wieder eine Tochter. Ein Groll gegen die launische Prinzessin der azurblauen Wolken erfasst die chinesische Mutter, aber sie tötet die Tochter nicht. Sie bringt das Neugeborene zu einer fremden Familie aufs Land, dort fällt ein Kind mehr nicht auf. Gibt der Familie Geld, das Kind bekommt gefälschte Dokumente, eine neue Identität und das Leben eines Bettlers ohne linken Arm. China hat offiziell anderthalb Milliarden Einwohner, inoffiziell aber etwa fünfzig Millionen Herzen und Nierenpaare mehr. Viele Frauen haben heimlich weitere Kinder bekommen. Jede Familie hängt von den Kindern ab und sehnt sich nach einem Jungen; inoffizielle Kinder werden von ihren Eltern aus der Stadt aufs Land gebracht und später mit falschen Papieren ausgestattet, die kindlichen Körper wachsen in Arbeitslagern auf, Fabriken genannt, dort schnappen sie Luft auf dem Hof zwischen rostigen Drähten.
Von ihrer zweiten Tochter hat die chinesische Mutter nie wieder gehört, und dabei sollte es bleiben.
Es wäre ein Leichtes gewesen, sie zu töten, auf die Schutthalde zu werfen, in die Mülltonne oder auf die Straße. Keiner hätte sich gewundert. So etwas passiert täglich.
Eine Strafe für das Vergehen, ein zweites Kind geboren zu haben, hat die chinesische Mutter nicht riskieren wollen.
Hätte sie einen Sohn bekommen, hätte sie alles riskiert.
Hätte sie einen Sohn bekommen, hätte sie die erstgeborene Tochter sogar umgebracht. Der Sohn, nach dem sie sich so verzweifelt sehnte und immer noch sehnt, würde sich um sie kümmern. Während der zweiten Schwangerschaft hat sie sich ausgemalt, auf welche Art und Weise sie die zweijährige Tochter loswerden, wie sie die Fesseln kappen würde, die das Leben legt. Sie hat das Recht auf einen treuen Sohn, wenn sie schon mit einem Mann leben muss, den ihr die Mutter ausgesucht hat. Sie hätte in der Jugend ihre Siebensachen packen sollen und mit ihrem heimlichen Lover verschwinden; der hätte ihr einen Sohn geschenkt. Sie ist aber nicht weggerannt; hat ihrer Mutter und ihren Heilkräutern gehorcht. Einsam und nackt schrie sie, bis ihr die Stimmbänder rissen, sie wolle keinen Parteiauftrag heiraten, sie möchte Liebe! Taubes Geschrei der Verzweiflung, nur die nächste Vagina purzelt aus ihr heraus und in der Nacktheit die ewigen Worte des Dichters Tschen Ngo.
Du Lotosblüte, deine grüne Haube
tauchst du ins Wasser, wenn der Wind weht,
doch rot und nackt zeigst du dich,
wenn du sicher bist: keiner schaut zu.
Die Tochter ohne einen Hauch von Lotosschönheit ist schon erwachsen. Sie haben eine gute Partie für sie gefunden. Nicht die erträumte Diamantpartie. Aber der Verlobte ist bemüht und wird es weit bringen. Ehepaare, die jeweils als Einzelkinder aufgewachsen sind, dürfen schon zwei Kinder haben. Die chinesische Mutter wird zwei Enkelsöhne bekommen.
Von ihrer Tochter hält sie nicht furchtbar viel; sie kann sie nicht lesen. Die chinesische Mutter fürchtet, ihre Tochter lässt sich von keinem beherrschen. Lange Jahre ist die Mutter auf den Berg Tai Shan gepilgert, lange Fußmärsche hat sie auf sich genommen. Stunden- und jahrelang bat sie den Himmel aus Blei um einen Sohn. Wer den Berg Tai Shan bezwingt, wird hundert Jahre alt. Die chinesische Mutter wird tausend Jahre alt.
Der Schlafrhythmus der Schriftstellerin ist hin, und auf ihrem Tisch liegen die Vier Schätze des Gelehrtenzimmers: Pinsel, Tusche, Reibstein, Papier oder Seide. Sie schreibt Sätze aus Pommerantschs tausendjähriger Fibel ab: Menschlichkeit gehört zum Menschsein! Ihre Größe hängt von der Liebe zu unseren Nächsten ab. Gerechtigkeit ist das Bewusstsein für das richtige Tun. Ihre Größe hängt vom Respekt vor der Weisheit ab. In der Abstufung der Liebe zu den Nächsten und in der Bemessung des Respekts vor der Weisheit liegen die Riten begründet.
Wie sah die Welt aus, bevor Papier erfunden wurde? Buddhismus und die Sutras, einundachtzig Blatt, dreizehn Jahrhunderte vor dem Buchdruck. Papier, der größte Schatz der Bibliothek von Alexandria, noch seltener als Pyramiden. Dem Wort Papier haftet heute der durchdringende und liebliche Duft von Banknoten an, frisch und raschelnd. Allen läuft das Wasser im Mund zusammen.
Die Schriftstellerin macht jeden Morgen achtmal den Sonnengruß und die Acht Brokate.
Sie übt den Gruß an die Sonne, die im Smog unsichtbar bleibt.
Sie macht ihre Übungen und denkt an den Freund. Menschlichkeit gehört zum Menschsein. Eine charakteristische Definition von altchinesischen Philosophen. Der Freund zitiert ständig altchinesische Philosophen. Die amerikanische Studentin interessiert sich nicht für Politik, und der Freund sagt, man könne sich nicht nicht interessieren. Auf die Frage, was Politik denn überhaupt sei, sagt er lakonisch, Politik bedeute Korrektur. Der Freund wiederholt häufig Sätze aus Konfuzius’ Gesprächen. Spricht man aber die Schlüsselworte mit heutigem Akzent aus, werden die Sätze unverständlich. Zheng heißt zheng. Den Freund scheint das nicht zu beeindrucken, und erst Murmel erklärt der Schriftstellerin, dass die rhetorische Wirkung von Konfuzius’ Sätzen in ihrer ideographischen Fassung liegt; man müsse die Schriftzeichen sehen. Eine typisch chinesische Auffassung von Etymologie. Sie verweist metaphorisch auf den aussagekräftigen Kern eines Schriftzeichens.
Die Schriftstellerin atmet Rauchwolken aus und schickt sie zum dreckigen Himmel. In ihrem Kopf erklingt eine Katzenstimme, Gott wird nicht helfen, und dafür hat er wohl gute Gründe. Wie lässt man sich von der Zeit beeinflussen, in der man lebt? Gut oder schlecht? Wie viel verträgt wer? Wie viel Leid vertragen sensitive Menschen bei ihrem Versuch, die hiesige, noch nie dagewesene Gesellschaftsform zu demaskieren: diese Mischung aus doktrinärem Sozialismus und zynischem Materialismus?
Das individuelle Schicksal ist mit dem Universum verknüpft und spielt sich unter dem Einfluss der Zeit ab. Vielleicht nahm sich Virginia Woolf auch wegen des Zweiten Weltkriegs das Leben, um die Ohnmacht zu ertränken, an der sie erstickte. Vielleicht tötete sich Prinz Rudolf, der Kronprinz von Österreich und Ungarn, weil ihm das unabwendbare Ende der Habsburger Monarchie bewusst wurde und er die Ohnmacht, die sein Herz in Beschlag genommen hatte, einfach wegpusten wollte. Besser als in Scham zu versinken und zu warten. Gibt es auch in diesem Land Menschen, die das unabwendbare Ende in der Luft spüren? In einem Land, wo schon als Dissident gilt, wer nur eine andere Meinung vertritt?
Blubberndes Wasser, in dem wir alle ertrinken werden. Zheng heißt zheng.
Es gibt viele Möglichkeiten ein Wort auszusprechen. Es kommt auf die Intonation an. Mit steigender oder fallender Stimme ändert sich die Wortbedeutung.
wēn = warm
wén = hören
wěn = küssen
wèn = fragen
Die Luft ist stickig. Die Schriftstellerin setzt eine weiße Stoffmaske auf.
Sie setzt eine Sauerstoffmaske auf.
Hinter dem Stacheldraht wartet lächelnd die junge Chinesin auf sie. Sie machen einen Ausflug.
Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gab es einen herrlichen, sonnigen Tag. Die Menschen kosteten ihn aus wie einen Lutscher. Beim Spazierengehen, Bootfahren, Verweilen in blühenden Parkanlagen der Städte. Hinter der nächsten Ecke schrien die zum Schlachthaus geschleiften Schweine.
Die chinesische Mutter setzt sie außerhalb der Stadt Peking im Gebirgskurort Chengde ab. Kaiser Kangxi hatte sich das Städtchen als seine Sommerresidenz erwählt, um der drückenden Hitze in der Verbotenen Stadt zu entfliehen. Übrigens derselbe Kaiser, der die Jesuiten, unter ihnen Karel Slavíček, nach Peking eingeladen hatte. Auch in Prag herrschte im letzten Sommer eine drückende Hitze; Trinkwasser durfte nicht mehr zum Blumengießen oder Autowaschen verwendet werden. Die Menschen kamen von der Arbeit nach Hause, wässerten die staubigen Gartenbeete und wuschen ihre Autos. Die Kriege der Zukunft werden auch um Wasser geführt. Abends hörten sich die von der unerhörten Hitze geplagten Körper die laienhaften Erklärungen eines ehemaligen Präsidenten über die nicht existierende Klimaveränderung und globale Erwärmung an, und schenkten ihm weiterhin ihren Glauben.
Der Park im Flusstal liegt mitten in den Bergen. Die standhaften Mandschu betrieben an diesem strategisch sicheren Ort Jagd und Kampfsport. Die Schriftstellerin kauft sich am Souvenirstand einen gelben Fächer mit Kranichen.
Der Kranich, ein heiliger und erhabener Vogel, ist das Symbol für ein langes Leben, Weisheit, das Alter und die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Das rote Gefieder auf seinem Kopf erinnert an Feuer und Sonne.
Der gelbe Fächer vertreibt die Hitze, und der Kranich schwingt seine Flügel zwischen bewusstem Leben und bewusstem Tod.
Die Schriftstellerin weigert sich, im Schnellschritt und an einem einzigen Tag alle acht Außentempel zu besichtigen. Auf Konversation verzichten will sie aber nicht. Sie stellt der jungen Chinesin Fragen nach dem Anwalt mit dem bleiernen Armreif, nach der inhaftieren Frau mit den Puppenfotos, nach Städten und Dörfern außerhalb des besuchten Areals. Die junge Chinesin kichert oder tut, als verstünde sie nichts. Für eine einfachere Kommunikation mit der Welt hat sie sich einen lautlich ähnlichen, leichter auszusprechenden Namen ausgesucht. Sobald die Fragen Politik oder Religion betreffen, hört sie nichts. Sie möchte das Gesicht nicht verlieren.
Die Schriftstellerin bewundert den unerschütterlichen Zusammenhalt chinesischer Familien. Das Wort Familie hat dort eine andere Bedeutung, ist Teil der Tradition. Spürt das Kind keinen Zusammenhalt und keine Liebe um sich, verliert es sein Grundvertrauen in die Welt. Es verliert das Selbstbewusstsein, das pure Leben, Wasser rinnt ihm aus der hohlen Hand. Das chinesische Kind hat einen Hof um sich, von dem es umhegt, gelehrt, eingeweiht und versorgt wird. Die chinesischen Eltern wünschen sich, dass ihr Kind an einer namhaften ausländischen Universität studiert, Harvard, Yale, Princeton, einen Titel erwirbt, zurückkommt und eine lukrative Stelle findet. Der junge Kaiser oder die junge Kaiserin wird dann den Familienhof versorgen.
Wie es wohl sein muss, in China als Waisenkind zu leben?
Wie es wohl sein muss, in Tschechien als Waisenkind zu leben?
Die junge Chinesin erfüllt die Wünsche ihrer Eltern. Das Zepter hält die Mama in der Hand: Sie verdient mehr. Die junge Chinesin studiert hingebungsvoll Medizin. Alles hängt von der Studentin ab, sie ist zu maximaler Selbstdisziplin verpflichtet. Sie hat ihren Ausdruck zu kultivieren, die Beständigkeit eigener Wertschätzung zu vertiefen und somit zu Frieden und Harmonie überall unter dem Himmel beizutragen. Auf diese Weise hatte Konfuzius sein Anliegen, den Menschen eine Richtung zu geben, bis zum Äußersten präzisiert. Darf ein Student sein Studium betreiben, ohne ihm sein ganzes Herz und jeden seiner Gedanken zu schenken?
Der Körper der Schriftstellerin eilt in raschem Tempo voran, in Vorfreude auf den langen Marsch. Die junge Chinesin ringt nach Luft und hustet. Sie schaffen nur einen bescheidenen Teil des imposanten Areals. Der größte Tempel der Anlage, der Putuo-Zongcheng-Tempel, erinnert an den Potala-Palast in Lhasa und beherbergt eine Ausstellung mit tibetischem Religionsschmuck, tibetischen Rollbildern Thangka und zwei Pagoden-Modellen.
Die Schriftstellerin läuft auf den Spuren der Toten und denkt an die Vibrationen der Lebenden. Sie hat zu wenig geschlafen. Das Schneckentempo der jungen Chinesin ist ihr lästig, die Touristenmengen nerven sie, die Gedanken an Karel Slavíček ermüden sie; sie hat dem Freund vollmundig versprochen, sie würde mit Tusche einen Essay über Slavíček schreiben. Und darüber, wie China im achtzehnten Jahrhundert als Inspiration für das Rokoko diente und wie der konfuzianische Rationalismus den Aufklärer Voltaire inspirierte. Der missionierende tschechische Jesuit verfasste Briefe. Epistel aus China. Im wissenschaftlichen Bereich, vor allem auf dem Gebiet der Astronomie und Mathematik absolut vertrauenswürdig. Aber was seine Legenden über die Sun-Familie betrifft, bleibt die Schriftstellerin misstrauisch. Hat er seine Helden nicht eher zu Heiligen stilisiert? Auf Bestellung seiner Kirchenvorgesetzten sozusagen?
Die junge Chinesin schlägt außer Atem vor, sie könnten sich zu den schreienden Touristenhorden im Minibus gesellen.
Nein, nein, zu Fuß. Schritt für Schritt. Die junge Chinesin ringt nach smoggesättigter Luft, am Ende nehmen sie ein Taxi. Die restlichen Tempel, inklusive Pule Si, den Tempel des Allgemeinen Glücks mit doppeltem rundem Dach und gelben Dachfliesen, besichtigen sie schon aus dem Wagen. Die junge Chinesin hakt in Gedanken Mamas Aufgabenliste ab, die ist der einzige Grund, warum sie ihren Körper hinter dem der Schriftstellerin herschleppt. Die Schriftstellerin hakt die verhasste Liste fremder Hausaufgaben ab und weiß nicht, warum sie dort ihren Körper gemeinsam mit der jungen Chinesin herumschleppen muss; sie war ja schon öfter in Chengde. Weil der Kaiser Kangxi Karel Slavíček kannte? Weil der Jesuit Slavíček der erste Tscheche war, der über China berichtete? Weil sie die chinesische Mutter an der Nase herumführen will, um den Freund zu schützen?
Die Schriftstellerin spürt eine sanfte seidige Berührung an ihrer Wade, als streifte sie die Flanke einer orangegelben Katze; sie möge die junge Chinesin nicht in Verlegenheit bringen und ihr eine Pause gönnen. Schon gut; die Schriftstellerin stellt nur Fragen zur Geschichte, die Antworten kennt sie allerdings selbst. Die junge Chinesin wirft in fröhlich klingendem Englisch den Leierkasten an.
»Kaiser Kangxi war der zweite Kaiser der Dynastie Qing. Von 1661 bis 1722 herrschte er von Peking aus und blieb einundsechzig Jahre an der Macht. Am längsten von allen Herrschern Chinas. Im Vergleich zu den anderen wird er für Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Gewissenhaftigkeit gefeiert. Während seiner Ära wurde das Reich immer größer und reicher, überall breiteten sich Frieden und Prosperität aus. Er belegte die Landwirte nicht mit unnötig hohen Steuern. Er war ein ausgezeichneter Kriegsführer und Kunstmäzen, und er lud jesuitische Gelehrte an den chinesischen Kaiserhof.«
»Karel Slavíček.«
»Ja. Deswegen hat uns Mama hierhergeschickt. Nach ihm hat sein Sohn Yongzheng auf dem Thron Platz genommen und dann sein Enkelsohn Qianlong. Der Enkel verehrte den Großvater so sehr, dass er nach sechzig Regierungsjahren lieber zurücktrat. Er wollte nicht länger als sein Großvater an der Macht bleiben.«
Dass der Enkel den Tempel Xumifushouzhimiao in Chengde nur deswegen bauen ließ, um 1780 während der Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag den Penchen Lama zu beeindrucken, findet die Schriftstellerin hanebüchen. Ihre Empörung teilt sie der jungen Chinesin mit. Die kichert verständnislos.
»Er war doch Kaiser.«
Am Ende des Tages begleitet die junge Chinesin die Schriftstellerin bis zum Eingangstor der Botschaft. Die Schriftstellerin begreift, dass man ihr nicht glaubt, obwohl sie in der Botschaft übernachtet. Keiner glaubt keinem. Familiärer Zusammenhalt? Kinder glauben ihren Eltern nicht, Eltern glauben ihren Kindern nicht. Während der Kulturrevolution zeigten Kinder ihre Eltern an.
»In ein paar Tagen ziehe ich in die Wohnung des Freundes.«
»Kennen Sie ihn schon lange?«
»Sehr lange.«
»Wie haben Sie sich kennengelernt?«
»Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her.«
»Und wo haben Sie sich kennengelernt?«
»Auf Reisen.«
»Wie ist er? Kommen viele Menschen bei ihm zusammen? Welche?«
Die Schriftstellerin ignoriert das Poltern der Walnüsse und bittet die junge Chinesin, kurz zu warten, sie habe ein Geschenk für sie; sie habe leider keine Zeit für weitere Ausflüge. Sie überreicht ihr einen Stapel ins Chinesische übersetzter Bücher. Im Chinesischen verweist jedes Wort auf eine andere Wirklichkeit, und je nachdem wie es geschrieben wird, trägt es mehrere Bedeutungen in sich. Die Schriftstellerin verneigt sich. Sie hat sich eine Provokation nicht verkneifen können, sie überreicht Sprengstoff; unter den Büchern befindet sich auch Havels Essay über die Macht der Machtlosen. Die junge Chinesin setzt eine neue Miene auf, als hätte sie sich in einem Theater von der Maskenbildnerin das Gesicht mit Hautfarbe übertünchen lassen. Die Miene reizvoller Vertraulichkeit. Eine Falle.
»Gerne sehe ich mir die Bücher an. Zusammen mit meinem Verlobten. Er arbeitet in der gleichen Firma wie der verehrte Herr Programmierer. Nächstes Jahr heiraten wir. Wenn Sie möchten, können wir die Bücher gemeinsam mit Ihnen studieren. Ihre Meinung hören. Mama würde sich freuen. Sie bewundert ihr Land, auch ich lerne Tschechisch.«
Die Schriftstellerin lässt sich von dem absurden Wunsch nicht beeindrucken. Sie umarmt die junge Chinesin nicht.
Sie sieht der schlanken Taille nach. Im Buch der Lieder heißt es:
Ich liebe deine leuchtende Tugend,
ohne laute Stimme, ohne strenge Miene …
Und Konfuzius sagte: Eine laute Stimme und eine strenge Miene sind das Letzte, wovon sich ein Volk beeindrucken lässt.
Der Programmierer durchblickt das chinesische Durcheinander immer noch nicht. Er kann die Tyrannei der kleinen Despoten, seiner Vorgesetzten, nicht begreifen; jeder von ihnen ist als verhätscheltes Einzelkind groß geworden. Er läuft seinen chinesischen Marathon und schafft das Tempo nicht; in Gedanken fängt er allmählich an, sich an die Rückkehr zu klammern. An die Rückkehr nach Hause.
Er vermisst Schnee. Mamas Hefezopf und Weihnachtsgebäck. Den harzigen Kiefernduft. Die böhmischen Dörfer und Kneipen, das Witzeln beim Bier. Er vermisst die Bilder von Josef Lada, die Stimme von Karel Gott, die Knödel und all die schweren, eingedickten Saucen; Tomaten-, Dill-, Gurken-, Sahnesauce. Gepökelte Schweinshaxe mit Meerrettich, Bauchspeck, Leberwurst, Presswurst, sauer eingelegte Würstchen mit Zwiebeln, marinierter Hermelín-Käse, Olmützer Quargel. Er vermisst den Blaubeer- und Streuselkuchen, die Bublanina, die herbstlichen Zuckerrübchen im Teigmantel. Er vermisst den Humor vom Theater Sklep, von der Kunstfigur Jára da Cimrman. Er vermisst Eishockey und Fußball. Er vermisst das überschaubare Spektrum an kleinen Sicherheiten, jeder Fluss hat seine Quelle, jeder Baum seine Wurzel. Die Rückkehr nach Hause.
Er will hoch hinaus und findet es befremdlich, dass sich alle von ihm eroberten vermeintlich höheren Kreise lediglich als Grüppchen im freien Umkreis einer anderen, dem Zentrum näheren Wohlstandsgruppe entpuppen. Er muss an Türen klopfen, und auch wenn sie sich wie durch ein Wunder öffnen, entscheidet doch wieder nur eine Einzelclique, deren Mitglieder ihrerseits unbarmherzig von einem anderen Auserwähltenkreis eine Ebene höher gedrängt werden. Pyramidenähnliche Aufeinanderschichtung unendlich vieler Kreise. Er wollte auf den Gipfel, zur glücklichen und reichsten Elite gehören, die nicht klotzen muss; nicht jeder, der viel Geld verdient, muss auch klotzen, und nicht jeder, der klotzt, verdient viel Geld.
Sein Wunsch nach Rückkehr entsteht genau dann, als seine Frau auf ihrer Arbeit befördert wird. Er sieht sie an und fragt sich, wie er sie je hat heiraten können. Seit der Hochzeit hat sie mindestens vierzehn Kilo zugenommen. Die Frau des Programmierers! Das war Absicht, um ihn in den Augen seiner Kollegen zu demütigen. Die haben alle schlanke chinesische Gattinnenkörper an ihrer Seite.
Früher in Prag hatte er Angst vor Stunden, in denen er nicht einschlafen konnte. Verstört registrierte er das spitze Trommeln seines Herzens und das Herumwälzen des dicht neben ihm liegenden Körpers.
In Peking wiederum kann er es kaum abwarten, ins Bett zu kommen. Er verdächtigt den Verlobten, hinter seinem Rücken über seine Ehe herzuziehen. Seine Frau ist keine gute Hausfrau. Auch keine gute Schwiegertochter. Sie ist keine gute Köchin. Und keine gute Mutter ihrer gemeinsamen Tochter. Sie hat ihm keinen Sohn geschenkt.
Der Anblick ihrer blondierten Haare macht ihn rasend, in Wirklichkeit sind sie honigfarben, aber das weiß niemand. Der Anblick ihrer gerupften, dünn nachgezogenen Augenbrauen macht ihn rasend. Er kommt so müde von der Arbeit nach Hause, dass er sich nicht einmal damit aufhält sich auszuziehen. Der Schlaf ist wie ein Abgrund. Sein Unterbewusstsein wird vom durchdringenden Geschrei der Blauelster bedrängt. Er schmiegt sich in den Schlaf. Fällt hinein. Wie vom Schwert geköpft.
Sein Körper sehnt sich nach der Ohnmacht.
Er schläft. Olivie hat Angst, er könnte eines Tages aufwachen und feststellen, dass er sich sein Leben anders vorgestellt hat. Dann wäre nämlich klar, wer dafür zu büßen hätte. Sie.
Der Programmierer hat keine Energie. Jede Aufgabe sieht unerfüllbar aus. Auch wenn er eine Arbeit abschließt, kann er sich nicht über Lob freuen; er ist verstimmt und schlapp. Er knabbert ein neues Peking-Jahr an. Die Chinesen können nicht zwei Informationen auf einmal verarbeiten, er muss sie ihnen in kleineren Portionen servieren. Sie sind es gewohnt Befehle auszuführen, aber nicht gewohnt nachzudenken. Zu planen ist unmöglich. Der amerikanische, eigentlich chinesische Traum des Programmierers sackt allmählich in sich zusammen. Er wird nicht mehr als frisches Gehirn aus dem Westen betrachtet. Man weiß, sein Gehirn stammt aus Osteuropa, aus dem verschnarchten Teil Europas; die Chinesen haben bloß nach einem Schlitz gesucht, um in den westlichen Teil zu gelangen.
Die Chinesen geben vor den Tschechen an.
Die Tschechen geben vor den Chinesen an.
Die Chinesen haben von den Europäern die ausgefeilte Taktik der zwei Gesichter übernommen. Rundliche, lustige Männlein, die ständig lachen. Oft gönnen sie ihrem Gesicht eine Pause. Die strahlend gute Laune wird gestoppt, mit kleiner Verzögerung schwindet auch das Lächeln dahin. Als wohnten jedem Körper zwei Menschen inne. Der Programmierer kann den Grad des Kollektivdenkens immer noch nicht nachvollziehen. Die kollektive Dimension des Denkens ist hier unterschiedlich ausgeprägt. Der Einzelne wird vom Rhythmus des Konsums und der Geisterstunden absorbiert, in denen er tut, als arbeitete er. Den Programmierer widert die Vorstellung der Chinesen an, sie könnten sich Europa um den Finger wickeln, die nächsten Jahrhunderte auf dem hohen Ross sitzen und alles nur nach ihrem Gusto machen.
Die Karriere des Programmierers stagniert. Ohnmächtig sieht er zu, wie er von weniger gut ausgebildeten, aber sehr ambitionierten jungen Kollegen überrollt wird. Einer von ihnen ist ein ehemaliger Hacker, der aus seiner Vergangenheit keinen Hehl macht. Diese Generation interessiert sich nicht für Marihuana, Alkohol, LSD, Heroin. Diese Generation interessiert sich für Stoffe, die ihre Leistung und ihr Fortkommen verstärken. Energetische Getränke, Amphetamine, Speed, Kokain. In China wird Kokain auch Kindern vor wichtigen Prüfungen gereicht. Wenn der Programmierer erneute Überstunden am Wochenende ablehnt, lächelt der Verlobte nur.
»Ich verstehe nein nicht als Antwort. Nein ist keine Antwort. Entschlossenheit ist alles.«
Früher war der Programmierer stolz. Er half die Welt mit perfekten Rechnern zu bestücken. Jetzt weiß er nichts mehr. Er ist wirklich ratlos. Beängstigende Gedanken suchen ihn heim. Auf einmal scheint das Altern auch ihn zu betreffen, das verblüfft ihn. Seine Seele wird ergriffen von der düsteren Vorahnung dahinschwindender Tage, heranrückenden Verfalls. Nichts ändert sich, nichts bessert sich. Bloß älter wird er. Zum achtundvierzigsten Geburtstag knallt ihm der Verlobte vor versammelter Mannschaft einen Spruch vor die Füße: Mit siebzehn, achtzehn sei der Mensch noch zu jung, mit siebenundzwanzig, achtundzwanzig habe er das richtige Alter erreicht, mit siebenunddreißig, achtunddreißig sei er reif, und mit siebenundvierzig, achtundvierzig bräuchte er seine Energie nicht auf die verbleibenden zwei Lebensjahre zu vergeuden.
Am Schreibtisch kommt er sich wie ein eingesperrter Tiger vor. Manchmal explodiert er, wird hysterisch, verhält sich unberechenbar und versteht sich selbst nicht; er blättert sogar im Konfuzius. Er bestückt die Welt mit Computern, ohne zu ahnen oder beeinflussen zu können, was sie mit der menschlichen Seele anrichten. Mit der menschlichen Gesellschaft. Versklaven sie die Menschheit oder befreien sie sie? Bewahren sie sie vor der Apokalypse oder bringen sie diese im Gegenteil eher näher? Ohnehin sind die Megamaschinerien, in denen alle sich abstrampeln, nicht für den Menschen gemacht. Dass es sich dabei einerseits um den gewinnorientierten und besser funktionierenden Kapitalismus von heute und andererseits um den verlustorientierten und schlechter funktionierenden Sozialismus von gestern handelt, findet er so gesehen zweitrangig. Auch aus chinesischer Perspektive ist es zweitrangig. Die chinesische Gesellschaft ist sowohl sozialistisch als auch kapitalistisch. Das Gehirn des Programmierers raucht. Hat man sich einmal für Gewinn auf Kosten der Gerechtigkeit entschieden, kriegt man den Hals nicht voll, bis man sich alles zusammengestohlen und -geklaut hat; schon Konfuzius wusste das, aber der Programmierer hat nicht vor, sich auch darüber noch den Kopf zu zerbrechen.
Er passt sich an, Korruption ist ihm nicht fremd. Nicht einmal offensichtliche, in die Augen springende Korruption. Oder Korruption feiner Andeutungen, das Firmen-Tai-Chi. Die Korruption gedeiht entsprechend dem Milieu, am besten in der Provinz; in der Stadt Peking und in der Stadt Prag lieber buddhistischer Mönch sein, auf dem Lande Mandarin. Ein weltweites Spiel, erquickende Sportart, perlende Luftblasen im Sektglas. Stille Post des Gewinns; wie du mir, so ich dir. Korruption ist eine Meereswelle, wer mit ihr schwimmt, bleibt oben. Wer sich ziert, ertrinkt.
Aber in China hat das Spiel andere Regeln. Hier wird anders gespielt.
Der Programmierer schafft es nicht, die Regeln zu knacken. Oder sie wenigstens nachzuvollziehen. Korruption und Wohlstand verlaufen in China mittels komplizierter Hierarchien, und deren Ausmaße sind riesig; wer mit Beamten verkehrt, der wird arm. Dabei hatte der Vater Recht, je größer der Kuchen, desto mehr Krümel. Die Korruption heißt hierzulande nicht Korruption.
Groß, größer, Čína: CHINA.
Menzius war ein Nachfolger von Konfuzius. Er besuchte den König Hui von Liang. Der König empfing ihn mit folgenden Worten: »Meister, wenn es Ihnen nicht zu weit war, Tausende von Meilen hierher zurückzulegen, dann haben Sie sicherlich auch einen Rat für mich, um meinem Reich zu nützen.«
Menzius antwortete: »Warum gleich vom Nutzen reden, oh König? Würden Menschlichkeit und Recht nicht genügen? Denn wenn der König fragt, welchen Nutzen bringst du meinem Reich, fragen die Würdenträger, welchen Nutzen bringst du meiner Familie, und entsprechend fragen die einfachen Menschen, welchen Nutzen bringst du mir? Die da oben und die da unten bemühen sich, gegenseitig den Nutzen abzuringen, und das Reich gerät sofort in Gefahr! Wer in einem Reich von zehntausend Streitwagen den König umzubringen wagt, der muss sicher einer Familie entstammen, die über tausend Streitwagen verfügt; wer in einem Reich mit tausend Streitwagen den König umzubringen wagt, der muss sicher einer Familie entstammen, die über hundert Streitwagen verfügt. Von zehntausend Streitwagen tausend zu besitzen, von tausend Streitwagen hundert zu besitzen, das ist an sich schon keine geringe Macht. Es ist aber noch nie vorgekommen, dass ein liebevoller Sohn seine Eltern im Stich lässt oder ein pflichttreuer Diener seinen Herrn vernachlässigt. Sehen Sie, König, Menschlichkeit und Recht, mehr braucht man nicht! Warum gleich vom Nutzen reden, oh König?«
Der Freund ist in der Lage, die Wirklichkeit genau wahrzunehmen und unverfälschte, originale Dinge und Taten von den unechten und falschen zu unterscheiden. Er weigert sich, Pauschalbilder zu übernehmen, die der Westen vom Osten hat und der Osten vom Westen. Vorurteile sind ihm fremd.
Die junge Chinesin hat nach ihm gefragt, und seitdem überlegt die Schriftstellerin, wie sie ihn beschreiben sollte. Ihn zu beschreiben heißt, Sätze wie kalte Nudeln über die Brücke tragen. Nur Pommerantsch könnte sie mit heißer Bouillon seines Wissens erwärmen. Auch in Zeiten allgemeiner Apathie und Resignation gelingt es dem Freund, den Prozess der zivilen Wiederaufrichtung in Schwung zu bringen. Eine sehr kleinteilige Arbeit, geeignet für einen Don Quijote. Dem Bürger tut es aber manchmal gut, Mut zu zeigen. Der Freund nimmt die mysteriöse Mehrdeutigkeit des menschlichen Handelns im totalitären System wahr, und das können nur wenige Menschen. Die Fachwelt würde ihn vermutlich als ein selbstaktualisiertes Individuum bezeichnen. Er ist problemorientiert und versteht widrige Umstände im Leben als etwas, das nach einer Lösung verlangt. Nicht als unlösbare Schwierigkeiten oder Schicksalsschläge also. Er ist unabhängig. Akzeptiert sich selbst und die anderen so, wie sie sind. Er ist spontan und kreativ. Seine Einstellung zur Realität ist einfach und unkompliziert. Sein Humor nicht verletzend. Seine Moralbegriffe sind fest umrissen, und er besitzt etwas, wofür Alfred Adler den Begriff Sozialgefühl prägte: das Gefühl, mit anderen Menschen eine Gemeinschaft zu bilden, das Interesse an deren Weiterentwicklung und Wohlbefinden. Sein Sozialgefühl zeigt sich an solchen Charaktereigenschaften wie Respekt vor anderen, Demut und Mitleid, im weitesten Sinne an seiner Mitmenschlichkeit. Der Freund gehört zu der neuen Generation der Opposition, der globalisierten. Er ist kein Doktor Faustus und gibt dem Teufel keine Chance.
»Der Freund ist unumerziehbar. Er versöhnt mich mit der Welt.« Mehr sagt die Schriftstellerin nicht zu der jungen Chinesin.
Die einzige Beziehung unter Gleichen ist die Beziehung zweier Freunde.
Am vierten Tag des Monats Juni, dem Jahrestag des Massakers am Tiananmen, finden am gesamten Platz des Himmlischen Friedens Kontrollen statt wie am Flughafen, im Laufe der Nacht schossen dort pfiffige Absperrungen aus dem Boden; 2014 war ein Auto mit Sprengstoff auf den Platz gefahren. Zwischen den Absperrungen schlendern seelenruhig Horden hübscher Geheimpolizisten in Zivil und wärmen Walnüsse in ihrer Hand.
Die geschützte Ecke in der Sackgasse des Hutongs gleicht einer Festung. Der Freund hat sich dort mit seinem chinesischen Partner eine Parallelwelt aufgebaut. Es leben auch zwei Kater da, Mansur und der unsterbliche Pommerantsch.
Vergeblich rätselt der Freund, was los ist mit Pommerantsch. Normalerweise hält er sich zurück wie ein stolzer und nicht zu domestizierender Löwe, wenn er nicht gar wie eine stille, dekorative Statue sitzen bleibt. Aber beim Anblick der Schriftstellerin schnurrt er so freudig, als hätte er einen hysterischen Anfall erlitten. Kokett reibt er sich an ihren Knien, lässt sich vor ihren Füßen fallen und bleibt dort liegen. Oder er platziert sich vor ihr und starrt sie mit seinen großen bleiernen, gelb blinzelnden Augen an. Bis zu dem Tag hat er nie jemanden nett behandelt, und das Leben mit ihm bedeutete, abhängig zu sein von den Launen des Katers.
»Vielleicht will er spielen. Aber Achtung, er kann auch kratzen.«
Beide Kater lesen gern, und Pommerantsch denkt über das Gelesene nach; Mysterien bringen ihn nicht aus der Ruhe, und Grausamkeiten ist er gewohnt, mit beidem kommt er inzwischen einigermaßen zurecht, und auch mit dem Gespött der Dummen kann er leben. Aber es stört ihn, dass in Europa die Katze als nachtaktives Tier mit dem Mond in Verbindung gebracht und als Verkörperung von Weiblichkeit und Mutterschaft verstanden wird. Er schnaubt.
»Mansur, Freyas Gespann wird von Katzen gezogen. Hexen werden von Katzen begleitet. In deren Entwicklungspsychologie repräsentiert das Bild einer Katze sogar mütterliche Eigenschaften.«
Klischees als Splitter unter den Fingernägeln. Was würden die menschlichen Psychologen aus dem Gekritzel eines Kätzchens lesen? Aus den Spuren von Mansurs Krallen im Sand des Innenhofs? Der rotierende Raum der chinesischen Schrift stellt Verschiedenes dar, in gewissem Sinn auch das Symbol für die erste Auffassung eines Dings, die erste Idee eines Gegenstandes in einem kreisförmigen Ornament. Mansur der Zeichner lässt jedes Mal den inneren Kreis frei und schützt so, ohne es zu wissen, sein eigenes Ich. Sobald Mansur einen fremden Besucher erblickt, zieht er um seine beiden Herren vier Kreise. So schützt er sie und reklamiert gleichzeitig seinen alleinigen Anspruch auf sie.
Fünf Kojen, in denen früher Studierende aus Mexiko schliefen, wurden von den Hausherren zu einem einzigen Raum mit Bibliothek umgebaut; er grenzt an das Schlafzimmer und an die Küche. Der Freund ist ein unersättlicher Leser und verbrachte als Student so viele Tage in Bibliotheken, dass er sich dabei beinahe das Augenlicht ruiniert hat; egal wie anstrengend es für die Augen war, er zwang sich zum Lesen, ohne Rücksicht auf Kopfschmerzen, auf Schwindel. Vor seinen Augen hüpften schwarze Flecken wie chinesische Schriftzeichen. Einfältige Meinungen wie »das gefällt mir« oder »das mag ich« kennt er nicht. Eine solche Einstellung zur Literatur hält er für altmodisch; er hat gelernt, die erreichte Bildung tiefer zu genießen.
Im Innenhof brennen Duftkerzen um die meditative Oase mit einer Buddha-Statue und dem Bambuskäfig für die Kater. Der schwarze Mansur sieht darin wie ein gemästeter Vogel aus. An der Südseite des Hauses gibt es einen besonderen quadratischen Eingang mit einem milchigen Fenster, das nur er benutzen darf.
Ein regelmäßiger Gast des Freundes und seines geheimnisvollen, schweigsamen chinesischen Partners ist der Maler; er hat das Studium Bildender Kunst und Sinologie abgeschlossen. Beiden Fächern widmet er sich mit dem staunenden Blick eines sensitiven und talentierten Besuchers. Er sitzt auf einem Stuhl, trägt chinesische Pantoffeln an den Füßen und spricht Tschechisch. Um seine Finger hat er eine Holzperlenschnur gewickelt. Die Mansur jedes Mal höflich beschnuppert.
Im inneren Hof, in dem der Maler und der Freund ihren Teeritualen und Räucherstäbchen huldigen, liegen auf dem Steintisch aufgeschnittene gelbe Melonen auf einem Teller und in einer Keramikschale rote Goji-Beeren. Die Schriftstellerin legt Fotografien der strubbeligen Puppen neben die Melone. Setzt sich im weißen T-Shirt und roter Hose an den Tisch und raucht eine dünne Zigarette, den Aschenbecher auf dem Schoß.
»Keine Lust mehr auf touristische Manöver. Nicht mal von dir will ich irgendwelche Besichtigungstipps hören. Schluss mit den Reisen. Ich bin am zweiten und dritten und vierten Gesicht interessiert.«
In einem Zug leert sie eine Mischung aus Ingwer und roter Bete. Alter Ingwer schmeckt am schärfsten. Pommerantsch beobachtet jeden ihrer Schlucke, und Mansur fragt:
»Warum ist sie hier?«
»Sie läuft durch Peking, weil sie es in den Knochen des alten Europas knacken hört. Sie will wissen, was zu erwarten ist und welche Aussichten man hat.«
Die Schriftstellerin zieht auf die Couch um. Pommerantsch springt zu ihr. Der Maler reicht ihr Wasser mit einem Stückchen Zitrone. Sie ignoriert das Wasser und spricht die rothaarige Katze an, die sich der Länge nach auf der Couch fläzt.
»Wie sieht es mit dir und deinem offiziellen Gesicht aus?«
Pommerantsch schnurrt. Ein Leben ohne sie gibt es für ihn nicht mehr. Er war dabei, als Konfuzius den frühzeitigen Tod eines Schülers beklagte; wehe, der Himmel hat mich beraubt, der Himmel hat mich beraubt.
Pommerantsch springt von der Couch. Die Schriftstellerin behält die Wärme seines Körpers in der Hand.
Der Maler rutscht hin und her auf seinem Stuhl und stört Mansur, der unter seinen Füßen liegt. Der Kater jault auf, und das verwirrt den Maler.
Der Diplomat, der Maler und der Goldgräber haben jahrelang gemeinsam gesoffen und dann weitere Jahre mühsam um Nüchternheit gerungen. Pommerantsch schlabbert ungestört am schwachen Grüntee Drachenwand. Er trinkt nichts anderes. Mansur mag am liebsten Fisch, verbringt die Nächte draußen und lässt sich bereitwillig streicheln und kraulen. In solchen Momenten spaziert Pommerantsch würdevoll von dannen; er würde nie erlauben, dass menschliche Körper ohne Grund die Hand nach seinem getigerten Haar ausstrecken, auch wenn sie keine Gewichte aus Blei tragen. Er läuft am Buddha vorbei.
»Om mani padme hum.«
Buddha schließt die halbgeöffneten Augen. Mansur scharwenzelt um ihn herum.
»Was heißt das?«
»Eine Meditationsformel des tibetischen Buddhismus.«
»Aber was bedeutet es?«
»Finden Sie es selbst heraus.«
Mansur verkriecht sich in sein im Innenhof stehendes Körbchen, um das Gleichgewicht der Welt zu halten. Gehorsam und demütig leiert er herunter, was Pommerantsch ihm verriet: Ein quadratischer Bau mit gewölbtem Dach symbolisiert Himmel und Erde. Den Ming Tang alias den Tempel des Lichts bauten die Söhne des Himmels nach kosmischem Vorbild. Indem der Sohn des Himmels jede Jahreszeit in dem ihr zugewiesenen Raum beging, sicherte er dem Kosmos und den irdischen Dingen einen geordneten Lauf.
In der Mitte des Körbchens befindet sich ein winziger Kater aus Jade. Pommerantsch ist stolz auf die Stammlinie, der er entspringt. Im Gestrüpp des Nildeltas hatte einst die wilde Sumpfkatze gelebt. Ungezähmt war sie und stürzte sich gehässig auf Schlangen. Man hielt sie für ein heiliges Tier des Sonnengottes. In Heliopolis betete man den Sonnengott in Gestalt eines Katers an. Die wilde Sumpfkatze ist eine Intellektuelle und passt ihrem Wesen nach nirgendwo hin.
Auch der Freund passt seinem Wesen nach nirgendwo hin. Überall stört er oder ragt heraus. Er lässt sich nicht ohne weiteres in eine Schublade stecken. In einem Regal seiner Bibliothek steht eine Sisyphos-Statue, und an der Wand hängen eingerahmte Worte von Havel: Ein Intellektueller steht mit erstarrenden Kategorien immer auf Kriegsfuß, die stammen nämlich aus dem Instrumentarium der Sieger. Dabei ist ein Intellektueller in gewissem Sinne schon immer der Besiegte, und zwar von Anfang an: Ähnlich wie Sisyphos ist er de facto zum Verlieren verurteilt, einem siegenden Intellektuellen haftet etwas Sonderbares an. Andererseits bin ich aber überzeugt, dass der Intellektuelle in einem anderen, tieferen Sinn unbesiegt bleibt, all seinen Niederlagen zum Trotz – wie Sisyphos. Dessen Niederlagen machten einen Sieger aus ihm. Seine Position bleibt damit doppeldeutig. In gewissem Sinne bin ich natürlich besiegt, in gewissem Sinne fühle ich mich aber überhaupt nicht geschlagen. Manchmal macht mir – paradoxerweise – das verbindliche Ausmaß meiner Unbesiegbarkeit und meines darauffolgenden Ausschlusses aus der Siegergeschichte sogar Angst.
Salat mit Hühnerfleisch, Zitronenbrei aus Süßkartoffeln mit Basilikum, Rindfleisch mit Hagebuttensauce, Gemüse aus der Region. Eines Tages wird der Freund gemeinsam mit seinem Partner, der das Kochen liebt, in Prag oder in Paris ein Restaurant eröffnen; das ist ihr gemeinsamer Traum.
»Kluge Menschen diskutieren nicht im Internet«, widerspricht der Freund dem Maler. »Das machen nur Groupies oder Gegner. Aus dem Internet ist ein Wirtshaus geworden. Die antisozialen Netzwerke werden überleben. Sprechen hat heute nicht den gleichen Wert wie zuhören. Man hat vergessen, dass auch schweigen produktiv sein kann, genauso wie anderen zuhören oder Informationen verarbeiten, nachdenken.«
Pommerantsch beobachtet, wie Mansur einen Hühnerknochen abschleckt. Beherzt wie ein Ordensbruder durch die Welt zu schreiten ist in der Tat mutig. Vielleicht ist aber die Lösung viel einfacher. Man braucht sich nur nach dem Satz zu richten, man solle die anderen so behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Wie der chinesische Philosoph Konfuzius bereits fünfhundert Jahre vor dem überall zitierten Jesus gesagt hat: Was du bei deinen Vorgesetzten nicht magst, tue deinen Untergebenen nicht an. Was du bei deinen Untergebenen nicht magst, tue deinen Vorgesetzten nicht an. Was du bei denen vor dir nicht magst, tue denen hinter dir nicht an. Was du bei denen hinter dir nicht magst, tue denen vor dir nicht an. Was du bei denen zu deiner Rechten nicht magst, tue denen zu deiner Linken nicht an. Was du bei denen zu deiner Linken nicht magst, tue denen zu deiner Rechten nicht an. Das nennt man den Weg gestrenger Maßstäbe!
Der Maler erzählt, dass sich Botschafter für chinesische Kunst interessieren. Für sie sei Kunst ein Business, eine Geldanlage. Sie können mit Kunst junge Damen bezirzen. Beim Bezirzen junger Damen ist die Wahrheit besonders verlogen. Statt in die Oper laden sie die jungen Frauen zu einem Theatereintopf ein: Goethes Faust und Doktor Faustus von Thomas Mann als Peking-Oper. Bei Besuchen von Präsidenten und aalglatten Politikern dieser Welt kommen Menschen wie der Maler ähnlich gelegen wie sonstige dressierte Affen; Folkloreensembles zücken die Geigen aus dem Futteral, springen in die Luft, schmettern verführerische Melodien. Der Maler könne die Einladungen zu offiziellen Empfängen nicht ablehnen, seine chinesische Ehefrau würde es ihm nie verzeihen; sie sei seine Managerin und habe ihm einen Frack gekauft. Mit gerecktem Schwanz rast Pommerantschs Körper durch das Zimmer, läuft im wilden Zickzack hin und her. Diesen Satz hat er so oft gehört, dass er kotzen möchte, kann ich nicht ablehnen. Mit diesem winzigen Missbrauch von Wahrheit und Sprache beginnt die Misere, die Pommerantsch seit tausend Jahren umgibt.
Dieses Kaff, Tschechien, ist nur deswegen für die Chinesen interessant, weil es im Herzen Europas liegt. Ein strategisch liegendes, krankes Herz muss beherrscht werden.
Die Chinesen sahen sich jahrhundertelang als das Zentrum der zivilisierten Welt, das Reich der Mitte. Ihre Herrscher litten unter Angriffen unzivilisierter Nachbaren. Die Dynastie Yuan (1279–1368) wurde von den Mongolen gegründet, in der Dynastie Qing (1644–1911) wurden sie von den Mandschu beherrscht, und während der Opiumkriege (1839–1842) wurden sie von den Briten vertraglich gezwungen, fünf Häfen für die Welt zu öffnen und die Stadt Hongkong aufzugeben. Die meisten Chinesen empfinden ungleiche Verträge als tödliche Beleidigung ihres Nationalstolzes.
Um die Statue des freundlichen Buddha unter dem Gebüsch wabert der Qualm eines Räucherstäbchens. Der Maler schneidet eine zweite, rote Melone auf. Pult mit den Fingern die schwarzen Kerne heraus. Legt sie in eine leere Schale. Ordnet sie zu einem Gebilde und erzählt seinen lästigen Traum.
»Es gibt kaum etwas Langweiligeres als fremde Träume«, sagt Pommerantsch. »Sie sind nur einen Tick langweiliger als Fotos bei einem Abitreff. Die Bilder gehen herum und schlucken Zeit. Fotos von Ehefrauen, Ehemännern, Kindern, Enkelkindern, Urlauben, Autos, unzähligen im Bau begriffenen oder abgerissenen Häusern. Konfuzius’ Feinde waren geistlose Gleichgültigkeit, die Berühmtheiten vor Ort.
Mansur wiederum findet den Traum interessant.
»Ich bin gespannt auf die Schellentracht.«
»Ich werfe keine Perlen vor die Säue. Überall zu erzählen, was du unterwegs aufgeschnappt hast – das ist Verschwendung von moralischer Energie. Der Dichter Li Bai blieb immer schön bei einem Krug Wein zu Hause, so besingt ihn zumindest Du Fu. Er nahm keine Einladungen an, von wegen nicht ablehnen dürfen!; eine Schellentracht hat er nie angezogen.«
Bei einem Krug Wein schreibt Li hundert Gedichte,
die Nacht schläft er im Wirtshaus, bis der Mond erlischt.
Der Kaiser lädt ihn zu sich, Li lehnt dankend ab:
Verehrter Kaiser, ich bin doch der Gott des Weines, das schickt sich nicht!
Pommerantsch schläft ein. Mansur lauscht dem Traum des Malers allein.
Der Maler zieht die abgewetzte Cordhose und das flatterige Leinenjackett aus. Er schlüpft in einen roten Samtanzug mit Schellen und breitem Brokatkragen. Der Botschafter schleift eine Schellenschleppe hinter sich her. Der Maler eröffnet das Estradenprogramm mit einem vom Botschafter komponierten rituellen Lied; der Botschafter hat die Position, jedoch nicht die Tugend. Auf die Decke des Speisesaals und die Außenwand des Gebäudes wird ein Zeichentrickfilm über den tschechischen Maulwurf und den chinesischen Pandabären projiziert. Das nennt man Kunst und Druschba. Solltest du die Position haben, jedoch nicht die Tugend, hüte dich, Ritus und Musik festzulegen. Aber auch wenn du die Tugend hast, jedoch nicht die Position, hüte dich, Ritus und Musik zu schaffen!
Die mit Brokatkragen geschmückten Künstler werden in einen Kellerraum gebracht. Dort liegen Musikinstrumente aller Zeiten herum; Erinnerung an verschwundene Musiker. Der Maler bekommt ein altes chinesisches Instrument zugeteilt. Er klimpert darauf, während die Präsidenten, Minister und Hofzeremonienmeister dinieren. Gefüllte Reisbällchen, Judasohren, rosa gedünstete Kalmaren und Tintenfische in Sojasauce, Sekt und als Nachtisch Jackfrucht mit Joghurt. Der Botschafter stellt den Maler dem chinesischen Präsidenten vor, in der Hoffnung, ihm so großzügige Staatsaufträge zu vermitteln, damit der Maler sich, seine Frau und sein Kind ernähren kann. Der Präsident lehnt sich nach europäischem Vorbild freundlich zurück.
»Wir kümmern uns um ihn.«
»Danke.«
»Er soll lebenslang in der Chinesischen Philharmonie spielen.«
Die Audienz ist beendet. Der Maler kann sich einen Strick holen.
Der Maler erzählt seinen Traum zu Ende und beißt in ein von schwarzen Kernen befreites Stück Melone.
»Das kommt davon, wenn du dich wie ein Strichjunge benimmst«, sagt die Schriftstellerin.
Dem Maler bleibt der süße Saft im Hals stecken.
»Und aus mir wird ein Strichmädchen, wenn der Freund weiterhin darauf besteht, dass ich in der Botschaft bleibe.«
Der Freund bringt aus der Küche den nächsten Gang auf angewärmten Tellern. Ihre Sorgen hätte ich gern, denkt er bei sich.
Buddha versteht ihn. Und Pommerantsch.
Der Freund trägt Teller mit Nudeln, mundgerecht geschnittenem Fleisch und Gemüse auf. Sein Partner stellt große Schüsseln mit fettäugiger Hühnerbouillon dazu. Je nach Geschmack kann sich jeder eine Handvoll Chili oder anderes Gewürz dazu nehmen. Die chinesische Speise »Über die Brücke Nudeln« (guo qiao mi xian) stammt aus der südöstlichen Provinz Yunnan. Der Legende nach zog sich ein Gelehrter der Qing-Dynastie jeden Tag in einen Pavillon am See zurück, um Gedichte zu schreiben. Seine verständnisvolle Gattin bereitete ihm eine heiße Mahlzeit zu. Bis sie die Speise von zu Hause zu ihm gebracht hatte, war sie kalt geworden. Eines Tages hatte sie die rettende Idee, die Nudeln erst im Pavillon mit heißer Bouillon zu übergießen. Der Freund hat Wege und Möglichkeiten gefunden, den in ihren eigenen Häusern eingesperrten Menschen eine stärkende Bouillon jeglichen Geschmacks zu bringen, damit ihre Körper auf der anderen Seite der schmalen Brücke überleben können. Übrigens stimmt er mit Havel nicht überein, er würde die Rolle der besiegten Intellektuellen der letzten Jahre nicht auf die Bemühung reduzieren, der von den Siegern geschriebenen Geschichte zu entfliehen. Auf solche Terminologien und Überlegungen tschechischer Dramatiker und Philosophen will er sich nicht mehr einlassen. Schon seit Jahren rennt er zwischen dem chinesischen, armbereiften Anwalt und der französischen und amerikanischen Botschaft mit heißen Speisen hin und her. Die chinesischen Dissidenten Harry Wu und Wei Jingsheng wurden zu ihrer Zeit noch theatralisch und in aller Öffentlichkeit verhaftet. Nach einem genauso theatralischen Prozess und einer ähnlich theatralischen Freilassung wurden sie aus China deportiert und auf Druck der Vereinigten Staaten von Amerika gerettet; damals gab es noch demokratische und freiheitliche Länder, deren Botschaften man ansprechen konnte. Harry Wu und Wei Jingsheng haben das unter dem Namen laogai bekannte Strafsystem von Umerziehung mittels Zwangsarbeit demaskiert. Es waren Zwangsarbeiterlager, die die Welt bis dahin in dieser Form nicht kannte. Sie dienten eben dazu, dass der doktrinäre Sozialismus und der zynische Materialismus alles durchdrangen.
Es gab die Unumerziehbaren, und es gibt sie bis heute. Wei Jingsheng und Wang Dan, Anführer der studentischen Demonstrationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, jenem stolzen Tiananmen von 1989. Sie wurden zu vierzehn und elf Jahren Gefängnis verurteilt. Wei Jingsheng wurde kurz nach dem chinesisch-amerikanischen Spitzentreffen 1997 entlassen. Wang Dan verbrachte vier Jahre im Gefängnis und wurde 1993 auf Bewährung entlassen. Kurz danach wurde er beschuldigt, einen Umsturz der chinesischen Regierung vorbereitet zu haben. 1996 bekam er eine elfjährige Strafe. 1998 wurde er aus gesundheitlichen Gründen auf Bewährung entlassen. Heute lebt er in den Vereinigten Staaten von Amerika.
China schickte früher seinen unumerziehbaren Abfall über die Grenze, heute macht es das nicht mehr, heute wird es die Menschen unauffälliger los. Jene Unumerziehbaren von damals trugen noch Namen. Heute erschafft sich China seine künstlichen Stars und Schattenrebellen, um die Welt zu befriedigen; die echten Rebellen lässt es verschwinden.
Der Freund gießt heiße Bouillon über die Nudeln.
»Hilfe sollte Gesetzmäßigkeiten folgen. Sie darf zum Beispiel nicht schaden. Guck dir an, was die Botschaft gemacht hat: Sie hat eine zur Unterstützung der Menschenrechtler bestimmte Geldsumme an diese weitergeleitet. Offiziell, in aller Öffentlichkeit. Die Dissidenten wurden dann wegen der Annahme finanzieller Beträge aus dem Westen sofort verhaftet.«
»Was kann ich tun?«
»Geh los und sieh zu. Beobachte.«
»Je länger ich in China bin, desto weniger verstehe ich das Land. Umso mehr schäme ich mich für meinen Reisebericht.«
»Stell keine Fragen, beobachte. Um wieder zu uns zu kommen, brauchen wir Inseln eines relativ freien Lebens. Deine Aufgabe ist es, zu warnen, Grauen zu beschreiben und hellseherisch das Böse zu erfassen. Das Gute erkennt der Mensch am schnellsten angesichts des konzentrierten Bösen.«
Der Maler schluckt erschrocken heiße Nudeln hinunter.
»Du redest wie ein Buch.«
Die Schriftstellerin fühlt sich im Hutong des Freundes wie in den Siebzigern in der Tschechoslowakei; auch dort kam man auf unsichtbaren Inseln eines relativ freien Lebens allmählich wieder zu sich. Warum tut der Freund das? Was will er?
Mansur knabbert an einem Fisch auf dem Teller. Schluckt die Glücksschuppen hinunter. Der ausgeschlafene Pommerantsch wartet auf Wasser, er hütet seine Schüssel mit frischem Drachenwandteepulver, aber stößt sie um. Mansur bemerkt das und ist froh; Pommerantsch hat einen Fehler gemacht und reckt verärgert den Schwanz.
»Ja, lieber Mansur, ich mache Fehler, und auch ich habe Fehler! Aber ich bin nicht meine Fehler!«
Mit hochgerecktem Schwanz stolziert er von dannen und lässt Mansur mit einer querliegenden Fischgräte im Hals zurück. Mit offener Schnauze sinniert Mansur darüber, was Pommerantsch ihm wohl hat sagen wollen. Er rührt sich nicht, und am Ende liest der Herr ihm wegen Pommerantschs umgeworfener Schale die Leviten.
Was tut der Freund hier und warum? Was will er? Die Schriftstellerin wirft ihm heftig vor, die freie Stadt Prag und ihre einstigen Dissidenten zu ignorieren. Mit ruhiger Stimme klärt der Freund sie auf. Er distanziere sich von ihnen. Es sind Menschen, die heute in den besseren Stadtvierteln wohnen und damals problemlos das Gymnasium besuchen konnten, nach dem Abitur ein Hochschulstudium absolvierten und nach dem Abschluss sofort gute Jobs bekamen. Nun arbeiten sie an Universitäten, in Bibliotheken, in diplomatischen Vertretungen oder in Verlagshäusern. Und finden irgendwie Gefallen daran, Widerstand zu organisieren und Rebellen zu spielen. Ihr Risiko ist gleich null. Entsprechend bitten sie nur bei Gleichaltrigen um deren Mitarbeit, bei Veteranen oder bei Reichen, die den technischen Hintergrund finanzieren sollen. Ihre Tätigkeit komme dem Freund in gewissem Sinn vertraut vor, obwohl er den Spruch »Wir wollen den Staat zurück«, den manche von sich geben, kindisch finde. Welchen Staat, und was heißt hier wir? Mit einer solchen Bewegung könne er sich nicht ohne innere Verlegenheit und Hemmungen identifizieren, geschweige denn sich engagieren. Es seien geschlossene Gruppierungen, das finde er hochgefährlich. Nie handele es sich dabei um eine ordentliche Demonstration mit klaren Ansagen und einem Anführer, der unerschütterlich gegen den Machtmissbrauch auftrete und mit menschlicher Sprache spräche. Würde es einen solchen geben, würden sie ihn nicht zulassen; er würde im Rauschen des Internets und der Freundschaftsanfragen untergehen. Es gibt neue Menschen, junge Leute mit einem Namen. Aber wenn sie über keine Kontakte zum Zentrum der Gerechten und einzig Wahrhaftigen verfügen, haben sie keine Chance. Immer werden die Demonstrationen auf einen Staatsfeiertag gepfropft, damit sie die notwendige Deckung haben. Dabei ist Tschechien ein Land, in dem man keine Angst zu haben braucht, in dem man keine Deckung benötigt. Vor der Kundgebung zum 17. November befinden sich alle eine Woche lang im Kampfmodus und streiten, wer mit auf die Tribüne darf. Die Tribüne ist proppenvoll. Auch der Geburtstag von Václav Havel am 5. Oktober liefert den Vorwand für alles Mögliche. Elite-Aktivisten organisieren eine Demonstration und lassen keine Studenten dabei mitmachen, oder wenn, dann nur junge Körper aus dem gleichen Stall, deren Texte und Gedanken sie kontrollieren und die sie belehren können.
Pommerantsch wird unruhig; warum unterstreicht sein Herr nicht einfach die Notwendigkeit, beständig seinem Weg zu folgen? Der Weg bringt im Menschen die Politik genauso zum Wachsen, wie er im Boden die Bäume zum Wachsen bringt. Politik ist wie ein Kürbis! Das weiß aber die Schriftstellerin noch nicht.
Die leise Stimme des Freundes leitet Pommerantschs weise Worte weiter. Es gebe besondere und gefährliche Eliten. Das Volk sei zum Beispiel denen dankbar, die 1989 die Wende ermöglichten, ihre Verdienste leugne niemand, obwohl schon lange niemand mehr auf das grundsätzliche Verdienst von Michail Gorbatschow verwiesen habe. Versagt hätten damals Politologen und Soziologen. Mit Abstand sind alle klug, lassen sich aber im Leben gerne überrumpeln. Ähnlich versagen die Ökonomen in Krisenzeiten, überrascht stehen sie da wie der Rest der Gesellschaft. Und genauso versagen Historiker, erst mit Abstand, nach einer bestimmten Zeit sind sie klüger als all die Menschen der von ihnen untersuchten Periode; sie fühlen sich den Menschen der Vergangenheit moralisch überlegen. Das Schöne an der Geschichte ist, dass mit zeitlichem Abstand alles logisch wirkt, das ist für die Libido der Historiker natürlich sehr beruhigend. Rückblickend spüren sie die besserwissende Kraft des Supermanns in sich aufsteigen, der alle Geschehnisse präzise einordnen kann. Anders als die Blödmänner, die damals lebten und ihrer Zeit nicht gerecht wurden.
Der Freund besucht nicht einmal die Diskussionsabende und Gedenkfeiern seiner Freunde, wo männliche Körper ihr Mantra Havel und ich um die Wette rezitieren und auf Dankbarkeit und Posten hoffen, einmal Direktor, für immer Direktor, einmal Diplomat, für immer Diplomat, einmal ein Recke, für immer ein Recke. Wenn schon Kritik, dann mit den alten Nullachtfünfzehn-Wörtern ihrer Generation. Jahre vergehen, Menschen sterben; im Alter macht sie nur noch der Luftzug aus angelehnten Fenstern und der Wandel von Zeit, Speisen und Weinsorten rasend. Im Tschechischen verweist jedes Wort auf eine andere Wirklichkeit, und je nach Sprecher kommen die verborgenen Varianten zum Ausdruck. Einfache Menschen erfahren ohnehin nie etwas; sie haben einen Verdacht, etwas Konkretes haben sie nicht.
Nach der Demo gehen sie befriedigt auf ein Bier und schicken aus der Kneipe begeisterte SMS an ihre alten Kumpel, wie gut der 17. November diesmal gelaufen ist. Was für ein runder Tag es war. Sie fangen an, über zerfallene Ehen zu reden, über die Körper der frischen Geliebten und die Höhe der Alimente, die sie nicht zahlen müssen. Eine Estrade in rotsamtener Schellentracht, sagt der Maler, aber der Freund lächelt nicht. Seinem Rebellentum haftet etwas Tiefgründigeres an. Sein Rebellentum mündete ins Dissidententum, ohne dass er überhaupt das Bedürfnis gehabt hätte, es so zu nennen.
In Peking geht es um Leben. In Prag spielen sie nur Aktivisten.
Man brauche junge Menschen, sagt er, die sich weder im Kommunismus die Hände schmutzig gemacht haben noch in der Dissidentenbewegung oder im Salonaktivismus sexuell frustrierter, gelangweilter alternder Männer. Aber das Leben sei anderswo. Eine Bewusstseinsveränderung müsse her. Hilfe an konkrete Menschen adressieren, auch an Einzelpersonen.
Wir brauchen neue Wörter, eine neue Sprache.
Mansur verfolgt das Gespräch nicht, denn er kennt das Wort Dissident nicht. Nach Pommerantschs Erklärung ist er aber auch nicht schlauer.
»Was war mit Ungarn, wo Viktor Orbán auf seine Vergangenheit als Dissident stolz war, aber trotzdem selbst einen autoritären Staat und Zensur herbeisehnte? Oder Polen, mit den Brüdern Kaczyński, die als bekennende Dissidenten einen autoritären Staat und Zensur herbeisehnten, inklusive Abschiebung der paar Juden, die nach der Vertreibung im März 1968 im Land geblieben sind?«
Pommerantsch winkt ab.
»Alle, die vor 1989 gelebt haben, sind vom Bolschewismus durchtränkt. Alle. Auch wir.«
Pommerantsch geht die Aktivisten von heute durch, den Freund und seine Leute in China inbegriffen. In Europa gehen sie ihm auf die Nerven; die Situation eines Langzeitverfolgten kann schon manchmal zur Selbstverliebtheit führen. Hoffentlich befalle diese Marotte den Freund nicht. Sie hänge ja mit Charakter und Veranlagung zusammen, dem Menschentypus insgesamt. Erfreulicherweise habe sein Herr begriffen, dass sich die unendlichen Prager Debatten, Sitzungen und Aktivistenstreitereien kaum von den unendlichen Debatten, Sitzungen und Streitereien aller Menschen an der Macht unterscheiden. Oder von den Debatten im Königreich der Eitelkeit namens Internet, für die eine Faustregel gelte, einstürzende lange Mauern bringen nicht unbedingt den Tod, sollte man aber ins Gerede kommen, werde man von Reden erdrückt. Der Vater von Pommerantschs Herrn unterrichtete an der Universität von Toulouse Französisch und Englisch. Die Eltern waren aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen, und als kleiner Junge stand der Freund in Moskau mit einem blau emaillierten Eimer in der Hand stundenlang für Milch an; trotzdem kam er nicht immer dran; die Milch wurde dringender auf Kuba gebraucht. Später studierte er Chinesisch und Japanisch und arbeitet jetzt für eine gemeinnützige internationale Gesellschaft in Peking. In China darf es keine Non-Profit-Organisationen geben, und man kann sie auch nicht registrieren. Der Freund wird ständig kontrolliert, und im Teehaus Purpurrebe wird ihm mit erhobenem Finger gedroht. Das letzte Mal wurde dort am Nebentisch gerade eine Journalistin bedroht, die über die Verhältnisse in China berichtete; das Visum für ihren Sohn, der mit ihr in China war, wurde nicht verlängert. Der Freund organisiert kostenlose Schulungen über Rechtsstaat, Bankwesen und Menschenrechte; die Geheimpolizei lädt ihn regelmäßig zu Teepartys ein. Am Tisch im stillen Teehaus verhören ihn abwechselnd eine gute und eine böse Stimme mit Walnüssen in der Hand. Immer häufiger bekommt er Drohanrufe, und die enge Gasse, der Innenhof und das Haus werden von Männern im grauen Anzug bewacht. Sie verfolgen seinen Partner beim Einkaufen. Hätten sie Kinder, würden sie auf dem Schulweg beschattet.
Sein Fahrrad wird immer wieder geklaut. Oder man lässt die Luft aus den Reifen. Das Auto des chinesischen Partners wird beschmiert. Was für ein feines Spiel. Zupfen an Nervensträngen. Kreischen Krähen vor dem Fenster, kommt bald Besuch, und die Wohnung oder das Büro des Freundes werden von der Geheimpolizei gestürmt. Solange Gefahr droht, schafft er seine Mitarbeiter hinter die Grenze. Das letzte Mal ist er mit dem Zug in die Mongolei gefahren; China verhält sich zur Mongolei, als würde es das Land besitzen. Es ist ein kleines Land mit zwei Millionen Einwohnern. So ähnlich behandelt Russland die Ukraine oder Tschechien. Wie strampelt man sich raus aus der Totalität?
Totalitäre Beziehungen sind keine Politik. Sie sind kein Kürbis. Im russischen Unterbewusstsein schlummert immer noch die riesige Sowjetunion, die Supermacht, und die Haltung zu den ehemaligen Ländern der Sowjetunion und zu Ländern, die unter ihrem ideologischen Einfluss standen, gleicht der Haltung eines Firmenbesitzers zu seinen Töchtergesellschaften.
Pommerantsch beobachtet die Hausdurchsuchungen mit Ruhe und Grazie aus langjähriger Erfahrung seiner gelben zusammengekniffenen Augen. Mansur mit dem seidigen schwarzen Fell liebt die Razzien. Er liegt zwar gerne faul herum, den Schwanz demütig ausgestreckt, aber sobald Männer in weißen Hemden und grauen Anzügen durch die Wohnung laufen, ändert er sein Verhalten und peitscht mit dem zottig aufgeplusterten Schwanz; der Schwanz ist ihm die Quelle der Freude. Er fegt mit ihm über Tischchen und Regale. Vasen stürzen und verwandeln sich in Scherben auf dem Boden. Pommerantsch verlässt mit glühenden gelborangen Augen die Wohnung; für Menschen, die nicht in schöpferischer Agenda unterwegs sind, hat er nur Verachtung übrig, für ihn sind sie keine Persönlichkeiten.
Mansur hat Spaß an dem Spiel. Ein menschlicher Körper blockiert die Tür. Mansur ist heute richtig verwegen. Er schärft seine Krallen am Sofa. Springt einem der Männer auf die Schulter. Der Mann erschrickt und schubst ihn runter. Ein anderer Mann klappt in der Toilette den Sitz hoch. Mansur beobachtet den gelben Strom; Farbe von Pommerantschs Fell. Der Mann lässt den Deckel zufallen, ohne zu spülen. Die Stimmen kreischen; Männerhände versuchen Mansur am Schwanz zu packen. Wie ein Irrer fegt er hin und her und springt aus dem Fenster. Segelt durch die Luft, steuert mit dem Schwanz, lenkt in die richtige Richtung, landet auf allen vieren.
Das allein bewundert Pommerantsch an ihm. Sollen die zweibeinigen Männer im Anzug, einer nach dem anderen, in geordneter Milchschlange, ruhig aus dem Fenster springen, dem Tod in die Arme.
Ideologien sind bewaffnete Gedanken.
Gedanken werden von Eunuchen bewacht. Die Ordnung hüten auf Kosten des weiteren Denkens. Revolutionsideologen gebärden sich wie Repräsentanten der Moral. Bis 2009 überwog die selbstbewusste und weltweit geschätzte Vision von Václav Havel; die Tschechische Republik und Norwegen gehörten zu Ländern, die kompromisslos auf Einhaltung der Menschenrechte bestanden. Von der chinesischen Seite wurden sie komplett ignoriert. Unter Václav Klaus überwog der Wunsch Business first. Dann Sport. Und ein bisschen Kultur. Der Kopf von Václav Klaus warb in Peking auf Reklametafeln für Abfahrtskier. Westpolitiker fanden das ziemlich verwirrend. Noch verwirrender fanden es allerdings Golfspieler und Skifahrer. Unter Miloš Zeman überwog der Wunsch Business first. Dann Business. Und ein bisschen Business. Das verwirrte niemanden mehr, und der Höhepunkt der Talfahrt war Zemans erster Besuch in Peking; mit den Worten, für ihn sei die chinesische Gesellschaft ein Vorbild an Stabilität und Menschlichkeit, überreichte er als Gastgeschenk einen Maulwurf aus Plüsch.
Pommerantsch versteht, warum die Schriftstellerin hier dauerhaft in Scham versinkt. Sie sieht der Politik nur zu. Sie sieht dem Kürbis zu. Wegen des Freundes. Der Freund sagt mit leiser Stimme, die einzige annehmbare Haltung sei für ihn das Verhalten des ehemaligen deutschen Präsidenten Joachim Gauck und das von Angela Merkel, obwohl er sich keine Illusionen darüber mache, wie lange die Frau noch Kanzlerin bleibe. Sie schüttelt dem Dalai Lama die Hand und setzt sich erst dann mit chinesischen Politikern an den Verhandlungstisch. Sie reagiert sachlich, entschieden und ruhig. Tagtäglich durch die Koexistenz mit Männern der großen weiten Welt bedroht, die Macht haben und Gewalt ausüben. Sie lässt sich nicht ins Bockshorn jagen und kennt die Schwächen der Diktatoren: Sie haben keinen Sinn für Humor. Ihre Erfahrung des Sozialismus ist unbezahlbar und nicht zu vermitteln. Sie toleriert uneindeutige Entscheidungen, sie kann Unterschiede verbinden, verschiedene Werte zusammenbringen und sie der momentanen Situation anpassen, sie ist nicht masochistisch veranlagt, verurteilt und demütigt niemanden. Absolute Kontrolle lässt sie nicht gelten und sieht Kritik als ein Ding der Öffentlichkeit, verbunden mit Selbstkritik und weiterer Entwicklung. Sie kann Minderwertigkeit erahnen und Schwäche, gibt allen die gleiche Chance. Männer scheint zu schockieren, dass Frauen darauf achten, andere nicht zu verletzen. Ohne Menschen wie Merkel würde Europa das Gesicht verlieren.
Dafür wird sie einmütig gehasst; auch in jeder Botschaft in Peking.
Die Schriftstellerin hört nicht zu. Sie spielt mit Mansur.
Die Schriftstellerin fährt Fahrrad, die Sinne geschärft. Die Menschen schweigen verstockt und blicken angesichts der Polizeipatrouille vor Ministerien oder Banken erschrocken auf. Keine schwangere Frau weit und breit. Der chinesische Partner des Freundes zeigt ihr den Weg. Sie finden hinaus aus dem Labyrinth der engen, mit Gerümpel vollgestellten Gassen. Bei dem Laden mit Buddhismusbedarf biegen sie ab, und der gebeugte Rücken vor ihr tritt inmitten eines irrsinnigen Konzerts aus Gehupe und Geschimpfe in die Pedale. Über breite Straßen gelangen sie auf eine vierspurige Fahrbahn, in ihren Ohren hallt das Geschrei der Blauelster nach. In China stumpft man in Bezug auf Geräusche ab; man stumpft die eigenen Sinne ab, um nicht irrsinnig zu werden.
Den Ritan-Park findet sie schon allein. Der Qinghui-Pavillon ist ein Regenschirm. Sie trinkt darunter einen Jasmintee, das Teehaus sieht aus wie ein steinernes Boot auf dem See. Ein Schatten schwimmt auf der Wasseroberfläche. Er ähnelt einer abgetrennten linken Hand. Die Schriftstellerin drückt die Zigarette aus. Die abendlichen Körper im Ritan-Park laufen gehorsam im Kreis, die Energie fließt. Der rotierende Raum versinnbildlicht die erste Idee eines Gegenstandes in einem kreisförmigen Ornament. Der eine klatscht in die Hände, und der andere singt, jeder in einer unsichtbaren und starren Schutzpelle seines in der Öffentlichkeit dicken Fells. Die Grenze zwischen den Körpern ist undurchlässig wie aus Beton. Sie haben ihre teuren Autos vor der Grünanlage geparkt und geschickt gleich zwei Parklücken eingenommen; das Wesentliche ist, Raum an sich zu reißen und dem anderen rechtzeitig eins auszuwischen. Das Ziel ist die Anhäufung von Dingen. Sie alle haben in Europa studiert.
Ein Jahrhundert lang verpasste China den Menschen eine Gehirnwäsche. Schüttete ihnen die Augen mit Dingen zu.
China in uns. Wir in China.
Mansur huscht durch den Park. Er läuft durch die nächtliche Stadt und beobachtet mit Vorliebe streunende Katzen und ihre unerschrockenen Jungen; sie balgen sich auf öffentlichen Plätzen. Nur die stärksten und schnellsten kehren im Morgengrauen in den unterirdischen Bau zurück. Die schwachen und langsamen landen auf dem Teller. Neugierig beobachtet Mansur die Kätzchen, die überlebt haben; sie sind ganz besonders. In ihren Augen glänzt die erste Angst vor der eigenen Mutter. Katzen fressen manchmal ihre Jungen auf, noch feucht. Mansur ist unterwegs zu dem Mann, der im Erdquadrat lebt; Pommerantsch nennt ihn Meister Chronos.
Nach Mitternacht isst die Schriftstellerin ein Häppchen in einer Garküche und sieht Meister Chronos mit Mansur reden. Eine müde Frauenhand reicht ihr eine Scheibe Rindfleisch am Spieß, die andere Hand tröstet ein weinendes, übermüdetes Kind. Will ein Sklave frei sein, darf er Sklavenarbeit nicht zulassen; Božena Němcová holte sich ihr Essen aus dem Wirtshaus, Simone de Beauvoir aß lebenslang in einfachen Restaurants, und diese Selbstverständlichkeit glich einer Revolution. Schriftsteller pflegen Frauen zu haben; die kochen, putzen, organisieren den Haushalt, ziehen ihnen die Kinder groß, führen das Archiv.
Die Schriftstellerin hat nirgendwo gelesen, dass ein Thomas Mann, Milan Kundera oder Günter Grass mal Gemüse geputzt oder Wäsche gebügelt hätte. In seiner kommunistischen Jugend wurde Kundera mit dem Staatspreis für Literatur geehrt, in jedem Regime und jedem Land hat er für sich eine bequeme, elitäre Gourmetnische gefunden. Er passt in das Bild, das sich der Westen vom Osten gemacht hat, dort sind Frauen bloße Zierde.
Božena Němcová, Selbstversorgerin mit vier Kindern. Eine Alleinerziehende hat Mann, Frau, Arbeitskraft und Dienstmädchen in einem zu sein. Energie, die nie versiegen darf, und Verantwortung, die kein Ende nimmt. Es reicht nie. Und dann muss sie sich noch anhören, sie, allein mit den Kindern und am Rande der Armut, sei selbst schuld. Das Wort Alleinerziehende beschreibt die Situation eines solchen Menschen nicht ausreichend. Eine noch nicht untersuchte Position. Eine Position unter dem Himmel, für die es noch kein Wort gibt. Eine Firma mit einer Chefin und einer Angestellten, die die Arbeit von hundert Menschen übernimmt. Unermüdlich und ganz allein. Eine namenlose Schraube im Getriebe des häuslichen Stereotyps. Existenzielle Einsamkeit. Mit vielen kleinen Krallen, die nach ihr greifen. Dazu der eigene Beruf, eine doppelte Belastung, ein Mann weiß selten, was doppelte Belastung heißt; ihm fehlt die Erfahrung, er kann es nicht wertschätzen. Und die Alleinerziehende muss sich um Freundlichkeit und Geduld bemühen; junge Literaten wollen ihr eigene Arbeiten zeigen, verkannte Literaten wollen endlich Zeit mit ihr verbringen. Es ist so viel, wonach sie sie fragen möchten, Literatur und Leben, sie wissen gar nicht, wo anfangen. Die spöttischen Blicke der Außenwelt. Wasser trinken. Schlafen, schlafen, schlafen. Im Buch der Lieder heißt es: Ertrunken liegt sie auf dem Grund, aufhören zu strahlen wird sie nie. Božena Němcová zerbrach nicht an der Gesellschaft oder an ihrer Zeit. Sie zerbrach am Geldmangel. Wenn Schriftstellerinnen kein Geld für sich und ihre Kinder haben, wenn sie Tag für Tag nur Löcher stopfen, wenn sie das Schreiben nicht aufgeben wollen und nicht können, ist das Leben anstrengend, frustrierend, tödlich. Sie können an nichts anderes denken. So hört auch der Edle nicht auf, sich ohne äußeren Grund oder Störung zu prüfen, ohne erst Schuld auf der Seele zu empfinden. Das Unerreichbare an einem Edlen ist das Unsichtbare!
Die Schriftstellerin kauft acht Fleischspieße für Meister Chronos. Drückt der schockierten Frau in der Garküche die vierfache Menge Geld in die Hand.
Die Frau des Diplomaten prüft den Krawattenknoten und zupft den mit Schellen gesäumten Brokatkragen ihres Mannes zurecht. Der heutige Empfang in der Botschaft wird für Angestellte anderer Auslandsvertretungen gegeben; ein Gartenfest der verbotenen Städte. Wenn bei Pressekonferenzen Journalisten mit enthüllten Lügen wedeln, sagen die Pressesprecher entspannt:
»Ich lüge nie.«
»Aber das hier ist eine Lüge.«
»Ich lüge nicht. Warum sollte ich? Das habe ich nicht nötig.«
Eine Lüge kann so lange als Wahrheit durchgehen, bis der Betroffene etwas zugibt. Bis dahin tun alle, als entspräche die Lüge der Wahrheit. Sie haben die Pflicht, zu repräsentieren und ihre Meinung hinter dem Berg zu halten. Sie reden von Europa und Weltrettungsmaßnahmen und finden ohne Begleitung junger Assistentinnen nicht einmal den Weg zur Toilette.
Wie auf Kommando rotten sich uniformierte Soldaten zusammen. Wie auf Kommando rotten sich Kostüme freundlicher Massenmörder aller Länder zusammen und verdrücken sich in die nächste Ecke. Wie auf Kommando tuscheln sie über ihre fetten klandestinen Geschäfte. Zu ihnen gesellt sich ein ehemaliger Unteroffizier, jahrzehntelang hat er in der Armee gedient, jetzt besitzt er eine Firma für »Powerbänke« und klappert Botschaften ab. Der Diplomat würde die gemieteten Räumlichkeiten im Botschaftskomplex auch gerne an die werte Runde weitervermieten, aber da hat er Pech. Er trägt keine Uniform.
»Sie reisen allein, da sind Sie wie ein Mann.«
»Wie bitte?«
»Noch ein Glas Wein?«
Die Schriftstellerin lehnt weitere Getränke ab. Vielleicht bietet man ihr keins mehr an. Die gereichte Visitenkarte nimmt sie mit beiden Händen entgegen, um ihr Gegenüber nicht zu verletzen.
»Die hätten in der Türkei bleiben sollen. Von da aus könnten sie wieder nach Syrien zurück.«
»Ein paar Frühlingsrollen gefällig? Oder Gulasch?«
»In Syrien ist kein Stein auf dem anderen geblieben, weder Krankenhäuser noch Schulen noch Behörden. Nur wegen Russland hat die UNO keine verbindliche Resolution zur Verletzung der Menschenrechte in Syrien zustande gebracht.«
Die Frau des Diplomaten ist den Tränen nah, in einem der bombardierten Krankenhäuser wurde ein russischer Soldat verletzt. Als einer leise den Mord an Kindern im Kriegsgebiet erwähnt, ruft sie beleidigt, das könne man doch nicht vergleichen, das waren ja syrische Kinder.
»Sind Sie zum ersten Mal in China?«
»Wie finden Sie China?«
»Wie war der Flug?«
Geschäftsleute sind die wahren Botschafter. Verkrachte Manager. Goldgräber. Nach der Entdeckung Amerikas wurde der neue Kontinent zuerst von Bankrotteuren abgegrast, und das Kolonialkongo wurde von belgischen Abenteurern überschwemmt.
Ein deutscher Diplomat stößt mit der Schriftstellerin an.
»Die Technokraten verrechnen sich manchmal. Auch Ihr Herr Beneš war ein Technokrat, sein Dreisatz ging nicht auf. Deutschland hat sich auf die Beine gestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Land den Ansturm von etwa vierzehn Millionen Vertriebenen verkraftet. Es hat die Immigrationswelle der Ungarn nach 1956 verkraftet, die Welle der Tschechen und Slowaken nach 1968 und auch die Welle aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wir haben uns nicht mal von den Banden, die unser System missbrauchten, die Laune verderben lassen. Wir haben Integrationssprachkurse eingeführt. Deutschland, von dem niemand gedacht hätte, dass es sich je wieder aufrichten und von der Pest reinwaschen würde! Einst hat es Europa zerschlagen, heute hält es das europäische Gebilde zusammen, als demokratisches Land mit Sozialempfinden. Europa wird von einer einzigen Frau zusammengehalten.«
»Wenn die Tschechen drei Millionen Nachbarn vertrieben haben, könnten sie doch drei Millionen Flüchtlinge aufnehmen und sie versorgen.«
Ein slowakischer Diplomat stößt mit der Schriftstellerin an.
»Wir sind vom gleichen Blut. Unser Präsident Beneš hat die Eisenbahnstrecke Slowakischer Pfeil 1936 mit den Worten eröffnet: Kein Berg ist hoch genug, um die Tschechen und die Slowaken zu trennen und die tschechoslowakische Einheit zu verhindern.«
Die Zeit des exaltierten Tschechoslowakismus hallt in Peking nach; Gebäude beider Botschaften stehen hinter derselben Mauer. Nicht Tschechen und Slowaken, sondern eine Nation. Ein Nationalstaat, ein Jahrmarkt der Nationen, Idealisierung der Landschaft, sonderbare Unberührtheit slowakischer wie auch ehemals deutscher Dörfer und die Eisenbahn als tschechische Zivilisationsmission. Prag war der Kopf der Heimat. Zur Karpato-Ukraine pflegten sowohl Tschechen als auch Slowaken eine Kolonialbeziehung.
Die Schriftstellerin sieht sich mit zusammengekniffenen gelben Augen um. Die Leute hier fühlen sich alle noch wie übermächtige Landesfürsten. Wenn sie ihren Blicken begegnet, sieht sie den Terrorismus eines Räuberhauptmanns aufblitzen. Koboldhafte Machos und ihre Handlanger disputieren darüber, wie man Europas Gesichtsverlust verhindern könnte. Männer ohne Gesicht.
Ein Vertreter der britischen Botschaft kommt auf einen Sprung, nur ganz kurz, wirklich, er müsse gleich weiter. In den Augen der beflissenen tschechischen Gastgeber ist er der Inbegriff dessen, was sie respektieren und bewundern; das Imperium, in dem die Sonne nie untergeht, wie die Briten früher nicht zu betonen vergaßen. Der Schriftstellerin funkeln die Augen; als sähe sie überall um sich herum das europäische Imperium einstürzen, der Lächerlichkeit preisgegeben und geplündert.
Für die Kaiser und Kaiserinnen Chinas muss es ein unglaublicher Schock gewesen sein, als sie zum ersten Mal einen Atlas oder Globus sahen und begriffen, dass das Reich der Mitte auf der Erdkugel gar nicht so viel Platz einnahm. Das Gefühl, den anderen überlegen zu sein, wird in China logischerweise durch seine tausendjährige Kultur zementiert; die Überlegenheit ist nicht auszuräumen. Warum auch?
Worauf stützt sich aber das Gefühl der Überlegenheit der Partygäste, überlegt die Schriftstellerin. Keiner von ihnen, keiner der Europäer gibt zu, wie entsetzt sie beim Anblick von China waren, wie erschreckend sie die Riesenhaftigkeit des Landes und der Menschenmengen fanden. Eine Riesenhaftigkeit, die von Reiseberichten oder Landkarten nicht einmal annähernd wiedergegeben werden kann. Der Meister sprach: Dumm sein, und dabei gerne seine Dienste anbieten, aus kleinen Verhältnissen kommen, und dabei nur auf sich zählen, in heutiger Zeit leben, und dabei auf Wege des Altertums setzen; wer so verfährt, der ruft eine Katastrophe herbei. In jeder Situation gemessen und passend handeln. Die Mitte ist beweglich, ähnlich wie in der Vorstellung der Chinesen auch die Perspektive beweglich ist. Für Konfuzius waren die Ausgangssituation und Motivation jeder Behauptung die wichtigsten Kategorien.
Die Schriftstellerin hebt das letzte Mal ihr Glas und verschwindet. Pommerantsch bleibt; Gehörtes kann er bis auf den letzten Tropfen in seiner Drachenteeschale auskosten. Sie noch nicht. Mansur schimpft mit ihm.
»Warum schicken Sie sie ständig zu Empfängen? Dort passiert doch nichts.«
»Scheinbar nichts.«
Ein Empfang, der nächste aus der unendlichen Serie von Premieren, Vernissagen, Partys im engeren und Partys im weiteren Kreis, Gartenfesten, Gelächter, Gläserklirren, Stimmen fremder Menschen und Ptydepe. Das gesellschaftliche Leben ist nicht kompliziert, man braucht keine übermäßigen geistigen und seelischen Kräfte dafür. Aus Tschechien Entfleuchte, miteinander durch Sprache verbunden; besonders lieben tun sie sich nicht, und nähere Kontakte wollen sie nicht knüpfen, aber sie müssen sich revanchieren und selbst eine Einladung aussprechen. Sie wissen nicht, wie häufig der Jasmin auch ohne sie geblüht hat; die über zwanzigtausend Kilometer lange Große Mauer steht bis heute, aber der Kaiser Qin Shihuangdi, der mit ihrem Ausbau begonnen hat, ist längst vergangen.
»Noch ein Gläschen?«
»Sind Sie zum ersten Mal in China?«
»Wie war der Flug?«
»Wie finden Sie China?«
Die beim Empfang anwesenden Körper tschilpen; in letzter Zeit wird am meisten über die »Krise« und die auf Europa zusteuernde Welle gesprochen. Das Schicksal habe die »Flüchtlingskrise« in die europäischen Länder geschickt und ihre Nase hineingetunkt, um ihnen zu zeigen, wer degeneriert sei und wie. Feindlicher Heuschreckenangriff. Aber das Fleisch der Schwachen wird schließlich zur Nahrung der Starken, so viel sei sicher. Eine Nation wird am besten durch einen äußeren Feind zusammengeschweißt. Auch die Kommunistische Partei Chinas erwecke in jeder Situation den Eindruck, sie verteidige und schütze ihr Volk vor Eindringlingen. Maos Leibarzt behielt sein ganzes Leben lang die Worte seines teuren, der Sowjetunion treu ergebenen Patienten in Erinnerung, der einerseits große Achtung vor dem Genossen Stalin hatte, andererseits aufs Grausamste mit ihm wetteiferte und sich diebisch über jede Kleinigkeit freute, die seinen Nebenbuhler schwächte.
»Manche unserer Genossen verstehen die Situation nicht. Sie wollen, dass wir in See stechen und Taiwan übernehmen. Ich bin nicht einverstanden. Lassen wir Taiwan sein. Taiwan bedrängt uns ständig. Das ist wunderbar. Damit hilft es uns, die innere Einheit zu bewahren.«
Auf einer imaginären Weltkarte der Tyranneien hält China wegen der harmonischen Perfektion, auf die das System getrimmt ist, die erste Stelle inne. Mao dachte sich den »Großen Sprung« und ein brutales Modernisierungsprogramm aus, womit er in den Jahren 1959–1961 eine perfekte Hungersnot zuwege brachte. Dutzende Millionen Menschen starben. Ihre Namen wird keiner mehr finden. Schätzungen gehen von zwischen zwanzig und vierzig Millionen hungernder Münder aus. Die Kulturrevolution in den Jahren 1966–1976 führte zu weiteren Hunderttausenden oder Millionen Toten. Auch ihre Namen wird keiner mehr finden. Mao hat überlebt und lebt weiter. Mithilfe von Geistern der zahlreichen Toten hat er die eigene Sterblichkeit überwunden.
China ist die Tochter des Vaters Mao.
Die Spielregeln werden von einer einzigen Persönlichkeit bestimmt; das einfache Prinzip der häuslichen Gewalt. Einer spielt den Führer, der andere schlüpft willig in die Rolle des Opfers, und der Dritte ist bereit, immer wieder von einem zum anderen zu rennen, die Lage entspannen und sich sowohl mit dem Führer als auch mit dem Opfer gut verstehen zu wollen.
Die Nation ist ein Kind. Das Kind ist so vorprogrammiert, dass es ohne Eltern nicht überlebt. Deswegen klammert es sich so an sie, auch wenn es von ihnen gepeinigt und missbraucht werden sollte; es liebt seine Eltern und würde vor lauter Liebe sein Leben für sie opfern. Am stärksten bindet man sich an die Peiniger. Vater Hitler und sein Volk. Vater Stalin und sein Volk. Vater Mao und sein Volk. Bis heute werden ihre Legenden erzählt als warnende Zeichen für Grausamkeit, Gier, Exzentrizität. Vorzeichen für das Ende.
Mao hatte sein Land auf der Lenin’schen Terrordoktrin errichtet. In Europa ist das zwanzigste Jahrhundert ein Jahrhundert der Säuberungen, und ihr Nachhall irrt bis heute in Europa herum. Auch der große Mao stand mit einem Besen da und fegte die Vergangenheit aus. Konfuzianismus, kaiserliche Dynastien, republikanischer Nationalismus der Kuomintang, in den Siebzigern gesellte sich noch die bürokratische Gestalt des Sozialismus dazu. Um seine nach dem missglückten »Großen Sprung« schwindende Macht zu erhalten, dachte sich Mao flugs die Kulturrevolution aus und fing an mit der Manipulation von Kindern; er drückte Pubertierenden ein rotes Büchlein mit seinen Zitaten in die Hand und schickte sie auf ihre Lehrer los. Mao wollte den Genossen, die vorhatten ihn kaltzustellen, Angst einjagen; die Kulturrevolution war ein pfiffiger Schachzug gegen die Kumpel aus dem Politbüro.
Alles, was von außen kommt, wird in China pfiffig umgeschmolzen und angepasst. Auch die drei Grundphilosophien, Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus wurden ineinander verflochten, um ein harmonisches Gleichgewicht herzustellen. Der Buddhismus, die erste organisierte Religion, die nach China durchgedrungen war, wurde mit der vorherigen Glaubenskultur verbunden. Der Buddhismus verbreitete sich in China im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung und brachte Gebote mit sich, die das Töten untersagten und eine fleischlose Ernährung empfahlen, Barmherzigkeit und Mitleid anmahnten, vor Rache warnten und eine Wiedergeburt verkündeten. Auch die Tibeter mit ihrer älteren Lehre passten sich an, und so entstand der Lamaismus.
Am besten entspricht den hochorganisierten Chinesen jedoch die moralische und gesellschaftsorientierte Natur des Konfuzianismus; hierarchische Beziehungen, Herstellung von Ordnung und Stabilität mit Hilfe der regierenden Elite. Die beständige Hierarchie dieser Beziehungen und die Betonung der Sohnestreue dienen als Rechtfertigung für die totalitäre Herrschaft.
Die höchste Tugend eines kultivierten Mannes und einer kultivierten Frau ist und bleibt die Gehorsamkeit. Zehntausende Dinge und Wesen gedeihen gemeinsam und schaden einander nicht. Sie ziehen ihrer Wege und stören sich gegenseitig nicht. Kleine Tugenden wie Flussläufe, große Tugenden wie tiefe Umwandlungen, eben das macht Himmel und Erde so groß!
Auch der Programmierer fehlt bei dem Empfang nicht. Er ist müde und verstockt, aber das Gefühl seiner Überlegenheit bleibt. Die Schriftstellerin erzählt ihm zwischen zwei Gläschen, vergangene Jahrtausende seien Jahrtausende der Männerspiele gewesen, das könne man auch in China gut beobachten. Eine Frau gehorcht nicht nur ihrem Vater, ihrem Gatten und ihrem Sohn, sondern auch den Schwiegereltern, für das eigene Leben bleibt ihr kein Raum. Es gibt nur wenige klassische Texte, in denen Frauen lobend erwähnt werden, vielleicht hängt es mit dem Konfuzianismus zusammen, da muss sie Murmel fragen. Der Programmierer bringt sofort eine Reihe von chinesischen Namen in Stellung, die mächtigsten Frauen Chinas. Das seien aber Namen verkrüppelter Seelen, erwidert die Schriftstellerin, die sich wie Armeeführer verhielten und außer der Intrige keine Taktik kannten; auch die vierte Frau von Mao sei dabei, eine erfolglose und rachedurstige Schauspielerin, die sich Azurwolke nannte oder auch Blauapfel oder Grüner Fluss; sie stand an der Spitze der Großen Kulturrevolution, und nach Maos Tod führte sie erfolglos die Viererbande an. Die letzte chinesische Kaiserinwitwe mit dem Namen Cixi wiederum habe sich Mittag- und Abendessen von einhundertacht Gängen zubereiten lassen. Sie war mit fünfzehn Jahren als Konkubine des Kaisers Xianfeng in die Verbotene Stadt gekommen und zu seiner Favoritin geworden. Sie gebar ihm einen Sohn, den Thronfolger. Nie wieder durften die Eunuchen den nackten, in gelben Stoff gehüllten Körper einer anderen Nebenfrau ins Schlafzimmer des Landesfürsten bringen. Der Kaiser starb 1861, und die sechsundzwanzigjährige Witwe wurde Regentin. Fünfundzwanzig Jahre lang regierte sie anstelle ihres Sohnes und beeinflusste mit bravourösen Intrigen die kaiserliche Politik. Die Nichtleserin konnte ein einziges Buch auswendig: Die Kunst des Krieges von Meister Sun.
Ihr Sohn trat seine Herrschaft nie an. Er starb, keiner weiß, wie und warum. Angeblich an Syphilis.
Cixi suchte sich einen Neffen als Marionettennachfolger aus. Sie hatte nicht vor, die Macht zu teilen und ließ ihn einsperren. Hinter den Mauern der Paläste der Verbotenen Stadt wälzte sich die Zeit und bettelte um Reformen. Von dieser Zeit wollte Cixi nichts wissen. Ihre Stunde aus Blei. Wenn überlebt. Lieber ließ sie ihren idyllischen Sommerpalast mit dem künstlichen See umbauen; die Rentnerin freute sich über das Gärtnern. In einer ausgerenkten Zeit ist das Gärtnern unbezahlbar. Ohne Rücksicht auf die Realität teilten die europäischen Mächte die Welt in Parzellen auf; auch in Afrika wurden neue Staatsgrenzen seelenruhig mitten durch Stammesdörfer und zerstrittene Gemeinschaften gezogen; mit gieriger Tusche malten weiße Hände Striche auf der Weltkarte. Im neunzehnten Jahrhundert besetzten die europäischen Mächte auch Teile von China. Cixi lehnte politische Verhandlungen ab und unterstützte den xenophoben Geheimbund der Fäuste der Gerechtigkeit und Harmonie. 1899 trieb sie Boxer auf die Straßen von Peking, hetzte sie gegen Ausländer auf, gab den Befehl zur Umzingelung des Diplomatenviertels und betonte immer wieder: »Wir haben die Länder, aus denen diese Menschen nach China gekommen sind, nicht ausgebeutet, wir haben uns deren Arbeitskraft nicht zunutze gemacht und schließlich diese Menschen auch nicht nach China eingeladen. Wir haben ein moralisches Recht, nein zu sagen. China sieht keine Notwendigkeit, im Rahmen der solidarischen Aufnahme europäischer Flüchtlinge seinen Lebensstandard abzusenken.«
Der Boxeraufstand wurde von den alliierten Expeditionsarmeen niedergemetzelt. Noch vor ihrem Tod gab Cixi 1908 den Mord am zukünftigen Marionettenkaiser in Auftrag.
Der kurze Botschaftsempfang geht zu Ende, und in der Stille erklingen Die Goldberg-Variationen von Bach. Der Diplomat denkt bei Variationen an Sexpositionen und begibt sich mit anderen Männern ins Bordell. Prostituierte sind trostspendende Drogen und schicksalslose Objekte, mit denen die Männer endlich nach eigenem Gutdünken verfahren können. Jede Runde beschließen sie mit einem Toast:
Čína, Tschina?
Čína, Tschina!
Tschin?
Tschin!
Tschintschin.
Die Vergangenheit liegt auf den gelben Augen der Schriftstellerin schwer wie Blei, es fehlt nicht viel, und sie kippt um. Die andere bleierne Last ist die Zukunft. Bleikugeln aus dem Weg räumen kann sie nicht. Sie weiß, wozu ein Mensch fähig ist.
Also weiß sie genau, wozu er fähig sein wird.
Pommerantsch schiebt vergeblich in seinem tausendjährigen Gehirn Steine hin und her. Unter ihnen wimmelt es von Insekten, sie stieben auseinander; die Gedanken wollen nicht ans Licht. Steinbrocken der Jahrhunderte, die er ehrlich hinter sich gebracht hatte, rollen in ihm herum.
In Europa werden Gelbe und Schwarze ausgelacht.
In China werden Weiße und Schwarze ausgelacht.
Die Blauelster lacht nicht. Heute ist nicht der Kommunismus das größte Übel. Heute ist es der ökonomische Pragmatismus. China als konvexer Spiegel von Europa.
Die Sonne steht hoch über der Stadt. Sie sieht aus wie ein zusammengerollter Kater.
In Peking werden die letzten Zickzackgassen und alte Häuser mit Innenhöfen genauso forsch umgebaut, wie während der Kulturrevolution alle Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Tempel und Kloster abgerissen wurden. Die Körper der Städte werden in riesige, von Mietshäusern und Banken gesäumte Einkaufszentren umgeformt. Viele der ambitionierten Projekte versanden aber wegen Geldmangels noch vor dem Bauabschluss. Und wenn nicht, herrscht dort oft eine exklusive Leere. Das Panorama der leeren Städte wird von Geistervierteln zusammengehalten. Die Kommunistische Partei hält sich an der Macht und wird es dank der nationalistischen Begeisterung auch weiterhin tun. Ein nationalistisch gesinntes Volk eines homogenen Landes verdrängt jeden, der nicht seine Tracht trägt. Der Nationalismus der Parteischinder verdrängt alle. Das Wesentliche: Magst du noch so gut gewesen sein – ist deine Legitimität nicht bestätigt, wird sie nicht geglaubt, und wem nicht geglaubt wird, dem folgen die Menschen nicht.
Das weniger Wesentliche: Magst du noch so gut gewesen sein – genießt du die entsprechende Achtung nicht, wird dir nicht geglaubt, und wem nicht geglaubt wird, dem folgen die Menschen nicht.
Die Kommunistische Partei hat Legitimität.
Sie hat die Unumerziehbaren wie Bazillen aus dem Körper der Nation verdrängt.
Als unumerziehbar gelten nicht nur Mitglieder nicht bewilligter Religionen, sondern auch ganze Minderheiten; ethnische Minderheiten, die im gesamtchinesischen Maßstab insgesamt nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung ausmachen, können doch in einem chinesischen Gebiet wie Tibet unmöglich sechzig Prozent bilden! Also verpflanzte die Kommunistische Partei haufenweise ethnische Chinesen nach Tibet, damit sie zahlenmäßig zur Mehrheit wurden, und es erwies sich als unschätzbar günstig, dass diese Menschen des Lesens und Schreibens nicht kundig waren. Nach 1950 wurden die ersten Klöster zerstört; die systematische Auslöschung der tibetischen Kultur begann.
»Gottesgebärerin«, sagte der älteste Sohn der Schriftstellerin zu ihr.
China hat Klöster geplündert, und in Tibet gibt es ein Museum der »Taugenichtse«.
Der Kommunismus hat im zwanzigsten Jahrhundert die Klöster Europas geplündert und den Menschen ihr Geistesleben geraubt. Bis heute zieht das schwarze Loch betrügerische Sekten an, und nationale Traumata werden von Esoterik geheilt.
Erst seit 1945 wird jegliche Vertreibung und Abschiebung einer Nation oder Volksgruppe wegen »Kollektivschuld« als unrechtmäßig angesehen. Die Tschechen haben ihre Nachbarn vertrieben, weil sie deutsch sprachen, und in der Alibi-Schublade mit der Aufschrift Nazi wurden logischerweise auch Kinder verschluckt, während den Tätern ein Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren samt Verteidigung eingeräumt wurde.
Der Krieg kennt keine Sieger. Alle sind Besiegte.
Tibet ist das Dach der Welt, für unumerziehbare Journalisten verboten. Offiziell weil es sich um ein gefährliches Gebiet handelt, durchsetzt von Spionen, Schmugglern und Terroristen. Dort, wo die Asphaltstraßen enden, steht freundlich die Militärpolizei. Zu Dörfern außerhalb der touristischen Hauptadern führen staubige Feldwege, und mitten in der Ödnis ragen Reklametafeln auf.
Wir danken der Kommunistischen Partei für alles.
Was wäre aus uns geworden ohne die Kommunistische Partei Chinas, was wäre von uns geblieben?
Der chinesische Präsident schenkt uns ein glückliches Leben, er ist Gott.
Zuerst die Nation. Danach die Familie.
Tomáš Garrigue Masaryk sagte, er diene seinem Land. Die heutigen Präsidenten Tschechiens und Chinas definieren sich selbst als Herrscher ohne Grenzen. Dabei sind sie nicht frei: Sie werden von ökonomischen Interessen angetrieben. Nicht von politischen.
Psychogramm wütender Männer. Diene einen einzigen Tag, und du bist ein Sklave. Besitze ein einziges Mal vier Unzen Silber, und du bist ein Geschäftsmann.
Dem tschechischen Botschafter perlt der Schweiß auf der Stirn. Er ist zum Rapport auf den gestickten China-Teppich einbestellt worden. Sein Land und die Hauptstadt Prag wurden vom Dalai Lama besucht, und er weiß nun beim besten Willen nicht, mit welchen Worten er das Unverzeihliche entschuldigen soll. Die Freiheit unabhängiger, selbstständiger europäischer Staaten interessiert hier niemanden. Es ist genau wie damals, als er in den Kreml vorgeladen wurde. Pommerantsch amüsiert sich und kann den Blick nicht vom Körper des Botschafters lassen.
Der Botschafter sagt nicht A und sagt nicht B; der gemeine Mann ist nachlässig mit sich selbst, er lügt sich in die Tasche und den anderen etwas vor. Die alte erprobte Taktik der Normalisierungszeit; ach, die guten alten Zeiten aus Blei. Mit den hiesigen Machthabern schließt er genauso schnell Kompromisse wie mit den sowjetischen Okkupanten nach dem August 1968. Der Großteil der Bevölkerung neigt ohnehin dazu, die Ideale von gestern blitzschnell zu vergessen.
Der Botschafter mag das Tauwetter von 1968 gern. Das Tauwetter von 1968 gab den Stalinisten nämlich Recht.
Damals folgte man dem Moskauer Protokoll unfreiwillig.
Heute folgt man den Pekinger Protokollen freiwillig; womöglich wird das alte aus Moskau einfach nur fortgesetzt. Keiner beweint verschüttete Milch, und der Botschafter braucht lediglich dafür zu sorgen, dass die hiesigen und dortigen Unumerziehbaren nicht an einer Atmosphäre eines gemeinsamen Willens arbeiten und die Unabhängigkeitsbestrebungen nicht weiter bestärken. Der Botschafter muss seine Unumerziehbaren loswerden; die Unumerziehbaren versuchen ihn daran zu erinnern, Tschechien sei ein unabhängiges, demokratisches Land, und die Freiheit werde niemandem geschenkt, die müsse erkämpft und gewöhnlich auch mit Blut bezahlt werden. Warum sollte man sie also freiwillig aufgeben? Heutzutage könne jede Okkupation verhindert werden. Auch die ökonomische.
Der Botschafter muss seine Unumerziehbaren loswerden, weil sie ihm ins Gesicht schreien, dass sie keine Satelliten der Sowjetunion sein wollten und kein Satellit von China sein wollen. 1968 habt ihr als Politiker gegen die eine Okkupation aufbegehrt, die ökonomische Okkupation von heute nehmt ihr freiwillig in Kauf, brüllen sie. Auf der Stirn des Botschafters vermischt sich Schweiß mit Blut. Damals kannte er die Mannschaften auf dem Spielfeld Ost gegen West gut. Heute haben sich die Mannschaften vermischt.
Er bleibt nebulös: Zensur und Kompromisse, freches, beleidigendes und listiges Handeln. Kann er sich als ehemals hochrangiger, an die Partei gebundener Geheimdienstler überhaupt anders verhalten? Vor lauter selbstloser Loyalität zur hiesigen kommunistischen Partei und dem aufrichtigen Wunsch, sich ihr nicht »in den Weg« zu stellen, hat er die Hosen voll, vor lauter Angst, etwas zu verpatzen.
Die Unumerziehbaren mit dem Freund an der Spitze schreien, dass selbstentschuldigende Erklärungen bei den chinesischen Kommunisten nichts bringen. Das sei Wasser auf deren Mühlen, Zurückweichende ließen sich besser angreifen. Nur eine feste Haltung sei wirksam; die Chinesen haben das Land der Tschechen genau studiert, wir das chinesische nicht.
Der Kreml führte 1968 die Invasion durch und war sich sicher, dass er in der Tschechoslowakei auf keinerlei Widerstand stoßen würde; keine Verunsicherung, kein Geschrei. Peking kennt das damalige Moskauer Protokoll; nur ein Mann aus der tschechoslowakischen Delegation unterschrieb es nicht, František Kriegel, und das Kapitel »Der Schwur von Qin« im Buch der Urkunden vermerkt: Hätte ich wenigstens einen einzigen in Wahrheit festen und entschiedenen Minister gehabt! Er hätte mit keinen besonderen Eigenschaften hervorstechen müssen, ausgeglichenes Denken hätte gereicht! Denn so einer hätte sicherlich auch die notwendige Toleranz! Würde jemand anders über besondere Gaben verfügen, würde er ihn als den Seinen ansehen. Und auch wenn jemand anders mit außergewöhnlicher Weisheit auffallen würde, würde er ihn aus vollem Herzen lieben und ihn als den Seinen annehmen, um seine Nachfahren und das ganze schwarzhaarige Volk noch besser und zum Vorteil aller zu beschützen!
Hingegen, wenn einer mit besonderen Gaben auffällt und wir ihm aus lauter Neid und Gehässigkeit nur Hass entgegenbringen, wenn jemand außergewöhnliche Weisheit besitzt und wir uns gegen ihn stellen und ihm Knüppel zwischen die Beine werfen, ohne einen Funken Toleranz, nicht das Wohlergehen unserer Nachfahren und des gesamten schwarzhaarigen Volkes bedenkend, dann sage ich: Wehe uns!
Damals war Pommerantsch glücklich, dass wenigstens František Kriegel betonte, nicht ein Organ seines Landes hätte diese Delegation zusammengestellt und mit einem Verhandlungsauftrag nach Moskau geschickt; sie seien vielmehr gekidnappt worden. Die übrigen Politiker verhielten sich wie schuldbewusste Untertanen und fragten den russischen Bären nicht einmal, ob sie überhaupt auf seiner Liste standen. Sobald ihnen Moskau die bleiernen Handfesseln abnahm, verwandelten sie sich vor den Augen der ganzen Welt in eine offizielle Parteidelegation. Selbstbewusste Vertreter eines Staates benehmen sich anders.
Pommerantsch ist der Meinung, sie hätten etwas riskieren müssen. Widerstand hätte eine moralische und symbolische Auswirkung auf die gesamte Nation gehabt. Die auf die Okkupation folgende Zersetzung hätte es nicht gegeben, oder sie wäre wenigstens langsamer vonstattengegangen. Die Zersetzung dauert an. Tschechische Politiker verhalten sich gegenüber Russland oder China weiter wie schuldbewusste Untertanen, legen sich die bleiernen Handschellen freiwillig an.
So viele Möglichkeiten für moralische Mobilisierung einer Nation. Aber für welche? Auch die Führung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei hätte sich 1968 stolz und mündig verhalten können, sie hatte ja einen großen Rückhalt in der Gesellschaft. Das bürgerliche und nationale Selbstbewusstsein war erwacht, das Gefühl von Stolz, Mündigkeit keimte auf, und vielleicht hätte der tschechische Kommunismus eine ähnliche Position erlangt wie unter Tito in Jugoslawien oder unter Ceaușescu in Rumänien.
Die Kommunistische Partei Chinas befand sich in einer anderen Situation. Hätte sich die Parteiführung 1989 stolz und mündig verhalten, wären ihr seitens der chinesischen Gesellschaft, in der kein bürgerliches und nationales Selbstbewusstsein erwacht und kein Gefühl von Stolz und Mündigkeit aufgekeimt war, womöglich kein Rückhalt und keine Unterstützung sicher gewesen. Zu lange sitzen in China die Titos und Ceaușescus an der Macht.
Die Brillen, mit der sie die Welt betrachten, haben immer die gleiche Marke.
Doch richtet sich der gemeine Mann im Müßiggang ein, ist ihm nichts schlecht genug; dann fühlt er sich in Anwesenheit eines Edlen unwohl, beginnt die eigene Unvollkommenheit zu kaschieren und die Vollkommenheit herauszustellen.
Aber was bringt es, wenn der andere ihn sowieso durchschaut, als prüfte er ihn direkt auf Herz und Nieren. Dazu wird gesagt, Wahrhaftigkeit zeige sich nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Deswegen muss der Edle wach und aufmerksam bleiben, vor allem in Bezug auf sich selbst!