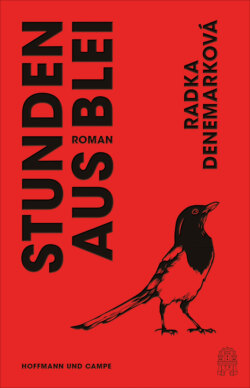Читать книгу Stunden aus Blei - Radka Denemarkova - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wortlose Opfergaben
ОглавлениеMurmel versucht an der Prager Karls-Universität Fuß zu fassen. Sobald er vor eine größere Menschengruppe tritt, beginnt sein Körper zu schwitzen, gibt ein theatralisches Hüsteln von sich und erstarrt. Auf Murmels Stirn perlt der Schweiß, und die Studenten wittern Unsicherheit. Zu Beginn des Seminars schwebt sie kaum sichtbar in kleinen Wölkchen um ihn, am Ende der bleiernen Stunden haben sich die Wolken verdichtet, und der Körper schwitzt Blut. Jede Frage, mit der die Studenten ihn testen, bläht die Unsicherheit weiter auf. Unsicherheit kann nicht anleiten, sie kann nicht lehren.
In seine Sprechstunden kommen sie jedoch scharenweise. Bereitwillig leiht er ihnen teure Bücher, die sie ihm nicht zurückbringen. Er nennt ihnen ausländische Bibliotheken und Webseiten. Kopiert und druckt Material für sie aus, das angeblich nirgendwo zu bekommen ist. Am Ende ertappt er sich dabei, dass er ihnen nicht nur die Fragestellung der Seminararbeiten vorab erklärt und kommentiert, sondern auch unauffällig ausarbeitet. Mit Schrecken starrt er auf den Bildschirm; Wikipedia spuckt ein Portrait von ihm aus, das lügt. Vergeblich bemüht er sich um Korrektur. Ein Student mit Minderwertigkeitskomplexen und dem Spitznamen Tatze verhindert die Berichtigung, verfälscht ironisch alle Daten samt Murmels Geburtstag, blockiert den Zugang; wobei er durch Murmels Webseite rast wie durch ein nächtliches Museum. Murmel lebt an der Zeit vorbei, dabei ist er nicht einmal alt. Die Generation des neuen Jahrtausends, die sogenannten Millennials, sie leben in den Neuen Medien. Manche von ihnen können keine Landkarten lesen, haben ein löchriges Gedächtnis, merken sich nichts und lesen nur Überschriften und Werbung; für längere Texte fehlt es ihnen an Konzentration. Man kann sie leicht für dumm halten; auf Twitter goutieren sie mit großem Genuss dumme Politiker- und Präsidentensprüche. Ob solche Sprüche stimmen, ist vielen Studierenden egal; es lügen doch sowieso alle. Murmels Spruch – weniger zu wissen, dafür aber fundiert, sei besser, als an allem nur zu nippen, denn das bedrohe die Demokratie – verstehen sie nicht.
Wikipedia hat solide Nachschlagewerke zerstört. Dass es keine Möglichkeit gibt, sich zu wehren, macht Murmel fertig; er möchte nicht Google zum Opfer fallen, er will seine Sicht der Welt behalten. Gäbe es in der akademischen Welt Gerechtigkeit, dann … Bei der Institutsleitung findet er keine Hilfe; aggressive und beschränkte Mitglieder verhindern, dass Murmel höher eingestuft wird und einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt. Er selbst wiederum hatte beim Bewerbungsverfahren um die Position des Institutsleiters dem jetzigen Leiter nicht seine Stimme gegeben und später bei einer Institutssitzung die erhöhten Ausgaben im Bereich Massenmedien und Sport kritisiert; glotzen sei leicht, studieren sei schwer. Man wirft ihm vor, zu wenig Studierende zu haben. Vergeblich weist er auf den Zusammenhang zwischen niedrigen Zuhörerzahlen und anspruchsvoller Lehre hin, heutzutage komme doch jeder Dozent den Studierenden entgegen und verlange ihnen bei den Prüfungen kaum etwas ab, weil die Einrichtung Studenten für die Finanzierung braucht. Im ganzen Institut gibt es nur wenige Menschen, mit denen Murmel sprechen kann. Er versteht seine Zeitgenossen nicht mehr. Allen, auch den begabtesten, scheint etwas Trauriges zugestoßen zu sein. Der geistige Radius seiner Kollegen ist auf die Größe eines Vorstadtgartens geschrumpft. Jüngere Dozenten können niemals all die Intrigen in den Fluren ihres Instituts und in ihrem eigenen Leben entziffern. Sie reden sich ein, nur ihre Welt sei wahr, und ziehen die machtlosen Studierenden in ihre Pseudowelt hinein; dabei schert es niemanden, wie es den Studierenden geht.
Murmels Ansehen zerfällt zusehends. Wie dumm, dass er sich vor den Studierenden hat hinreißen lassen, seine Meinung über den Literaturnobelpreis kundzutun. Ein Musiker wurde damit ausgezeichnet, zwar ein von Murmel geschätzter Musiker, aber er hätte einen Preis für Musik bekommen sollen, nicht für Literatur, was sei denn das für eine Botschaft, Bücher zum schnellen Hören? Bald werde man wohl im Bereich der Medizin auch Heilpraktiker auszeichnen und den Nobelpreis für Mathematik an Buchhalter vergeben. Den Hass im Hörsaal hätte man schneiden können.
»Ist ja nur meine Meinung«, stottert er entschuldigend. »Ich respektiere wiederum Ihre Meinung. Wer liest, denkt nach, und wer nachdenkt, lässt sich nicht manipulieren.«
Eine Hand schnellt in die Höhe.
»Ich muss mal.«
Der Student deutet beim Gehen an, er müsse sich übergeben, der Hörsaal lacht. Je stärker Murmel die anderen für sich gewinnen möchte, je öfter er betont, dass er keine Gegenleistung erwartet (aber doch, natürlich erwartet er etwas, nämlich Respekt!), desto isolierter, übermüdeter und verstimmter kommt er sich vor, desto weniger geschätzt; er fürchtet, der Bogen ist überspannt und wird bald reißen. Seine alten Eltern besucht er selten.
Heute sitzt er bei ihnen am Tisch. Neffe und Nichte, vierjährige Zwillinge, rasen durch die Wohnung. Sie rempeln gegen das Tischchen im Flur und bringen die Vase zum Klirren: Der Hans-Makart-Strauß aus getrockneten Blumen, Palmwedeln und Gräsern raschelt. Ihr Stiefbruder David ist nicht hier; er lebt das selbstständige Leben eines Mittelschülers. Die Zwillinge bestürmen Murmels Vater und ziehen an seinem weißen Bart. Mach den Mund auf, Opa, zeig deinen Schatz. Im rosigen Zahnfleisch blitzen goldene Backenzahnkronen auf.
Murmels Schwester erzählt von ihrem Mann und seiner Unternehmertätigkeit; der Mann ist klein und klug und rund und blickt gerne zu seiner Frau auf. Sie redet nun von ihrer Arbeit; ihre Arbeit ist es, die Zähne anderer zu reparieren. Der weißbärtige, stattliche Vater riecht nach Pfeifentabak und ist stolz auf seine Tochter; sie als Zahnärztin hat die Tradition der Familie nicht gekappt.
Murmel schon. Er hätte sie nicht kappen dürfen – aus unausgesprochener, aber verbindlicher Hochachtung vor Urgroßvater, Großvater und Vater. Sein Vater hat sein ganzes Leben lang gebohrt, plombiert, Zähne gezogen; am liebsten hätte er die Münder nicht betäubt. Am liebsten hätte er keine Spritzen verabreicht. Am liebsten hätte er ins lebendige Fleisch geschnitten und den Schmerz auseinandergebohrt und so sein Erwachsensein betäubt. Er hat seinen desinfizierten Finger in schmerzende Wunden gesteckt und sich danach gesehnt, sie mit Blei zu füllen. Eine Bleiplombe hätte den im Zahnarztsessel hockenden Organismus allmählich vergiftet. Schatten der Vorfahren geistern durch die Wohnung; an deren Stelle rücken, ihre Rituale übernehmen, ihre Musik spielen, diejenigen ehren, die sie geehrt haben, diejenigen lieben, die ihnen wichtig gewesen sind, den Toten dienen, wie man den Lebenden dient, denen, die gegangen sind, ebenso dienen wie denen, die noch da sind; das ist die höchste Sohnestreue.
Am Tisch wird nicht einmal ansatzweise erwähnt, dass Murmels Schwester in den vergangenen zwanzig Jahren vor allem die Mutterrolle ausgefüllt hat; sie lebt nun in zweiter Ehe. Als erste geschiedene Frau in der Familie fühlt sie sich von allen beäugt; man sieht nicht die Zahnärztin in ihr, nicht eine vierzigjährige Frau, sondern eine komische, seltsam kapriziöse, freche Tochter mit losem Mundwerk; sie hat sich von ihrem Mann getrennt, sich von ihm scheiden lassen, keiner weiß, warum, sie hat halt ihren eigenen Kopf; die Eltern sind der Meinung, die Tochter wisse nicht, wie man einen Mann glücklich macht. Während der Scheidung sagte ihre Mutter zum Schwiegersohn, mit der sei es wohl nicht auszuhalten, wie? Und riet der Tochter, sie solle nicht allein bleiben, solle sich jemanden suchen, ach, möge ihr doch eine Beziehung wie die ihrer Eltern vergönnt sein. Und fügte gleich hinzu, die Tochter solle aufpassen, sich keine neue Last ans Bein binden. So hat die Mutter vorgesorgt: Was immer passiert, sie wird es vorhergesehen haben. Sie ist doch sowieso diejenige, die alles schlucken muss; ihre Tochter hat drei Kinder von zwei Männern.
Wie die anderen erwähnt Murmels Schwester ihren Exmann nicht; sie hat ihm ihre Jugend auf einem Silbertablett serviert, umsonst. Seltsamerweise aber bleibt ihr Leben vom Vater des ersten Kindes beeinflusst, obwohl weder sie noch ihr Sohn mit ihm verkehren. Besser gesagt, er verkehrt nicht mit ihnen; sein ganzes Verhalten fußt auf einfachem Kalkül. Den Unterhalt zahlt er nicht zum Wohl des Kindes. Er zahlt die festgelegte, lächerlich niedrige Summe nur aus Angst vor den möglichen Folgen des Nichtzahlens, vor dem Schaden, den das Schmähwort Schuldeneintreibung in seiner Firma und seinem Lebenslauf anrichten würde. Geld hat er genug. Er schickt ausreichend viele Kormorane in die Welt. Für ihren ehrgeizigen Besitzer holen sie die fetten Fische aus dem Wasser. Bis heute verdienen die Fischer in Zentral- und Südchina ihren Lebensunterhalt mit der Hilfe von Kormoranen. Auf dem Fluss schwimmen hölzerne Fischerboote und Bambusflöße. Von ihnen flattern Kormorane ins Wasser und tauchen nach Beute; von klein auf wurden sie darauf abgerichtet, sie abzuliefern. Um den Hals tragen die Kormorane einen Ring oder ein Lederband, damit sie den Fisch nicht schlucken können. Bleierner Schmuck, den die Fischer von Zeit zu Zeit lockern; ihre Lieblinge dürfen jeden siebten Fisch selbst schlucken.
Sonst würden die den Fischern anvertrauten Kormorane ihnen die Zusammenarbeit verwehren.
Murmel geht seinem Vater auf die Nerven; mühsam muss er aus dem Sohn herauskitzeln, was der eigentlich macht, wie es ihm geht, in welche Richtung sich seine akademische Laufbahn entwickelt. Murmel liefert bloß allgemeine, erwartbare Antworten, das Gespräch wird vom Geschrei der Zwillinge und dem Klirren der Vase mit dem Makart’schen Blumenstrauß untermalt. Die Antworten bleiben ihm im Hals stecken; bis plötzlich die Wahrheit herausgeblubbert kommt wie aus einem verstopften Abfluss:
»Wahrscheinlich … ist es nichts für mich.«
»Was ist nichts für dich?«
»Die … Uni.«
»Der Anfang ist doch vielversprechend. Eines Tages leitest du das Institut.«
»Ich kann nicht lehren.«
»Unsinn! Jeder kann lehren. Am besten erinnert man sich an die Dozenten am Rednerpult, die absolut unverständlich waren.«
»Solche Leute … haben eine Ausstrahlung. Ich bin kein Rhetoriker. Ich mache mir keine Illusionen. Ich bin nicht allwissend. Vor aggressiven Fragen weiche ich zurück.«
»Aber du hast doch eine tolle Stelle.«
»Das schon.«
»Und ein Forschungsstipendium.«
»Das schon.«
»Also?«
»Ich habe mich … beurlauben lassen.«
Den Vater reizt die Dumpfheit seines Sohnes. Sie haben die Rollen getauscht; der Sohn ist ein Rentner, der sein Leben bereits hinter sich hat. Der Vater stellt die Fragen und weiß die Antworten gleich selbst.
»Schreibst du an einem Buch? Wunderbar, bearbeite doch deine Dissertation, erweitere sie. Das freut mich. Auch die Mama freut sich. Die Mama besonders.«
Die Mama ist vor lauter Freude gespannt wie ein Flitzebogen. Die Entwicklung freut sie tatsächlich, aber klug wie sie ist, hört sie genau, was der Sohn sagt. Sogar als Waise hat sie es damals geschafft zu studieren und sich der Wissenschaft zu widmen; sie hat über den Erwerb der Muttersprache bei Kleinkindern geforscht. Jetzt sitzt sie ihrem Sohn gegenüber, und der Sohn stottert. Sie hat einen fremdländischen Namen für ihn ausgesucht und ihn in seiner ganzen Kindheit zärtlich verballhornt; sie hat nicht verstanden, dass der Sohn den verhassten Namen wie einen Schandfleck durchs Leben tragen würde, wie ein Kainsmal, einer Zielscheibe gleich.
»Nein, ich …«
»Was, nein?«
»Also … ich habe …«
»Was?«
»Ich habe etwas Neues angefangen.«
»Etwas Neues?«
»Ein Studium.«
»Du studierst?!«
»Eigentlich nicht mehr.«
»Nicht?«
»Bin gerade dabei … ein anderes Fach … abzuschließen.«
»Du bist doch keine vierzig mehr. Was ist mit dem Stipendium in Paris?«
Wie soll er es den vor ihm sitzenden Autoritäten erklären? Ja, er ist über vierzig, weit über vierzig, aber er weiß nicht, ob er damals das richtige Fach gewählt hat. In diesem Haus wird eine solche Mitteilung zu einem Auftritt vor erzürntem Tribunal, das meint, mehr vom Leben zu verstehen als Murmel selbst; das Tribunal hat den Sinn des Lebens geknackt. Jede Abweichung davon erscheint wie eine lächerliche Kapriole.
Wie soll er es ihnen erklären? Ja, die sagenhafte Stadt Paris und ja, er als gastierender Universitätsassistent. Aber schon die Fahrt zur Uni dauerte fünfundvierzig Minuten. Ja, sicher, umgeben von dieser Wahnsinnskultur. Aber die kostet verdammt viel Geld. Außerdem war er abends todmüde und konnte sich zu nichts mehr aufraffen. Das Anhäufen von Wissen und fünfzehn Minuten Ruhe wogen mehr als ein Sack Gold.
Wie soll er es ihnen erklären. Ja, auch seine ehemaligen Kommilitonen arbeiten nicht mehr in ihrem ursprünglichen Fach. Sie haben anderswo Fuß gefasst, ihrem Englisch sei Dank. Murmel kommt es vor, als hätte er den Anschluss verpasst. Wäre in einen falschen Zug gestiegen. Oder an einem gut sichtbaren Abfahrtsschild vorbeigerast.
Wie soll er es ihnen erklären. Ja, das akademische Milieu hat ihn regelrecht enttäuscht. Eine unterkühlte Höhle, vollgestopft mit selbstverliebten Idioten. Sie reiten auf Tatsachen, Details, Daten, Kommas und Fußnoten herum, kriegen das Gesamtbild aber nicht mit. Wird die geistige Begrenzung eines Wissenschaftlers etwa durch seine Spezialisierung größer? Die sinnlosen Kästchen, Schubladen, Formen und Bedingungen, schon ihre bloße Existenz engt das Denken ein. Man beschreibt die Geschichte der Erde in Tagesschritten, begreift aber die Zusammenhänge nicht.
Murmel träumt von den Zeiten, als Wissenschaft und Kunst noch eine Einheit bildeten und die Freiheit der Gedanken keine Grenzen kannte. Ein Intellektueller kann sich unmöglich wohlfühlen zwischen erstarrenden Kategorien, Mama. Überall Spezialisten, aber keine Denker. Bis heute schüttelt man den Kopf darüber, dass so viele Spitzenwissenschaftler mit den Nazis zusammengearbeitet haben, Papa. Entweder haben sie den Kontext nicht begriffen oder er war ihnen gleichgültig. Das Anhäufen faktographischer Details läuft total am Wesentlichen vorbei. Die Wahrheit versteckt sich hinter der Faktographie, und die Wirklichkeit wird durch ebenjene Faktographie gefälscht, Mama. Er, Murmel, kenne Kollegen, die nur dann ihre Texte schreiben können, wenn sie Ritalin oder das aus den USA mitgebrachte »Focus Factor« einnehmen; wer sich nicht konzentrieren kann, der wirft eine Pille ein, und weiter geht’s. Das hat sich alles nicht geändert, und nichts wird sich ändern. Nur lauter Froschmäusekriege und Kämpfe um Stipendien, immer weitere Neuauflagen von Mukařovský und vom Strukturalismus, immer neue Abrisse der Geschichte der autochthonen tschechischen Literatur, ohne Kontext und Bezug. Alle haben Angst vor der Literatur und vor dem Leben, und versnobte Künstler kennen nur die Städte New York und Berlin und die Namen von Franz Kafka und James Joyce. Versnobte Wissenschaftler kennen nur die Harvard University und Oxford und Cambridge. Die ständige Forderung zu publizieren, Artikel für wissenschaftliche und gerankte Zeitschriften, die dann keiner liest! Es ist wie mit den Briefen, Mama. Briefe aus Lagern, den nazistischen und kommunistischen und denen von heute, wo nur bestimmte Themen erlaubt waren. Und nicht einmal witzig schreiben durfte man, als würde eine Prise Humor gleich die Gefängnisstrafe schmälern. Einmal die Woche ein Brief ohne Humor oder Ironie, gut lesbar, ohne Korrekturen oder Streichungen, mit brav eingehaltenem, vorgeschriebenem Rand und den graphischen und stilistischen Anordnungen. Den Gefängnisinsassen wurden Anführungsstriche, Unterstreichungen und Fremdwörter verboten. Auch die dümmsten Gefangenen haben kapiert, dass ein verständlicher Text nicht durchkam. Möglichst kompliziert und verschwurbelt geschriebene Texte hatten eine größere Chance, nach draußen zu gelangen. Man gewöhnt sich an Beschränkungen und Zensur aller Art. Alle machen das, alle passen sich an.
Alle lassen sich am Faden führen, Mama. Auch in der akademischen Welt. Sie kauen längst Geschriebenes und Durchdachtes wieder und benutzen dazu Technokratenjargon. Flächendeckend übernehmen sie die zweckentfremdete Sprache der Naturwissenschaften und stoßen an die Grenzen ihrer mangelnden Phantasie. Sie begreifen nicht, dass Geisteswissenschaften und Philosophie Metaphern brauchen. Diese Sprache ist ihrem Wesen nach viel poetischer als die traditionelle Philosophensprache, Mama, und deswegen darf man die Sätze nicht wörtlich und die Worte nicht buchstäblich nehmen. Dann bleiben aber seine, Murmels, liebste Autoren natürlich für die Kollegen unlesbar, die übersichtlichen und klaren, die reinsten überhaupt, Nietzsche, Hölderlin und Kafka. Diese Autoren bekommen schlecht sitzendes Zaumzeug. Nietzsche, das Thema von Murmels Dissertation, Ein antijudaistischer Philosemit; anders als durch ein Paradox lässt sich das doch nicht sagen, Papa! Ich liebe die Literatur. Literatur ist menschliche Gemeinschaft, mittels Sprache hergestellt. Literatur ist die Unsterblichkeit des menschlichen Geistes. Die akademische Welt ist verknöchert und hat sich auf den Horizont von Gartenzwergen herunterbrechen lassen. Die Klügsten und die am wenigsten Umerziehbaren fliegen gleich aus dem Reigen raus. Es geht um Stärke, so ist es doch.
Ich weiß Papa, ich sollte mich nicht beklagen. Ja, du hast es viel schwerer gehabt, natürlich, zu deinen Zeiten wurde die Bildung durch Ideologie beschnitten, aber das heißt doch nicht, dass heute nicht eine andere Ideologie an ihr zerrt. Gebildet zu sein heißt noch lange nicht, kulturbeflissen und moralisch zu leben, Mama. Angehäuftes Wissen ist ein Mittel, um an die Macht oder an eine Stelle zu kommen, eine Maske, mit der man die Frauen blenden kann, mit der man sich vor Ungebildeten aufplustern kann. Wissenschaftliche Unverträglichkeit gehört nicht in den Bereich der Literatur. Die junge Generation interessiert sich für Stoffe, die ihre Leistungsfähigkeit vergrößern, für energetische Getränke, Amphetamine, Speed, Kokain. Ja, vor wichtigen Prüfungen verabreichen Eltern ihren Sprösslingen auch Kokain, Mama.
Murmel prahlt vor den Eltern mit seinen Meinungen und mit dem Wissen von Konrad Paul Liessmanns Theorie der Unbildung und Václav Havels Essay Anmerkungen zur Halbbildung, ja, Mama, die wirklich globalen Werte werden in unserem Land – und zwar noch mehr als woanders – nicht vor dem Hintergrund unserer Kulturbeflissenheit durchgeboxt, sondern eher in Opposition dazu; was meinst du, wie es bei Leuten wie Karel Hynek Mácha gewesen ist, bei Franz Kafka, Leoš Janáček, Milada Součková, aber auch bei Jaroslav Hašek. Wie oft schon haben Intellektuelle mit ihrer selbstverliebten Verblendung und gedanklichen Verantwortungslosigkeit die Welt ins Unglück gestürzt, Mama.
Aber es gibt doch auch ein inneres Leben, Papa! Murmel schreit den zutiefst erstaunten Eltern seine gesamte Unzufriedenheit ins Gesicht, und seine Ohren hören die tausend Jahre alte Antwort des Meisters. Zi Gong sprach: Was man mir nicht antun soll, das will ich auch anderen nicht antun.
Konfuzius aber sagte: Oh, so weit bist du noch nicht.
Murmel freut sich morgens auf das Mittagessen und mittags auf den Schlaf, den leeren und formlosen Schlaf. Er fühlt sich wie ein Tier und fragt sich, ob die Fähigkeit, besonders tief zu schlafen, auf eine Krankheit hinweist. Früher hat er unter Schlaflosigkeit gelitten und sie stolz als Zeichen für seine Sensibilität verstanden. Vor Jahren einmal hat er ein einsames Wochenende auf der Fakultät und in der Universitätsbibliothek verbracht. Er las herum, korrigierte Seminararbeiten; eine Bibliothek ist ein gefährliches Nest des Geistes. Zitternd wie ein kleiner Rattler hielt er für sich selbst im menschenleeren Lesesaal seine Vorlesung, mit geschlossenen Augen. Als ihn der Hunger packte, bestellte er sich eine Pizza. Unter dem Pappdeckel lag aber nicht die bestellte Pizza Margherita, sondern eine Pizza Hawaii. Murmel trat auf die Straße und warf die unberührte Pizza so ungeschickt in den Mülleimer, dass sie samt Verpackung auf den Gehsteig rutschte. Augenblicklich tauchte die Schnauze einer streunenden Katze mit orangefarbenem Fell auf, aber auch die Katze nahm keinen Bissen. Sie schnupperte lediglich an der aufgesprungenen Pappschachtel herum und leckte viermal über die einzige aufgedruckte Zeile; auch die Zunge hatte die scharfe Farbe einer Orange. Die Katze sah Murmel mit ihren geduldigen gelben Augen an. Und so fasste er angesichts der flachen sechseckigen Pappschachtel mit der Aufschrift Made in China einen Entschluss. Er würde wiedergeboren werden und alles verwerten, was er bis dahin erlebt hatte. Er brauchte Sicherheit im Leben, und sein Fach bot ihm keine. Um wie die großen Weisen die eigene Vorstellung in Wirklichkeit zu verwandeln, muss der Mensch felsenfest von sich selbst überzeugt sein. Ich habe einmal einen ganzen Tag ohne einen Bissen verbracht, eine ganze Nacht kein Auge zugetan, nur gegrübelt und nachgedacht. Alles für die Katz! Es geht doch nichts über das Lernen!
Das Studium der Sinologie hat er inzwischen beendet und wird weiter studieren. Den reinen Weg der Erleuchtung, die Meditation, mag er nicht. Er wird nach Peking fahren. Unter den Studenten ist er der Älteste, die anderen finden ihn merkwürdig, der hat doch einen an der Marmel, er ist ein Alien. So soll es sein. Er ist der beste Student, hochmotiviert. Mit einer solchen Motivation kann keiner seiner Kommilitonen aufwarten. Murmels Motivation versetzt Berge. Er studiert um sein Leben.
Die Uhr zeigt seine Zeit an.
Murmel kann es sich nicht erlauben, noch mal in den falschen Zug zu steigen; die grübelnd verbrachten Stunden machen ihn unruhig. Panik greift nach ihm. Er phantasiert von Tattoos. Oder von einer Reise nach Indien, Thailand oder Indonesien, nach Sri Lanka. Aber nicht einmal für diese Länder, die von jungen Menschen gestürmt werden, reicht sein Geld; er hat nie viel Geld gehabt, und wenn, dann konnte er damit nicht haushalten. Er beantragt ein Aufenthaltsstipendium in dem fernen Land, damit er in dieser Ferne Fuß fassen kann.
Unter seinen Kommilitonen fällt ihm eine kluge dunkelhaarige Frau auf. Er hilft ihr mit ihrem Essay Zehn Erläuterungen von Meister Zeng zum Grundtext des Großen Lernens. Der Kommentar bezieht sich auf die Grundlagen der chinesischen Kultur, die ursprüngliche Ordnung einer Gemeinde und den Archetyp der erleuchteten Herrschaft, die auf moralischer Wahrhaftigkeit basiert. Ohne diese kann es keine Herrschaft geben.
Die Frau trägt weite Hosen und flatternde Sweatshirts, sie steckt ihren zerzausten Haarknoten mit einem gewöhnlichen Bleistift fest, statt mit einer Nadel. Bestimmt kauft sie nur in Secondhandläden ein. Jedenfalls lässt sie deutlich erkennen, dass sie wenig Wert auf Kleidung und Äußeres legt. Murmel lädt sie zum Essen ein, und der Haarknoten marschiert schnurstracks in ein japanisches Restaurant im Zentrum von Prag. Sonst kippt sie sich gern in den Spelunken von Žižkov einen hinter die Binde. Hier probiert sie nicht nur Sushi; Fisch, Rettich, Pilze, Miso-Suppe, Eiercreme mit Garnelen, Asahi Bier, Saké.
»Ich liebe es, die Essgewohnheiten verschiedener Länder zu vergleichen. Bei uns schießen in den letzten Jahren vegetarische oder vegane Restaurants aus dem Boden. In Indien stand auf einer Tafel vor einem Restaurant non veg. Nichts für Vegetarier. In Indien ist Fleisch die Ausnahme, anders als bei uns.«
Beim zweiten Abendessen steuert die Frau mit dem Haarknoten das Restaurant Kampa Park an der Moldau an. Die Dunkelhaarige ordert gefüllte Wachteln, Kalbsfleisch in Trüffelsauce und Schokomousse mit Rhabarber. Murmel hat nicht genug Geld auf der Karte, geschweige denn im Portemonnaie, zitternd blättert er ein paar schmuddelige Banknoten hin. Der Haarknoten schiebt die zerknüllten Banknoten in Murmels verschwitzte Hand zurück und bezahlt; dem Kellner zucken kaum sichtbar die Mundwinkel, und seine Augen nehmen nur von der Frau Abschied. Am nächsten Tag an der Uni grüßt der Haarknoten Murmel nicht, es folgt eine kühle Mail, er möge so freundlich sein und ihr Die Zehn Erläuterungen von Meister Zeng rechtzeitig zukommen lassen.
Er rettet sich in die Arbeit. Das große Lernen und Das Buch von Maß und Mitte. Strittig ist die Echtheit der Titel, unter denen die Texte überliefert wurden. Sie sprechen doch alle die gleiche Sprache. Erst die Übersetzungen in westliche Sprachen lassen jeden Text erscheinen wie von einem anderen Planeten.
Zhong, die Mitte, das Zentrum, das Dazwischen.
Das Buch von Maß und Mitte ist eine Textsammlung, in der es um die ethische Vision des Handelns geht. Und um die Verwirklichung des Ideals vollkommener Ausgeglichenheit und Harmonie im menschlichen Tun, in der menschlichen Existenz, und zwar in jedem ihrer Aspekte und in jeder Ausprägung. Es geht um die Idee von Gleichgewicht und Chancengleichheit, um die ganz normale Chance auch für nicht Hochgeborene.
Konfuzius’ Feinde waren geistlose Gleichgültigkeit, die Berühmtheiten vor Ort.
Murmel will keine Perlen mehr vor die Säue werfen. Überall zu erzählen, was du unterwegs aufgeschnappt hast – das ist Verschwendung von Moralenergie.
Das Einzige, was ihm bleibt, ist eine neue Sprache. Ein neues, fernes gelobtes Land. Ein Paradies, in das man sich flüchten kann. Wo alles anders wird.
Wo Spiritualität zum Leben gehört.
Murmels Einstieg ins Sinologiestudium war so tief und intensiv wie einst in die Literaturwissenschaft. Der Beste in seinem Fach sein, der Beste auf der Welt. Wieder hörte er, wie außerordentlich klug er sei, wie anders; inzwischen wusste Murmel aber, klug ist, wer die anderen kennt. Wer sich selbst kennt, verzweifelt. Diesmal durfte er nicht über sich selbst stolpern, über sein Lampenfieber, seine Unsicherheit und Naivität. Bevor er die Haarknotenfrau zu dem schmachvollen Abendessen ausgeführt hatte, war sie ja von seiner Belesenheit geblendet gewesen.
»Du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Das griechische Wort piptein bedeutet auch fallen. Wahrscheinlich auch dies ein Übersetzungsproblem. Du fällst nicht zweimal in denselben Fluss. Heraklit hatte vermutlich Sinn für Humor.«
Seit dem peinlichen Abend war das Interesse des Haarknotens an Murmel abgeflaut; die Tatsache, dass er nicht genug Geld für das überteuerte Mahl hatte, ließ seinen Körper wie unter einer Tarnkappe verschwinden. Was hatte das zu bedeuten? Hat er versagt? Als Mann versagt? Wie soll er das den vor ihm sitzenden Autoritäten erklären? Seinem Vater und seiner Mutter? Nicht lügen. Konfuzius sagte: Höre ich bei Gericht einem Streit zu, geht es mir wie den anderen. Aber wenn es schon sein muss, so täte ich alles dafür, dass kein Streit vor Gericht kommt. Wem der Sinn für das Wesentliche fehlt, der zieht bloß Nutzen aus seiner Beredsamkeit und ängstigt die anderen. Da heißt es zu begreifen, was ein Stamm bedeutet!
Murmel ist gerührt, so was Schönes, der Sinn fürs Wesentliche, das qing. Es wird als Gefühl übersetzt, Rührung oder Laune. Es kann aber auch Liebe, Zuneigung oder sogar Leidenschaft bedeuten. In der Poetik beschreibt man mit diesem Begriff die Stimmung eines Gedichtes. Die innere Verfassung des Dichters im Einklang mit der inneren Beschaffenheit dessen, was er vor sich sieht. In diesem Sinne geht es um etwas wie die innere Wahrhaftigkeit der Dinge, der Wesen, der Menschen.
Vor seinen Eltern stammelt Murmel, erklärt mühsam, warum er Sinologie studiert, spricht von qing. Er spüre die Zukunft des Faches in den Knochen, ja natürlich. Es sei keine plötzliche Laune. In der Geschichte der Menschheit hat jede Sprache eine Zeit des Aufschwungs.
Er spricht ins Leere. Er spricht eine Sprache, die die Familie nicht versteht, die ihr nicht geheuer ist. Sein Vater hört ihm zu, die ältere Schwester schneidet für die Tochter ein Putenschnitzel klein, flüstert ihr etwas ins Ohr. Der korpulente Schwager knöpft sein Jackett auf, checkt Nachrichten auf dem Mobiltelefon. Sein kleiner Sohn guckt ihm über die Schulter. Murmel reißt sich mit aller Kraft zusammen. Solange sich die Regungen des Geistes wie Glück und Ärger, Trauer oder Freude nicht entwickelt haben, sprechen wir von Ausgeglichenheit. Sobald sich diese Regungen entwickelt haben und wir sie im rechten Verhältnis zueinander halten, sprechen wir von Harmonie.
Ausgeglichenheit ist das grundlegende Gebot unter dem Himmel, Harmonie ist der zum Ziel führende Weg unter dem Himmel.
Murmels Mutter drückt die dünne Mentholzigarette in einem kleinen Aschenbecher aus, Meißner Porzellan. Murmel sieht ihrer Hand dabei zu. China hatte fünftausend Jahre Zeit, um die Herstellung des Porzellans zu perfektionieren. Europa hat das Rätsel erst im achtzehnten Jahrhundert geknackt, das Meißner Porzellan war nur noch eine lachhafte Entdeckung. Murmels Freude hängt mit dem Daoismus zusammen. Zwei Dinge in Opposition. Jedes Risiko birgt die Möglichkeit eines herrlichen Gewinns. Und umgekehrt. Ohne Tradition keine Moderne. Auf Mutters goldenem Zigarettenetui steht ein Satz eingraviert. Er erinnert an den Gedanken des jüdischen Philosophen Martin Buber: Wichtige Worte sind immer zu zweit.
Mutter hantiert mit dem schmutzigen Geschirr. Murmel zensiert sich selbst, unterbricht sich und hält mitten im Satz über Harmonie inne. Er greift zwei Teller und legt sie aufeinander; die Reste von Polenta und Kartoffelbrei folgen der Mutter schmatzend in die Küche. Ihre zitternde, altersfleckige Hand balanciert Gläser auf dem Tablett; eins trägt deutliche Spuren des kirschroten Lippenstifts von Murmels Schwester.
»Brauchst du Geld?«
»Das nicht, Mama …«
Mutter blickt ihn nicht an und stellt das Tablett sachlich auf die Arbeitsfläche. Die Gläser rutschen zur Seite und klirren; ein Glockenspiel. Sie kennt das Muster traditioneller Männlichkeit gut, sie kennt die ewigen Eckpfeiler. Geld. Ehefrau. Kinder.
Und nichts davon hat Murmel. Sie wünschte, er würde das erfüllen, was ihr nicht zuteilgeworden ist. Sie steckt einen Stapel glattgebügelter Geldscheine in sein Portemonnaie; stärker könnte sie ihn nicht demütigen. Mutter ignoriert Bankhäuser und das Online-Banking, sie ignoriert sogar Überweisungsformulare und Schecks. Ihre Enkelkinder bekommen bis heute für ihre Milchzähne, Zeugnisse und Schulabschlüsse einen Umschlag geschenkt. Im gefalteten Briefpapier stecken ein paar Geldscheine, und von der Omi gibt es noch ein lustiges Bild, ein paar innige Sätze dazu. Sie hat keine Achtung vor Geld. Sie schätzt es nicht. Für sie spielt es keine Rolle.
»Weil du genug hast?«
»Glaubst du das?«
Die Mutter nimmt wahr, wie aus dem Leben ihres Sohnes das Selbstvertrauen schwindet; Wasser rinnt ihm aus der hohlen Hand, er verliert, was er nie im Überfluss hatte. Der Sohn wiederum nimmt wahr, wie er ihren Respekt verliert. Nur weil er ihrem Muster funktionierender Männlichkeit nicht entspricht. Noch viel schlimmer: Er hat sich nicht einmal darum bemüht, ihm zu entsprechen.
»Also China.«
»Hm.«
»Was willst du dort tun? Die sperren dich noch ein.«
»Und was soll ich hier tun?«
Die Mutter versteht seine Antwort anders. Sie kommt aus dem Schlafzimmer zurück mit vier weiteren vollgestopften Umschlägen.
»Aber …«
»Sei still. Für den Anfang. Braucht keiner zu wissen.«
Mutter hält immer noch Gastvorträge über Linguistik an der Uni; sie hat sich auf die Problematik bilingualer Kinder spezialisiert. Abwechselnd tippt sie auf der Schreibmaschine und auf der Computertastatur, und jedes Mal fühlt er sich von ihr überrumpelt. Die gebildete Mutter räumt das dreckige Geschirr vom Tisch. Dabei könnte sie sich sowohl eine Putzfrau als auch eine Köchin leisten. Keiner in der Familie kann sie überreden, eine Haushaltshilfe zu beschäftigen. Es käme ihr wie eine Beschneidung ihrer Rechte vor. Durch deren Inanspruchnahme sie sich immerfort selbst bestraft.
Keiner weiß, wofür.
Der Zug ist voll junger Flüchtlinge. Die Eltern bringen ihre dreijährige Tochter zum Prager Hauptbahnhof und sagen zu ihr, sie werde einen Ausflug mit dem lustigen Kinderzug machen; bald kommen sie nach, das versprechen sie. Sie trägt einen kleinen Koffer und ein neues, blaues Kleidchen, das wurde extra für die Reise genäht, einen Hut und einen gepunkteten Regenschirm; denn in dem Land, in das sie fahre, regne es dauernd. Sie hält den Papa an der Hand, in die andere hat ihr die Mama diese gepunktete Kostbarkeit gedrückt, die sie Parapluie nennt. Die Kleine hüpft die Stufen hinauf und betritt den Märchenzug. Die Eltern schieben es in ein Abteil zu zwei großgewachsenen Mädchen. Die Stimmen der Erwachsenen bitten die beiden, sie möchten gut auf die Kleine aufpassen.
Die Dreijährige weint die ganze Fahrt. Bis zu diesem Tag ist sie noch nie Zug gefahren. Die Familie ist arm, und der Papa sagt, Armut sei das Los der Weisen. Die Mama ist in Košice geboren und spricht Deutsch. Sie hat einen entfernten Cousin geheiratet, der in Prag Arbeit gefunden hatte. Sie war zu ihm geflüchtet, weil auf der Außenwand ihrer Schule plötzlich in Schönschrift stand: Juden unerwünscht.
Das kleine Mädchen sieht weiße Wolken vor dem Fenster. Sie schwimmen neben dem Zug in der Moldau. Am meisten vermisst sie ihre Schwestern; sie haben ihr einen Spruch auf Deutsch beigebracht.
Beklage nie den Morgen,
der Müh und Arbeit gibt.
Es ist so schön zu sorgen
für Menschen, die man liebt.
Das Rattern des Zuges macht ihr Angst, und eins der großen Mädchen kneift die Kleine in den Oberschenkel, damit das Heulen endlich aufhört. Die andere hilft ihr abends, die Decke aus der Umklammerung der harten Lederriemen zu befreien. In dem Moment begreift ihr Körper instinktiv, dass er ab jetzt allein ist. Bis zu dieser Nacht hat immer die Mama sie ins Bett gebracht und in den Schlaf gewiegt.
Das Mädchen blickt durchs Fenster auf die Wolken, und auf ihrem Oberschenkel blüht ein schmerzender, himmelblauer Fleck auf. Kinderaugen können Wolken satteln und sie umformen. Sie sehen ihre eigenen Sterne und geben den Gestirnen neue Namen. Noch als Erwachsene wird sie nichts davon wissen wollen, dass die heutigen Sterne lediglich die Sterne früherer Zeitalter spiegeln.
In London wird das Mädchen von fremden Händen hin und her gereicht. Es gerät in eine gerechte, wenn auch strenge Familie auf dem Land. Sie haben eine Autowerkstatt, der einzige Sohn geht auf die Universität, es gibt einen Jagdhund und eine kostbare orangefarbene Katze. Die Kleine lernt eine neue Sprache, sie wächst heran und wird zum Problemkind. Sie landet in einer Besserungsanstalt und weigert sich ein paar Jahre lang zu sprechen. Die Familie holt sie gelegentlich zu sich nach Hause, wenn es der Adoptivmutter besser geht. Wie sich herausstellt, litt sie schon immer unter Depression; sie haben die Dreijährige aufgenommen in der Hoffnung, ein kleines Kind würde für Zerstreuung und Fröhlichkeit sorgen. Die einzige Vertraute des Mädchens ist die orangefarbene Katze. In den Gesprächen mit den gelben Augen benutzt sie eine Zwischensprache; eine Sprache zwischen der des Herzens, die sie verlässt, und der des Verstandes, die sie annimmt.
Man hat einem dreijährigen Kind gesagt, es würde einen Ausflug machen in ein Land namens England. Bald würde die Familie wieder zusammen sein. Wir haben dich nie angelogen, oder? Wir haben doch immer gut für dich gesorgt, das weißt du, und du weißt auch, wie lieb wir dich haben. Du fährst mit dem Zug voraus, das ist ein großes Abenteuer.
Sie hat es ihren Eltern und ihren Schwestern lange übelgenommen, dass sie alleine losgeschickt wurde. Und dass die anderen sich nie wieder gemeldet haben. Sie haben sie weggeschickt, und sie wusste nicht, warum.
Die Adoptivfamilie sorgt für sie; sie bezahlen die Schulgebühren und die Universität. Zu ihrem fünfzehnten Geburtstag lassen sie aus geschmolzenem Gold Ohrringe in Form von Vergissmeinnicht für sie anfertigen. Das Gold hatte ihr Großvater im Mund getragen; für ihre Reise gab er alles, was er besaß.
Nicht einmal als Erwachsene, wo sie den Kontext der damaligen Zeit kennt, wird sie mit der Tatsache fertig, dass sie in den von Nicholas Winton organisierten Kindertransport gesetzt wurde und ihre Familie nie wiedergesehen hat. Das Einzige, was sie niemals verlieren wird, sind der gepunktete Regenschirm und das abgewetzte, mit Lederriemen umspannte Köfferchen. Immer wieder fühlt sie sich klein und verloren. Als sie erfährt, dass ihre Mutter in Ravensbrück ermordet wurde und ihr Vater mit ihren Schwestern in Auschwitz verschwand, kann sie noch weniger verzeihen. Das genaue Todesdatum kennt sie nicht. Sie hätte gemeinsam mit ihnen sterben sollen, und jetzt wandert sie durch die Welt mit dem Wissen, dass die anderen sich geopfert haben. Für sie. Dass sie vierfach dankbar sein muss für ihr Leben. Eine solche Verpflichtung kann kein Mensch tragen.
Es dauert lange, bis sie zu sich findet, sich von ihrer verzehrenden Liebe zu den vieren befreit, von der physischen Besessenheit, von dem Teufel, der in ihr kreischt und will, dass sie ihn hinauswürgt. Aber die Trauer wird sie nie los.
Sie sitzt im Zug, eingezwängt zwischen den jungen Frauen, die sich gegenseitig Zöpfe flechten, und schluchzt der netteren von ihnen in den Schoß. Ohne dass ihr Verstand es registrieren würde, überlegt der dreijährige Körper bereits, wie er den Rest des Lebens leben kann. Wie er das eigene Überleben überleben kann.
Man wird heute nie genau klären können, wie Winton es geschafft hat, aber der Buchstabe W scheint Hoffnung zu bergen; in Schweden rettete Raoul Wallenberg tausendachthundert Körper. Als Hitler 1938 das Sudetenland besetzt hatte, strömten Juden nach Prag und wurden schließlich in die von den Deutschen besetzten Gebiete zum Sterben geschickt. Tausende, Zehntausende Prager Zionisten stellten einen Antrag auf Aussiedlung nach Palästina. Die englische Regierung stellte zehn Immigrationsbewilligungen aus. Zehn Passierscheine.
Erst als Erwachsene öffnet sie das Köfferchen mit den Briefen ihrer Mutter; sie ist vierundvierzig Jahre alt. Nichts hat sie weggeworfen; töte nie den Ziehbüffel, wirf nie beschriebenes Papier weg. Die Mama hatte jeden Tag Briefe an den gepunkteten Regenschirm in England geschrieben; lange, zärtliche Briefe, voll mit Bildchen und innigen Sätzen. Manchmal lag auch ein Geldschein im Umschlag. Sie kann sich nicht erinnern, ob ihr die Briefe aus Prag von ihren Adoptiveltern oder Lehrern vorgelesen wurden. Sie kann sich nicht erinnern, ob sie gemeinsam eine Antwort geschrieben haben. Ob sie selbst eine Antwort gemalt hat.
Vielleicht hat sie es verdrängt.
Die Briefe strotzen vor Optimismus, du musst vor allem die neue Sprache lernen, womit spielst du, was hast du für Spielzeug, hast du schon neue Freunde und Freundinnen gefunden? Mit jedem Monat hört man zwischen den Zeilen mehr unterdrückte Sorgen und wachsende Verzweiflung heraus. Der letzte Brief ist aus dem Jahr 1942. Die ganze Zeit haben sie auf die Ausreisebewilligung gewartet. Sie haben sich an Bekannte in England gewandt; sie haben an Verwandte in Amerika geschrieben, die das Land schon zu Anfang des Jahrhunderts verlassen hatten, um Arbeit zu finden. Sie haben an Freunde in Chile geschrieben, Visaanträge gestellt.
Immer ging irgendetwas schief. Sie hatten keine Ahnung, wie man Behörden besticht, keine Übung im Lassowerfen. Sie waren nicht die richtigen Flüchtlinge; sie waren arm.
Sehnsucht schnürt ihr den Hals zu, und in ihren bleischweren Stunden wird sie den Würgegriff nicht los. Sie könnte sich zu Tode weinen, so vergeblich erscheint alles, die Uhr zeigt ihre Zeit an, und die tickt im Rhythmus der Schwellen der Eisenbahngleise. Von wegen Visum, die Erdkugel gehört doch allen. Es gibt niemanden, mit dem sie ihren Schmerz teilen könnte. Die Trauer zerreißt sie. Jede Nacht schluckt sie Scherben. Bis ins Alter vergeht kein Tag ohne Gedanken an die Eltern, an die Schwestern. Sie selbst wird älter und löst sich auf in der Zeit. Die Zeit fließt. Als zum ersten Mal in den Medien nach ihnen gesucht wird, nach tschechischen und deutschen Kindern, die bis 1939 mit den Kindertransporten nach England gekommen sind und dort adoptiert wurden, gibt sie nicht zu, dass sie dazugehört. Sie forscht nicht nach, ob jemand aus der entfernten Verwandtschaft überlebt hat.
Sie hat sich nie wie ein gerettetes Kind gefühlt.
In einem Zug voll mit schnatternden Kindern hat sich der Körper ein keimendes Trauma geholt. Mit jeder neuen Information bekam das Trauma frische Nahrung. Erst jetzt beantwortet sie Mamas Briefe. Täglich. In Gedanken.
Während eines internationalen Linguistik-Symposiums in den sechziger Jahren sieht sie sich Prag an. Sie ist bereits in einem Alter, in dem sie nicht mehr damit rechnet zu heiraten. Die Erinnerungen an den Hauptbahnhof bringen Schmerzen mit sich; quälend wüten sie in ihren Zähnen. Ein Zahnarzt bringt Linderung; er ist freundlich zu ihrer Panik und legt unerwartet den Bohrer beiseite, reibt sich die Augen. Er zeigt ihr Prag und gewährt ihrem Körper und den Erinnerungen Asyl. Er gibt sie dem leiblichen, fremden Land zurück; die Geflüchtete kommt nach Hause und nimmt den Namen ihres Mannes an. Später, als es keiner mehr erwartet, bringt ihr Körper Kinder zur Welt. Lange hat sie zu der daoistischen Göttin Bixia Yuanjun gebetet, zur Prinzessin der azurblauen Wolken. Sie wünschte sich einen Sohn, aber im Leben eines Mannes und einer Frau sind drei Dinge am schwersten zu erreichen: ein langer Bart, liebende Söhne und Silber im Überfluss. Nach der Geburt ist die Frau vierzig Tage unrein, hat sie eine Tochter zur Welt gebracht, doppelt so lang. Die Unreinheit wird von der rituellen Mikwe beendet.
Sie und ihr Mann kommen überein, das Leben als Opfer bringt einen nicht weit. Sie wollen ihre Traumata nicht auf die nächsten Generationen übertragen. Sie beschließen, über die Vergangenheit zu schweigen. Netilat jadajim; die schmutzige Hand soll die saubere nicht berühren. Auf das Gedächtnis kann man sich nicht verlassen, und nicht jeder versteht den Kontext, in den er hineingeraten ist. Zeitzeugendokumente finden sie beide lächerlich.
Als sie auf der Mittelschule in einen Streit gerieten, zischte eine Freundin sie an: »Du Drecksjüdin, halt doch die Klappe, hätte man euch bloß alle vergast.« Keiner der Umstehenden sagte etwas. Alle warteten gespannt, was sie erwidern würde.
Murmels Mutter meint ihre Kinder am besten zu beschützen, indem sie sich vom Judentum lossagt. Aber alles Gewesene bleibt in der Luft. Alles wiederholt sich, und alle atmen den Hass ein. Der Mensch hat sein Leben zu leben, und er muss es auch noch verarbeiten, damit ihm das vorherige Leben nicht in die Quere kommt. Wenn sie sich ständig mit ihrer Kindheit beschäftigt, woher soll sie die Kraft für die Kindheit ihrer Kinder und Enkelkinder nehmen? Die einzige Linderung findet sie in ihrer Arbeit. Die Beste in ihrem Fach sein. Die Beste auf der ganzen Welt.
Nur so sieht sie das Opfer ihrer Eltern und ihrer Schwestern gerechtfertigt. Wird nur ein einziger Mensch auf der Welt unterdrückt, ist Auschwitz umsonst geschehen. Im Internet stürzt sie in Erinnerungen wie ins eiskalte Wasser. Unter einem Foto von Erstklässlern tauchen Kommentare auf. Neben tschechischen Kindern sieht man auch vietnamesische und arabische Schüler auf dem Bild, ein paar Roma. Einige der Kommentierenden möchten die Kinder am liebsten ins Gas schicken, andere vergleichen sie mit Terroristen, zu denen eine Granate passen würde »wie der Arsch auf die Klobrille«, es wird sogar die Schulschließung verlangt; auch gegen die Lehrer und die Schulleitung richten sich die Drohungen, vor der Schule patrouillieren Polizisten. »Natürlich habe ich Angst. Wer weiß, auf welche Ideen die Leute noch kommen«, sagt eine dreißigjährige Romni, als sie vormittags vor der Schule auf ihre beiden Sprösslinge wartet. »Ich bringe sie morgens zur Schule und hole sie danach wieder ab. Zur Sicherheit. Ich hoffe, dass sie in der Schule sicher sind.«
Die Enkelkinder von Murmels Mutter werden in zwei Jahren eingeschult, und sie weiß nur zu gut, auf welche Ideen die Leute kommen können. Ihr Sohn ist überrascht, als sie, scheinbar völlig ohne Zusammenhang, sagt:
»Aber eins verstehe ich nicht. Warum Chinesisch? Warum nicht Hebräisch? Wenn es schon was Neues sein muss.«
Als hätte sie einen bleiernen Deckel über ihm zugeklappt. Ihn darunter begraben. Die Eltern haben sich ihrer Last entledigt, nun muss er sie heben. Ihm wird schwarz vor Augen, dabei ist er schon so vor lauter Zweifel ganz erodiert.
»Weil ich eine Sprache brauche, die mir nichts vorwirft. Und nichts von mir verlangt!«
Murmels Schwester ist gekränkt, dass sich ihr Bruder nicht einmal nach ihrem Befinden erkundigt. Sie möchte dem verstockten Murmel die überstürzte Abreise nach Peking ausreden. Hat ihm der Eiserne Vorhang denn nicht gereicht, muss er sich noch die lange, hohe Chinesische Mauer antun? Sie versucht ihn zu warnen, ihm zu erklären, dass man durch Weggehen nicht unbedingt das letzte Wort behält. Sie sitzen im Café, und Murmel ist bockig.
»Ich bin dort nicht allein. Der Programmierer hat mir eine Wohnung besorgt.«
»Der Programmierer?«
»Der Programmierer. Ein Kumpel deines Exmanns.«
Die Bandbreite seiner Interessen ist inzwischen auf China und sein Studium geschrumpft; wie gern würde sie sich ihren Schmerz und Kummer von der Seele reden. Liebe kann Schwäche sein und Luxus. Lange hat sie sich von der Liebe zu ihrem ersten Mann nicht befreien können, obwohl die gemeinsame Zeit so quälend gewesen ist. All ihre Beziehungen, sowohl die privaten, und das sind nicht wenige, als auch die öffentlichen, waren von Erinnerung an ihn durchtränkt. Der erste Mann hat ihr Blut vergiftet. Jahrelang zirkulierte das vergiftete Blut in ihren Adern, verschleppte den Herzschlag, bremste ihr Leben durch Melancholie. Er saß in ihrem Kopf wie hineingebohrt; auch wenn sie seitdem sogar mehrere Männer gleichzeitig hatte, ist sie ihm immer treu geblieben. Sie hat ihn nicht verraten, im Gegenteil; sie meinte, er wäre stolz auf sie, würde er es erfahren. Er würde es als eine Auszeichnung empfinden. Liebe aus Blei.
Es ist nicht ihre Schuld, wenn Männer so dumm sind zu glauben, die erste Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau müsse in einer Liebesnacht passieren. Nein, damit wirklich etwas passiert, braucht es Geduld und Zärtlichkeit. Den Exmann zu hassen hat auch nicht geholfen. Hass ist eine Form von Liebe und genauso hoffnungslos. Sie musste ihn nicht einmal sehen; die Geschichte in ihrem Körper war sich selbst genug, und die Entgiftung verzehrte Jahre. Sie erinnert sich sehr gut an den Tag, als sie endlich frei war und beschloss, mit dem kleinen David einen Neuanfang zu wagen, um nicht bis in alle Ewigkeit die brave Tochter ihrer Eltern zu spielen. Aber sie wurde schwanger und gründete eine zweite Familie; eine Diamantpartie mit einem neuen Mann, der dem Muster traditioneller Männlichkeit entspricht.
Der erste Mann verliert an Kontur. Warum hat sie ihm erlaubt, sie so zu behandeln? Anderen kann sie erklären, warum sie ihn geheiratet hat, sich selbst aber bleibt sie eine Antwort schuldig. Jahrelang hat sie seine verletzenden und erniedrigenden Angriffe in sich gehortet, ihm nicht gesagt, wenn er ihr unrecht tat oder sie beleidigte; sie zeigte weder Trauer noch Wut noch Enttäuschung. Seine nüchternen Begründungen redete sie sich schön. Dabei machten sein Businesslächeln und aggressives Verhalten sie verrückt. Nie weinte er, nie verlor er die Nerven. Er war wie alle Männer in der Umgebung. Sachlich. Sie fühlte sich allein gelassen, allein mit all ihren Sorgen, all ihren Verpflichtungen. Wie gern würde sie sich Murmel anvertrauen. Ihm davon erzählen.
Wir sind die Generation der Wende, Generation der Novemberdemonstrationen. Wir sind müde. Wir vertrauen den Tagen nicht.
Und die Uhr zeigt die Zeit an.
Murmels Schwester bestellt einen Wiener Kaffee mit einer doppelten Portion Schlagsahne. Auf die Sahne kippt sie Zucker aus vier Papiertütchen. Murmel trinkt warmes Zitronenwasser mit Ingwer. Eine orangefarbene Katze schlabbert in der Ecke grünen Tee aus einer Schale. Murmel spricht über sein neues Land, in das er flüchten und wo er sich integrieren möchte, er redet über sein Fach, und es klingt, als spräche er über sie, seine Schwester.
Das, was man als Familienführung bezeichnet, besteht in der Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit. Ist der Mensch anderen gegenüber wohlgesinnt, führt das ausschließlich zur Einseitigkeit seiner Persönlichkeit; verachtet er die anderen oder findet sie abscheulich, führt auch das zur Einseitigkeit; empfindet er Angst vor anderen oder katzbuckelt vor ihnen, führt es zur Einseitigkeit; neigt er zu Traueranfällen oder übertriebenem Mitleid, führt es zur Einseitigkeit; ist er eingebildet oder behandelt andere gar mit Geringschätzung, führt es ebenfalls zur Einseitigkeit.
Und so gibt es insgesamt nur wenige unter dem Himmel, die auch die dunklen Seiten derer verstehen, die sie mögen; und wenige, die nicht die hellen Seiten derer übersehen, die sie hassen.
Murmel nimmt die nervöse Frauenhand mit dem Kaffeelöffel nicht wahr. In der Unschuld seines Strebens ist er rücksichtslos geworden und weiß es gar nicht. Seine Schwester hält ein stummes Telefon in der Hand, Murmels Telefon klingelt, aber der Bruder hebt nicht ab. So weh es auch tut, so absurd es auch ist, sie und ihr jüngerer Bruder sind Rivalen, führen einen unbewussten Konkurrenzkampf. Gleichzeitig erwartet er Hilfe von ihr, der älteren, in sich ruhenden Schwester. Sie soll ihm das Geheimnis des Lebens verraten, das für ihn immer noch im Verborgenen liegt; deswegen ist er unruhig und gestresst, deswegen hat er kein Geld, keine Familie, rein gar nichts; sie hingegen hat alles. In Murmels Vorstellung ist seine Schwester erfolgreich. Das redet ihm keiner aus. Wenn er durch das gut gefüllte Wartezimmer ihrer Privatpraxis marschiert, sich in ihren Zahnarztsessel setzt, dann schweift sein Blick umher, und er fahndet nach Beweisen, studiert die hochmoderne Ausstattung.
Murmels Schwester weiß nicht, an welcher Stelle sie die Verkrustung durchstechen kann; ihr Bruder macht ihr Angst. Wie soll sie ihm von den Jahren nach der Scheidung erzählen, von der Überforderung, als sie mit maßloser Sorge ihren Sohn bemutterte, die Wohnung pflegte und die Praxis; die vielen Stunden der Verzweiflung, die Verschuldung. Sie wurde zu einer Rundfunkdebatte über das Leben als Alleinerziehende eingeladen. Sie lehnte ab. Sie konnte über das Kinderproblem nicht mit Männern sprechen, deren Wortschatz aus dem sechzehnten Jahrhundert stammte, deren Blick auf die Welt der des achtzehnten Jahrhunderts war und die der Sprache des einundzwanzigsten Jahrhunderts keine Beachtung schenkten. Diesen Männern stand ökonomische Macht zur Verfügung, wohingegen ihr eine schlechte Ausgangslage zur Verfügung stand, sollte sie ihre Rechte einklagen. Bis heute hört sie das immer wieder, alleinerziehende Mütter seien selbst schuld, wenn sie mit ihren Kindern am Rande der Armut leben; sie hätten halt nicht den richtigen Körper zur Diamantpartie verführt. Murmels Schwester nimmt ein Löffelchen Sahne und führt es zum Mund. Die Sahne schmeckt salzig. Die falschen Tütchen genommen.
Sie hat studiert, hatte nicht vor zu heiraten, war an einer konventionellen Ehe nicht interessiert. Auf Slowenisch samozaposlena, selbstbeauftragt, auf freiem Fuß. Aber dann ist es schließlich doch passiert, warum auch nicht, es geschehen seltsamere Dinge.
Eine Scheidung ist nie definitiv das Ende. Der Mann bleibt in Kopf und Seele, wenn auch nur noch als Fremder. Ein Verlust war ihr zugestoßen, sie trug Trauer. Und er sah ihr von irgendwoher zu.
Sie mochte die Stimme ihres Ex. Eine jugendliche Stimme, dahinter der starke Wille zu Macht und Kraft. Er hat sich zu früh ins Leben gestürzt. Eine einmalige Chance in den neunziger Jahren im zwanzigsten Jahrhundert in Osteuropa. Hals über Kopf gründete er eine Firma, Hals über Kopf wurde er Manager, Hals über Kopf kam er an Geld und Macht. Er wollte Sicherheit und die Dinge kontrollieren, bestand auch im Privatleben auf dem Einhalten von Regeln, die nie ausgesprochen wurden. Umso strikter hielt er an ihnen fest.
Als hätte er ganze Lebensetappen übersprungen. Erst mit vierzig versuchte er sich selbst zu begreifen, seine Position, seine Rolle. Aber er konnte auf keinerlei Erfahrung zurückgreifen. Er nahm den Weg in die Midlife-Crisis, typisch für osteuropäische Männer der neunziger Jahre. Weder im menschlichen noch im Leben eines Landes lässt sich eine Etappe überspringen; der moderne Mensch muss der Spirale seiner Absurdität bis zum Tiefpunkt folgen, damit er den Blick wieder nach vorn richten kann. Nichts lässt sich überspringen. Alles ist bedingt, alles knüpft ans Vorangegangene an, ohne einen zweiten Schritt kein dritter. Überspringen oder ausweichen gibt es nicht.
Mit subtilen seelischen Problemen hatte er nicht gerechnet. Er las Handbücher für Manager. In solchen Büchern tauchten Worte wie Problem oder Krise nicht auf. Stattdessen Worte wie Herausforderung und Raum für Innovation. Die Krise des mittleren Alters bei Männern der neunziger Jahre; ihre Schwächen kompensierten sie durch die Flucht zu jüngeren und noch jüngeren Frauen, die sie im Unklaren über ihre tatsächliche Lebenssituation ließen. An den Wänden der Managerbüros in ihren Firmen prangte das Foto von Arnold Schwarzenegger auf einem Schimmel mit Zigarre in der Hand. An der Wand hingen eingerahmte Zitate von Friedrich Krupp (Verlange wenig von dir und alles von den anderen, so sparst du dir viel Mühe), Philippe de Rothschild (Das Wesentliche im Leben bleibt den Augen verborgen, denn es liegt in meinem Safe) und Donald Trump (Geschäfte, die einen nachts nicht schlafen lassen, bringen nicht genug Ertrag).
Worte betrügen sich in der Öffentlichkeit, ohne rot zu werden.
Männer der neunziger Jahre sahen die Welt durch solche Worte. Nicht durch ihre Augen.
Sie holten sich Hilfe in Seminaren für Spitzenmanager, für Diplomaten, Rechtsanwälte. Die Teilnehmer kamen aus der ganzen Welt, durchtränkt von Vorurteilen ihrer Heimatländer. Absolventen bedeutender Schulen, sie hielten sich für gebildet. Der Vortragende legte eine Folie in den Projektor und bedeckte die letzte Zeile.
»Willst du etwas wissen, so frage einen Mann mit Erfahrung und keinen Gelehrten.«
Eine Diskussion entbrannte, keiner der anwesenden »Gelehrten« war mit dem Satz einverstanden, was für ein Blödsinn! Der Vortragende deckte die letzte Zeile auf. Das Zitat stammte von dem großen chinesischen Philosophen Lao-Tse. Die Köpfe nickten eifrig, hm, na ja, wenn der das sagt … Sie beurteilten nicht den Inhalt, sondern den Sprecher. Nicht was gesagt wurde, sondern wer es gesagt hatte, war bedeutsam. Sie hatten keine echten Freundschaften; alle bisherigen Kontakte waren durch Konkurrenz motiviert. Gestörte Beziehung zu den eigenen Kindern, Unfähigkeit zu kommunizieren und Gefühle der anderen wahrzunehmen. Beziehungen zu Frauen nur auf Grundlage erotischer Kriterien; entweder die Frauen waren sexuell attraktiv oder sie existierten in ihren Augen nicht; undenkbar, mit einer Frau befreundet zu sein. Sie heuerten Personal Coaches an und besprachen mit ihnen neue Firmenstrategien. Die Bezeichnung Firmenstrategie wurde durch den geistlosen Begriff Firmenphilosophie ersetzt. Ihre Aufmerksamkeit wandte sich allmählich Ländern wie Russland, Kasachstan oder Georgien zu. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war die Mehrheit von ihnen schon erstarrt und abgestumpft, im Beruf wie in der Ehe. Sie heirateten Frauen mit geringerer Intelligenz. Eine Achtzehnjährige wirkte niedlich, aber nicht eine Vierzig- oder Fünfzigjährige. Und dann kam die Rettung.
Sie entdeckten China, und China entdeckte sie. Im Vokabular des Exmannes und seiner Kumpel gab es das Wort Versagen nicht. Er hat nie begriffen, dass er in eine Midlife-Crisis geraten war.
Und so steckte er in seiner Midlife-Crisis, steckt dort noch immer und wird für den Rest seines Lebens dort bleiben.
Männer der neunziger Jahre. Die Politik der damaligen Zeit war ihnen schnuppe. Sie nutzten die Stille hinter den Kulissen, während das Gute vorn auf der Bühne benommen im Soave-Rausch taumelte und die Menschen voller Hoffnung durch die Straßen rannten und skandierten, Wahrheit und Liebe haben Lügen und Hass besiegt.
Welche Wahrheit?
Welche Liebe?
Heute leben sie in abgeriegelten Häusern, Gärten, Straßen. Hinter den Stacheldrahtzäunen sieht man sie nicht. In den Neunzigern schritten sie aus wie Jäger im teuren Jackett und mit geladener Waffe. Immer ein paar Schritte vor ihren Familien, die ihnen aus der Zeit vor 1989 wie ein Klotz am Bein hängen geblieben waren. Und die sie allmählich abschafften. Sie schafften die Zeugen ihrer Vergangenheit ab. Hatten sie entschieden, ein Verbrechen zu begehen, taten sie es mit Schwung. Ihre Gehirne arbeiteten auf Hochtouren. Die Energie zerstörte sie, trug sie aber auch; darin lag etwas weltmännisch Großzügiges.
Das Jahr 1989 war kein Wendepunkt. Warum sollten Daten überhaupt Wendepunkte darstellen? Mit diesem Unsinn der Geschichtslehrbücher werden Kinderköpfe malträtiert. Sinnfreie Konstrukte der Historiker und Politiker. Das Steckenpferd der Historiker sind Daten. Aber Daten bringen die Ursachen der Geschichtsereignisse durcheinander, sie zeigen nicht, wer mit welchen Mitteln die erkalteten Herzen zum Lodern brachte. Die Historiker unterrichten in Schulen und auf Universitäten, nach dem Unterricht stapfen sie los und wählen die Hitler von heute. Unbeabsichtigt machen sie so das Gestern zum Morgen, die Erinnerung zur Hoffnung. Man sagt, wer die Geschichte nicht kennt, muss sie wiederholen. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Wer die Geschichte kennt, lernt sie zu wiederholen. Der Mikrotraum direkt vorm Aufwachen. Die Menschen haben sich nicht geändert. Im Sozialismus gab es die ungeschriebene Parole, wer den Staat nicht bestiehlt, der schadet der eigenen Familie. Nach 1989 stahl man weiter, nannte es aber business. Und wer es rechtzeitig eingefädelt hatte, der bereinigte mit den Jahren sogar sein Strafregister und verschaffte sich eine neue, unbefleckte Vergangenheit. Und wurde Minister.
Für die eigene Zukunft können sie schon sorgen.
Murmels Schwester gibt nicht auf. Ein Patient schenkt ihr zwei Konzertkarten für das Festival Prager Frühling; Murmel lehnt ab. Sie lädt ihn ins Theater ein, Murmel lehnt ab. Sie will mit ihm sprechen; ein letztes Mal, wirklich. Damals im Caféhaus über dem Wiener Kaffee hat sie die Gelegenheit verpasst, ihr Kopf war verschlammt und eingetrübt von ihrem Exmann, mit dem Murmel sich so gut verstand.
Murmel lehnt weitere Treffen ab. Mit der fadenscheinigen Ausrede, er habe vor dem Abflug nach Peking noch viel zu tun. Murmels Schwester hat Angst. Ist er erst fort, werden sie nie wieder sprechen, nie wieder zusammenkommen. Nie. Der zweite nahe Mensch in ihrem Leben, mit dem sie keine gemeinsame Sprache mehr findet. Wobei es keine Rolle spielt, welche Sprache.
Ihr Exmann war etwas über zwanzig, als ihm ein reicher, unternehmungslustiger und geheimnisvoller Herr Geld anbot für eine Existenzgründung; wobei er die Firma an die frisch in Entstehung begriffenen Töchter und Söhne überschreiben ließ. Weil der unternehmungslustige Herr kein Devisenhändler war, kam das Geschäft zustande. Der Mann von Murmels Schwester gründete gemeinsam mit zwei Freunden eine Firma, alle waren sie Studenten der Informatik an der Wirtschaftshochschule. Besessen von Computern, lernten sie nur noch zu programmieren. Nach ein paar Jahren waren sie heillos zerstritten; einer setzte sich ab, wechselte zu einer ausländischen Firma und machte eine steile Karriere, stieg von einer guten Position zur nächsten, bis er in Peking landete. Dort hat er für Murmel eine Wohnung organisiert. Er wird der Programmierer genannt.
Güte und Reichtum gesellen sich selten gern, und während Reichtum und Macht wuchsen, gingen reihenweise Freundschaften in die Brüche; es herrschte die Blütezeit falscher Freunde und Bankkonten. Anfangs arbeiteten alle zusammen und halfen sich gegenseitig. Aber kaum hatten sie Geld, richteten sie sich gegeneinander. Auf einmal standen sie hoch im Kurs, waren etwas Besonderes, wohnten an angesagten Adressen, mieteten tolle Büros; Privilegien, für die man früher jahrelang hätte arbeiten müssen. Auf einmal hatten sie sehr viel Macht, aber sie holten keine alten Freunde mehr ins Team; die wunderbaren Tage, als alle entspannt und ohne Hintergedanken an eigenen und fremden Ideen und Plänen herumschraubten und nichts dafür verlangten, waren endgültig vorbei. Geld war das Lösungsmittel, und es zersetzte das Gewebe von 1989 wie eine Säure.
Den Kontakt hergestellt und das Geschäft eingefädelt hatte der nette Vater des Programmierers. Der Mann im Hintergrund, mit dem sich die Jünglinge dann einließen, warf einfache Köder aus. Er war ein knallharter Zocker, besaß einen Pilotenschein für mehrmotorige Flugzeuge und einen Learjet; er legte viel Wert darauf, dass er erhobenen Hauptes einsteigen konnte und den Kopf nicht einziehen musste. Das meinte er nicht als Angeberei. Aber es war Angeberei. Er war bei der Staatssicherheit gewesen und als ehemaliger hoher Offizier klug genug, nur im Hintergrund zu agieren und die alten Kontakte für sich zu behalten. Die pflegt er bis heute und besteigt jedes Privatflugzeug erhobenen Hauptes. Im einundzwanzigsten Jahrhundert wurde es ihm mit seinen Millionen langweilig, und nachdem er sich im Müßiggang eingerichtet hatte, stieg er in die Politik ein. Ein Spiel für gelangweilte Zocker; die Einsätze sind hoch, ähnlich wie vor 1989, als sich auf der Pferderennbahn in Chuchle kommunistische Funktionäre und Spitzel mit Künstlern in einer schwarzen Spielhalle trafen. Sie wurde betrieben von einem Schlagertexter. Auch der langweilte sich später mit seinen Millionen und wachte eines Tages mit der Vision auf, er werde Präsident. Im einundzwanzigsten Jahrhundert wurde es zur Erleichterung vieler wieder schick, sich rüpelhaft zu benehmen; die Menschen waren an ihre Staatssicherheit gewöhnt, und diese Sicherheit tauchte wieder auf, und zwar mit Geld versehen. Mit reichlich Geld gewinnt man vor Gericht alles, das ist so sicher, wie ein Schweinskopf gar wird mit reichlich Hitze.
Sie sind die Gleichen geblieben; haben nur andere Masken aufgesetzt und andere Uniformen angezogen. Darin sind die Mächtigen geübt. Die Generation der kapitalistischen Unternehmer wurde von unternehmerischen Geistern des Sozialismus erzogen. Sie brauchten bloß abzuwarten, bis sich innerhalb von zwei Jahren nach der Samtenen Revolution alle Naivlinge, Idealisten, Charta-77-Leute, Säufer und Bohemiens in der Politik erledigt hatten, all die Leute, die während eines Abgeordnetenbesuchs in Washington lediglich die dortigen Biersorten einer Prüfung unterzogen.
Warten, nein, besser gesagt: abwarten konnten sie schon immer gut.
Die Edlen ließen in ihrer Wachsamkeit nach.
Alle kehrten zu ihren Trögen zurück, richteten sich im Wohlstand ein, Mensch ärgere dich nicht.
Schon wieder mampfen alle den alten bolschewistischen Brei. Für Osteuropa hat ihn Stalin aufgesetzt, und Meister Chronos seufzt: Doch richtet sich der gemeine Mann im Müßiggang ein, ist ihm nichts schlecht genug; dann fühlt er sich in Anwesenheit eines Edlen unwohl, beginnt die eigene Unvollkommenheit zu kaschieren und die Vollkommenheit herauszustellen.
Eine Änderung gab es aber doch. Für den Exmann schien alles Teure und Auffällige aus einer besseren Welt zu stammen. Allmählich zogen ihn nur noch Dinge in ihren Bann. Menschen waren ihm unerwünscht, besonders die armen oder freundlichen. Seine Generation der Unternehmer des zwanzigsten Jahrhunderts lernte, Empfindsamkeit und Taktgefühl vorzutäuschen. Dabei fällten sie nur derbe Urteile, so derb wie die Gewohnheit der Parteikader beim Kommunistischen Parteitag, die Bierflasche mit ihren Goldzähnen zu öffnen.
Intelligenz, geistige Arbeit oder Kunst beeindruckte sie nicht. Sie hatten keine Ahnung von nichts. Ewige Kinder. Rachedurstige Kinder. Ihr Exmann beherrschte alle, auch wenn sie ihm nicht gehorchten. Die einzige feste und gefühlvolle Verbindung bestand zu seiner Mutter. Er nahm die Menschen um sich herum nicht wahr; allerdings gab er Kellnern, Serviererinnen, Taxifahrern und später, als er reich geworden war, auch Hotelboten und Zimmermädchen gern ein üppiges Trinkgeld. Das tat ihm gut. Er hasste das entschuldigende Lächeln seiner damaligen Frau, wenn er jemanden beleidigte und erniedrigte. Die Leute mieden ohnehin ihren Blick oder schwitzten. Sie wollten kein Mitleid. Sie wollten nicht durch Freundlichkeit auf ihre Erniedrigung aufmerksam gemacht werden, sie wollten nicht, dass sie wiedergutmachte, was nicht wiedergutzumachen war. Mit den Augen bettelten sie um seine Anerkennung. Seine Frau übersahen sie hasserfüllt.
Er kannte eine bessere Art sich zu entschuldigen: die Schuld zu delegieren. Niemand durfte besser sein als er. Er fand sich gerecht und großzügig, wenn er Kaugummi an seine Assistentinnen und Mitarbeiter verschenkte; Menschen, die unter seiner Kontrolle standen.
Alle waren sie besessen von der Kunst zu führen, alle wollten sie Millionäre werden. An größeren Zusammenhängen waren sie nicht interessiert und in Kleinigkeiten engherzig. Jeder hielt sich für etwas Besonderes. Jeder drängte nach vorne. Jeder wollte ein Haus im vorstädtischen Architektureinerlei, jeder wollte einen Audi, jeder wollte in den Alpen Ski fahren und in sterneverzierten Restaurants speisen, wo der Küchenchef persönlich an den Tisch kommt. Jeder wollte so cool sein, wie es im Sozialismus die Gemüsehändler, Tankstellenwirte und Devisenhändler gewesen waren. Die Elite der Nation. Von Generation zu Generation wurde eine Botschaft weitergereicht: Unter jedem Regime lässt es sich gut leben.
Sie waren immer glücklich. Aber was fängt man an mit solchen Menschen, die fast immer glücklich sind? Sie eilten von einer Beförderung zur nächsten, klopften sich gegenseitig auf die Schulter, lancierten ihre Kumpel und paktierten untereinander. In Wirklichkeit war alles eine einzige große giftgetränkte Firma. All die Aufsichtsräte und Ausschüsse und Teambuilding-Sitzungen, die Parteistreitereien und der Lobbyismus. Sie kultivierten ihren Chauvinismus, waren unsterblich, jung, fit bis zum Umfallen und randvoll mit Testosteron. Sie entdeckten Dimensionen von Luxus, nach denen es sie nicht einmal im Traum verlangt hätte.
Die Zeit zensierte das Vokabular und gab den Jungen neue Wörter in die Hand. Loser. Den Lebensweg eines Kindes plante man gleich ab dem Kindergarten; auf der Zielgeraden lagen Hochschulen in England und Amerika, Namen wie Harvard, Oxford und Cambridge flogen durch die Luft und mussten auch für Betrügereien wie die Harvard Fonds herhalten; allein das Wort Harvard stand für Seriosität und Prosperität, wirkte beruhigend und kostete die Anleger ihre ganzen Ersparnisse.
Vokabular der schwarzen Krähen.
Aber stopp. Wer hat die Aufgabe übernommen, das Leben anders anzugehen, wer hat sie geschultert?
Als Murmels Schwester in einer schwachen Minute (aber nein, es war doch eine starke Minute) ihrem Exmann erzählte, wie glücklich es sie mache, dass die besten und schönsten Dinge nicht käuflich sind, lachte er sie aus, als wäre sie geistig zurückgeblieben. Dinge wie Liebe und Freundschaft. Innerer Frieden. Harmonie. Glück. Wind, Wolken und Gras. Mein Gott, hat er gelacht.
Was soll man mit dem Leben anfangen, wenn man mit dreißig alles erreicht hat?
Die Uhr zeigt die Zeit an.
Die Generation der Kinder drängt nach vorn. Und seine Generation, die Generation der Programmierer, tritt allmählich in den Hintergrund. Wie auf dem Jangtse die hinteren Wellen die vorderen jagen, so rücken junge Menschen auf die Plätze der älteren vor. Die Alten müssen zurücktreten, damit ihnen das Wasser der hochgepeitschten Wellen nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, damit sie nicht das Gleichgewicht verlieren. Die Wellen. Sie bestürmen das Ufer, unerwartet, heftig, wild.