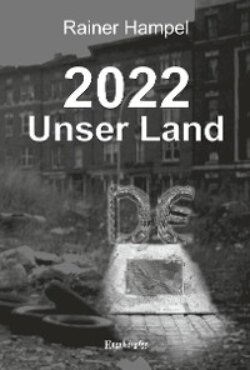Читать книгу 2022 – Unser Land - Rainer Hampel - Страница 7
3. KAPITEL
ОглавлениеRobert Heinel fuhr an diesem Morgen mit dem Fahrrad von seiner Wohnung in der Randstraße zum Betriebshof der Städtischen Entsorgung. Die SE der ehemaligen sächsischen Messestadt war sein Arbeitgeber und er hatte es nach ein paar Jahren Betriebszugehörigkeit bis zum Teamleiter geschafft. Diesen Job erledigte er gerne und seine Chefs waren mit ihm zufrieden. Er strampelte die RMA hinauf und bog ein paar Minuten später in den Betriebshof ab. Dort begegnete ihm sein Mitarbeiter Andreas Schubert, den er sogleich fragte: „Morgen, Andreas, was ist denn gestern herausgekommen für deinen Sohn?“
„Morgen. Paul muss bis 2021 in den Knast. Wir haben für sein junges Alter fünf Jahre weniger bekommen. Ach Robert, ich habe mich immer so gut, wie’s geht, gekümmert. Und nun das. Der Staatsanwalt hat auf versuchten Mord plädiert und der Richter wollte ihn, weil er ihn schon kannte, sogar für fünfzehn Jahre verdonnern.“
Andreas Schubert war der Vater von Paul, der nach seinem brutalen Messerangriff auf die junge Frau vor das Jugendgericht gebracht worden war. Der Prozess wurde an einem halben Verhandlungstag durchgezogen. Mehr Zeit stand den Justizbehörden selbst für Kapitalverbrechen nicht zur Verfügung.
Überhaupt war die staatliche Justiz zu einer ziemlich effizienten und deshalb auch brutalen Institution geworden. Zivilrechtsstreitigkeiten normaler Bürger wurden überhaupt erst dann vor Gericht zugelassen, wenn sie die den Gerichten vorgeschaltete Hürde der Schiedsstellen genommen hatten. Sinn und Zweck der Einführung der Schiedsstellen war es, die Gerichte erheblich zu entlasten und ebenso personell zu verkleinern. Die Schiedsstellen sollten die Funktion der Gerichte übernehmen. Das brachte für den Staatshaushalt den großen Vorteil einer extremen finanziellen Entlastung. Für den Bürger und die Rechtsstaatlichkeit ergaben sich jedoch nur Nachteile. Streitigkeiten mussten der Schiedsstelle vorgetragen werden – ohne Mitwirkung von Rechtsanwälten. Die Schiedsstelle fällte nach der Anhörung der Betroffenen sofort ihr rechtskräftiges und verbindliches Urteil. Berufungen waren in diesen Verfahren nicht vorgesehen. Die Prozessflut des „kleinen Mannes“ wurde unter Inkaufnahme der rechtlichen Nachteile und einer damit verbundenen Rückentwicklung des Justizwesens allerdings sehr wirkungsvoll eingedämmt. Die Streitigkeiten konnten nicht mehr wie noch bis Mitte der 2010-er Jahre vor Gericht gebracht werden, weil es den Streitenden einfach ums Prinzip ging und ohne vorher abzuwägen, ob der Aufwand den Nutzen überhaupt rechtfertigt. Es gab nur noch für wirklich unlösbare Fälle einen Rechtsweg, und die wurden dann durch die Schiedsstellen erledigt – oder von dort als so erheblich eingeschätzt, dass sie an ein ordentliches Gericht verwiesen wurden. Und selbst dann waren die Gerichte angehalten, „kurzen Prozess“ zu machen. Etwa ein Drittel der Streitigkeiten verhandelten außerdem Geheimgerichte, die keiner öffentlichen Rechenschaft unterlagen.
Insgesamt gelang es durch diese Maßnahmen, den Justizhaushalt um sage und schreibe mehr als die Hälfte und die anhängigen Verfahren sogar um bis zu 90 Prozent zu verringern. Das konnte man getrost als „Abspecken“ bezeichnen.
„Das ist schlimm für dich“, erwiderte Robert Heinel, „aber gerecht in der Sache. Nimm es mir nicht übel, wenn ich das so deutlich sage. Hat dir der LBD geholfen?“
„Ja, der hat was gebracht. Der Richter hat dem Plädoyer deines Freundes zugehört und es in das Strafmaß eingearbeitet. Danke dafür. Du hast uns damit einen großen Gefallen getan.“
Er streckte Robert die Hand entgegen und bedankte sich mit einem kräftigen Händedruck. Dass ein Vorgesetzter einem Unterstellten derart in persönlichen Dingen half, war im Jahr 2019 eher eine Seltenheit. Allgemein herrschte das Gesetzt der Härte und die meisten folgten dem Motto: Jeder ist sich selbst der Nächste.
„Hab ich gerne gemacht. Ich kenne Paul und glaube, dass er irgendwann die Kurve kriegt. Aber Andreas, das muss er jetzt absitzen und daraus lernen. Danach kann er neu durchstarten. Er wird dann gerade 18 Jahre alt. Da fängt das Leben doch erst richtig an.“
Robert Heinel war davon einerseits überzeugt, andererseits begrüßte er das harte Vorgehen gegen jugendliche Gewalttäter, zu denen Paul eindeutig gehörte. Die Gesellschaft war schlecht genug – auch ohne Paul, der nun drei Jahre über seine Tat nachdenken sollte. ‚Hoffentlich tut er’s auch‘, dachte Robert.
Die offene und schonungslose Art gegenüber Andreas bei gleichzeitiger Hilfestellung für ihn machte Robert zu einem für die Gesellschaft nützlichen Menschen. Seit seiner Kindheit verfolgte er höhere soziale Ideale, als er allgemein in seiner Umgebung wahrnehmen konnte, und setzte sich mit voller Überzeugung dafür ein. Über die Jahre manifestierte sich in ihm eine Art Klassenkampfgedanke. Aus seiner Sicht vorerst tatenlos nahm er zur Kenntnis, dass die Klasse der Wohl- und Rechthabenden in diesem Staat mehr und mehr die unteren Schichten für sich ausnutzte und schon beinahe in ihrer nackten Existenz bedrohte.
In dem Prozess gegen Andreas’ Sohn Paul hatte er versucht, einen „alten Freund“, der ein mittleres politisches Amt bekleidete, als Unterstützer und Fürsprecher für Paul zu gewinnen. Was ihm auch so gut als möglich gelungen war.
„Wie geht es denn nun weiter mit mir?“, wollte Andreas von ihm wissen. „Lasst ihr mir die Arbeit oder nicht?“
„Heute Nachmittag gibt es eine kurze Aussprache dazu mit meinem Boss. Ich hab es dir versprochen, also lege ich auch alle guten Worte für dich ein. Beweis mir künftig aber, dass es das wert war. Okay?“
„Geht klar Robert. Bitte denke daran, dass ich meine Eltern und den Vater meiner Frau mit unterstützen muss. Du weißt, dass man mit viertausend DEuro Rente nicht mehr viel anfangen kann. Ich zähle auf dich. Danke.“
Mit diesen Worten ging Andreas weiter über den Hof zu den Umkleideräumen, um sich für seine Schicht umzuziehen. Vor ihm lagen vierzehn Stunden Normalschicht, in denen er kreuz und quer durch die Stadt fuhr und Mülltonnen leeren musste.
Robert sah ihm hinterher und schob sein Fahrrad vor den Gebäudekomplex, in dem er ein kleines Büro hatte. Nachdem er das Rad sorgfältig angeschlossen hatte, ging er in hinein. Unterwegs nahm er schnell einen frischen Kaffee mit, den seine ältere Kollegin für ihn jeden Morgen kochte.
In seinem Büro sah er kurz in den Ablagekorb und machte sich ein Bild von seinem Arbeitspensum für diesen Tag. Es war mittelmäßig viel und deshalb ließ er sich in seinen Bürostuhl sinken und gönnte sich erst einmal in Ruhe seinen Morgenkaffee.
Sein Blick glitt über das spärliche Inventar des Raumes: Ein Aktenschrank aus Stahl und sein Schreibtisch stellten die einzigen Möbel dar. Unter dem Fenster hatte er aus gebrauchtem Material eine Blumenbank mehr schlecht als recht zusammengezimmert, auf der seltene Grünpflanzen standen, die er in seinem Entsorgungsbereich aus dem sammelte, was andere Leute wegwarfen. Die Rückenlehne ganz nach hinten gestellt lag er fast in seinem Stuhl und kam ins Grübeln.
Was war aus diesem Land geworden? Dies stellte die zentrale Frage für Robert dar. Und was war falsch gelaufen, was hätte man besser machen können? Immer wieder bedauerte er, dass es im ehemals vielleicht fortschrittlichsten Land Europas zu Verhältnissen gekommen war, in denen einfache Menschen wenig Rechte und Chancen hatten, ein kleiner politisch etablierter Kreis Macht über Finanzen und Gesetze hatte und vor allem: Warum war es so hoffnungslos überschuldet? Wieso wurde in den siebzig Jahren seit seiner Gründung so viel mehr verbraucht, als geschaffen wurde? Robert suchte mit seinen Möglichkeiten nach einer Lösung. Stets musste er bei diesen Gedankenspielen aber einsehen, dass er als kleiner Mann nicht die geringste Aussicht darauf hatte, an diesen schlechten Verhältnissen etwas zu ändern. Der Staat schien sich immer mehr von seiner Bevölkerung zu entfernen und in der Hauptstadt wurde wirklich am Volk vorbei regiert. Diese Regierung stellte mehr oder weniger nur noch den Konkursverwalter einer einst angesehenen Nation dar.
Was wäre zu tun? Robert war der Meinung, dass die wichtigste Maßnahme die Herstellung von Recht und Ordnung sein müsste. Gerade der Fall von Paul hatte ihm verdeutlicht, dass die unteren Schichten zu weiten Teilen verroht waren, was das Land in eine tiefe Depression geführt hatte. Und die vorstellbare Weiterentwicklung dieses Zustandes ließ nichts Gutes erwarten. Gewalt erzeugte Depression und umgekehrt, so dass es zu einer unaufhaltbaren Spirale des Schlechten kommen musste. Es fehlte an riesigen Geldmengen, um einen am Bürger orientierten Staatshaushalt aufstellen zu können, in dem genug Potenzial war, soziale Programme für das eigene Volk zu bezahlen.
Gerne und oft erinnerte er sich an früher, seine Kindheit in den 1980-er Jahren. Schon damals lebten seine Eltern mit ihm in der Messestadt in der Randstraße der Südvorstadt. Sie hatten ein normales und gutes Leben. Ab 1986 bekam Roberts Familie ein Pflegekind, einen Jungen in seinem Alter. Beide wurden zusammen eingeschult und weil sich Felix bestens in die Familie eingelebt hatte, durften Roberts Eltern ihn ein Jahr später adoptieren. Seinen früh verstorbenen leiblichen Vater hatte der Adoptivsohn nie kennengelernt und seine Mutter hatte ihn in der Folge vernachlässigt und es zur Alkoholikerin geschafft. In der Pflegefamilie blühte er auf und Robert und er wurden wie Geschwister groß. Damals war eigentlich alles in Ordnung, obwohl Robert später erfahren musste, dass auch nicht alles so gewesen war, wie es den Anschein hatte. Zumindest herrschte sozialer Frieden unter den Leuten und das war der größte Unterschied zu seinem jetzigen Leben. Früher Frieden – jetzt totale Anarchie. Untereinander gab es in diesem Land nur Misstrauen, Neid, Dummheit und in dessen Folge handfeste Gewalt. Soziale Kompetenzen schienen sich komplett aufgelöst zu haben. Deshalb schlummerte in Robert der Drang nach Verbesserung und sei es nur im kleinsten Rahmen.
Er hatte seinen Kaffee ausgetrunken, stand auf und ging nach draußen über den Flur zur Toilette. Nachdem er sich die Hände abgetrocknet hatte, sah er einige Momente in den Spiegel. Er erblickte einen Mann von fast vierzig Jahren mit kurzen dunklen Haaren. Seine fast ein Meter neunzig und seine schlanke Statur verliehen im etwas Hageres. Doch seine Gesichtszüge, seine Augen und sein Kinn wirkten männlich und vermittelten Stärke, die er durchaus besaß. Robert achtete auf sein Äußeres, Frauen zog sein gutes Aussehen an.
Wieder im Büro dachte er kurz an den Fall Paul und daran, dass er durch seinen Kontakt zu dem Mann vom Liberalen Bund helfen konnte. Nun wollte er sich seinerseits dafür bei diesem bedanken. Er wählte seine Nummer und wartete.
„Moin, Robert, du bist aber zeitig auf den Beinen. Ist doch gerade halb acht. Ist alles in Ordnung?“, meldete sich der Angerufene.
„Morgen, ja, ist alles okay. Ich wollte mich für Paul bedanken. Deine Erklärung hat ihm ein paar Jahre erspart. Ich habe eben mit seinem Vater gesprochen. Danke, auch von ihm.“
„Ist gut. Vielleicht kann er mir auch mal einen Gefallen tun.“
Robert verdrehte seine Augen, als er das hörte. Politikern ging es immer nur um den Handel mit Gefälligkeiten. Anscheinend führten die auch genau Buch darüber, um zu einem gefälligen Zeitpunkt auch alles wieder einfordern zu können.
Er erwiderte: „Immer hübsch alles merken und aufschreiben. Kann auch mal jemand etwas aus Überzeugung oder Nächstenliebe machen?“
„Robert, bleib mir vom Halse mit deiner Moral. Wo lebst du eigentlich? Es geht nicht mehr wie früher, alles bullebuh und schön.“
„Ach vergiss es. Ich wollte nicht gleich wieder unser altes Thema aufwärmen. Ich weiß ja, dass du es anders siehst. Wie geht es euch denn?“
„Danke der Nachfrage, alles bestens. Wie geht’s Mutter?“
„Auch gut, du weißt doch, wie sie sind. Mit der Neuzeit kommen sie nicht mehr klar. Ich muss mich eben kümmern.“
„Wir sehen uns ja bald. Grüß sie bitte ganz lieb von mir. Und von dir hoffe ich, dass du mir zu Weihnachten eine Frau an deiner Seite vorstellst.“
Er lachte bei diesem Satz, was Robert etwas verlegen machte. Frauen waren nicht gerade seine Stärke, obwohl er gerne eine Freundin hätte.
„Ach lass mich doch in Ruhe. Kümmere du dich um ordentliche Politik. Stellt was Ordentliches auf die Beine, sonst gibt’s Krach. Dann kriegen alle richtig was auf die Fresse. Will dann auch keiner.“
Stets erinnerte Robert daran, dass die Massen, wenn es politisch weiter so bergab geht, revolutionär zurückschlagen könnten und es dann den Verantwortlichen an den Kragen ginge. Zumindest träumte er davon.
„Robert, du kleiner Revoluzzer. 1917 und ’89 sind lange her. Wieso du nicht wegkommst, von dem alten Gelaber!? Unser Land ist neoliberal aufgestellt und wir machen das Beste daraus.“
„Du Träumer, sind neun Millionen Arbeitslose das Beste? Schade, dass ich euch nicht mal richtig die Meinung geigen kann. Ihr würdet Augen mach in eurem liberalen Club. Aber lass uns nicht streiten. Ich wollte dir doch danken.
Wann hören wir uns wieder?“
„In zwei Wochen ruf ich dich an und sage dir Bescheid wegen Weihnachten.
Lass es dir gut gehen. Bis dann mal.“
Vor dem Auflegen sagte Robert: „Bis dann. Mach es gut, Felix Dännicke!“
***
Am Nachmittag ging Robert in die zweite Etage des Gebäudes zu seinem Vorgesetzten. Jedes Mal, wenn er hier war, ärgerte er sich innerlich, dass dieses Büro erheblich besser ausgestattet war als sein eigenes. Schränke, Regale, eine Schreibtischkombination und ein Besprechungstisch waren hochwertige Möbel aus dunkler Holznachbildung. Den Fußboden bedeckte ein anthrazitfarbener Teppich, was dem Büro einen noch eleganteren, aber auch schwereren Ton gab. Vor dem großen Fenster liebte sein Chef Aluminiumjalousien, die das Tageslicht nur gedämpft hereinließen.
Robert grüßte höflich: „Guten Tag, wir wollten uns wegen Andreas Schubert unterhalten. Er hat die Sache nun überstanden.“
„Hallo, setzen Sie sich und nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Ich habe schon davon gehört.“
Robert schob ohne Umschweife den vor dem Schreibtisch stehenden Drehsessel zurecht und setzte sich seinem Chef gegenüber. Dieser hatte bereits ein Tablett hereinbringen lassen, auf dem Mineralwasser, Gläser, eine Kanne frischer Kaffee und Porzellantassen standen. Nachdem sich beide einen Kaffee eingegossen hatten, begann Robert: „Wir sollten nicht so viel Aufheben machen und die Sache praktisch sehen. Herr Schubert soll einfach weiter ordentlich arbeiten.“
Robert wusste, dass seine Vorgesetzten Anhänger von Härte und Strenge waren. Damit bezweckten sie eine strenge Disziplin in ihrer Belegschaft und vermieden firmenintern die ansonsten konfliktreiche Beziehung der Leute mit dem Gesetz. Die Gewalttätigkeiten von Familienangehörigen der Belegschaft hatten zwar keine unmittelbaren oder schlechten Auswirkungen auf den Betrieb, aber für die Chefetage war das ein willkommener Anlass, auch hier Unnachgiebigkeit zu demonstrieren. In der Städtischen Entsorgung sollte Zucht und Ordnung herrschen. Nachdem alle öffentlichen Betriebe die Tarifverträge aufgekündigt hatten, war der Einfluss der Gewerkschaft praktisch auf Null reduziert. Die Belegschaft war daraufhin nahezu vollständig aus der Gewerkschaft ausgetreten und somit ein, wie die Chefetage genüsslich formulierte, „gewerkschaftsfreier Raum“ entstanden. Allerdings waren die öffentlichen Betriebe so ziemlich die letzten, die diesen Schritt unternommen hatten. Bereits seit 2016 hatten alle größeren Konzerne damit begonnen und die Welle zog sich dann durch alle Branchen, alle Industriezweige bis hin in den öffentlichen Dienst. Beim radikalen Abbau des Justizwesens hatten die Gewerkschaften schon überhaupt kein Mitspracherecht mehr.
Robert bedauerte diese Zustände und sehnte sich nach einer, wie er es nannte, Entkapitalisation. Vorerst fühlte er sich zurückversetzt in den von Karl Marx beschriebenen Imperialismus, als höchster Stufe des faulenden, absterbenden Kapitalismus.
„Heinel, Sie wissen, wie wir darüber denken. Wir haben hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Was draußen passiert, geht uns nichts an, aber hier drin ist es eine Art Existenzsicherung, unser Prinzip auch mit Härte durchzusetzen. Haben Sie Ersatz für ihn?“
„Nein. Bitte ziehen Sie in Betracht, wie gut es sich auf die Arbeitseinstellung auswirken würde, wenn wir Schubert nicht entlassen. Wir hätten einen Mitarbeiter mehr, der dem Betrieb zu hoher Dankbarkeit verpflichtet wäre und hoch motiviert weiter seine Arbeit macht. Außerdem gebietet mir das mein soziales Gewissen.“
Sein Chef lachte unsensibel und erwiderte: „Heinel, machen Sie mal ‘nen Punkt. Wir haben diesen Laden unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Sie gehören übrigens auch mit dazu. Sie wissen, dass Sie mir mit dem Sozialgedöns gestohlen bleiben können. Gehen wir mal praktisch an die Sache. Wie können wir die Situation für uns nutzen?“
Sein Chef war durchaus geneigt, von einer Kündigung abzusehen, wenn er irgendeinen Nutzen aus der misslichen Lage des Mitarbeiters ziehen konnte.
Er fuhr fort: „Ich stelle mir Folgendes vor: Sie verklickern ihm, dass er sechs Monate in Folge eine Woche umsonst arbeiten muss. Wenn er damit einverstanden ist, rufen Sie Ihr Team zusammen und teilen ihm diese arbeitnehmerfreundliche Lösung durch die Geschäftsleitung mit. Einverstanden?“
Roberts Chef hatte eigentlich einen ziemlich rabiaten Arbeitsstil gegenüber seinen Mitarbeitern, nur bei Robert verhielt er sich etwas weniger aggressiv, weil er von ihm eine hohe Meinung hatte. Allerdings erwähnte er das ihm gegenüber niemals. Auch musste sein Chef anerkennen, dass ihm ein außergewöhnlich starker Charakter gegenüber saß, der im Sinne der SE gute Arbeit leistete. Das wollte er auch künftig nutzen, und so nahm er sich Robert gegenüber immer etwas zurück – auch wenn es ihm schwer fiel.
Obwohl Robert damit schon gerechnet hatte, weil es einfach in Mode gekommen war, jeden möglichen Anlass zur Gehalts- oder Lohnkürzung zu nutzen, tat er erstaunt und geschockt: „Aber das sind insgesamt eineinhalb Monatslöhne, die wir ihm streichen. Das ist zu viel. Er hat keinen Cent übrig im Monat.“
„Kommen Sie, Sie bringen ihm das rüber. Es ist auf ein halbes Jahr verteilt. Er wird es verkraften. Und wir haben einen vernünftigen ökonomischen Aspekt in die Sache gebracht.“
Sein Chef war ein Schwein. Das war Robert klar. Wie weit würde das führen, wenn die Arbeitgeber dermaßen in die Privatbelange der Menschen eingriffen?
Robert sah ein, dass er in der Sache zustimmen musste. Wenigstens hatte er Schuberts Job erhalten. Das war auch etwas wert.
Er wollte das Gespräch nun schnell beenden und sagte: „Sie können sich denken, was ich davon halte. Also gut, ich regele das so. Aber eines Tages kommt das alles auf uns zurück. Ich bin mir sicher.“
„Heinel, Sie sind keiner von den alten Philosophen, die uns das Kapital erklären müssen. Bleiben Sie einfach weiter ordentlich bei der Stange und wir kommen gut miteinander aus. Nehmen Sie es doch nicht so persönlich!“
Robert stand auf und verabschiedete sich ordentlich. Sein Chef hatte seinen Willen durchgesetzt, aber deswegen war er ja auch in dieser Position.
In seinem eigenen kargen Büro ließ sich Robert in den Stuhl sinken, drehte sich zum Schreibtisch und stützte den Kopf in seine Hände. Er stöhnte leise und sagte vor sich hin: „Was ist nur aus unserer Gesellschaft geworden?“
In Gedanken schweifte er zurück in seine Kindheitserinnerungen. Felix und er hatten wie echte Brüder zusammen eine schöne Kindheit erlebt. Seitdem war in Roberts Leben und seinem Heimatland viel passiert. Die Systeme wechselten, die Menschen veränderten sich; das Leben allgemein hatte mit dem früheren nichts mehr gemeinsam. Seit einigen Jahren galt das Prinzip: Alle dürfen alles! Es hing ihm zum Halse heraus, dass sich nichts und niemand mehr um soziale Grundwerte scherte, sondern alle nur auf Kosten der Allgemeinheit ihren persönlichen Vorteil suchten und der Grundgedanke der meisten Leute lautete: ‚und nach mir die Sintflut‘. Mit diesen aus Roberts Sicht niederen gesellschaftlichen Grundideen ließe sich „kein Staat“ mehr machen. Kein Politiker und keine politische Vereinigung, keine Organisation und auch kein Einzelner vermochte es mehr, auf andere Mitmenschen positiv einzuwirken und mit eigenem Engagement etwas Positives für das Allgemeinwohl zu erreichen. Das wollte augenscheinlich niemand mehr. Die individuellen Probleme der Menschen gestalteten sich zunehmend und für eine immer größer werdende Bevölkerungsschicht Existenz bedrohender, als es in den 2010-er Jahren überhaupt vorstellbar war. Die wenigsten verfügten über finanzielle Rücklagen, seitdem der Euro gescheitert und die Nachfolgewährung DEuro eingeführt wurde. Dieser einschneidende Schritt hatte für die meisten bedeutet, dass sich das reale Einkommen um mehr als zwei Drittel verringerte. Die neuen Löhne und Gehälter wurden derart niedrig festgelegt, dass die sich herausbildende Preisstruktur einen brutalen Kaufkraftverlust zur Folge hatte. Noch 2014 dachte niemand, dass es möglich wäre, die Monatseinkommen auf ein Drittel zu reduzieren – bei gleichbleibendem Preisniveau. Die Einführung des DEuro und die damit verbundene erhebliche Aufwertung der neuen Währung jedoch brachte das damals schon nicht unproblematische soziale Gleichgewicht vollends ins Wanken. Die Einkommen verringerten sich im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten dramatisch.
Und in der Folge verschlechterte sich auch der soziale Status des ganzen Landes drastisch. Früher geltende Werte und Normen wurden über Nacht auf den Kopf gestellt und über Bord geworfen. Die Jeder-gegen-jeden-Mentalität wurde zur neuen gesellschaftlichen Grundlage – praktisch zur Präambel des neuen Systems.
Damit konnte und wollte sich Robert nicht abfinden. In seinem Lebensumfeld versuchte er dieser Entwicklung entgegenzuwirken, das Leben auf kleinem Level wieder etwas lebenswerter zu gestalten. Als Rückschlag empfand er dabei die brutale Körperverletzung, die Paul und seine Kumpane der jungen Frau zugefügt hatten. Wenigstens wurden sie dafür halbwegs gerecht bestraft.